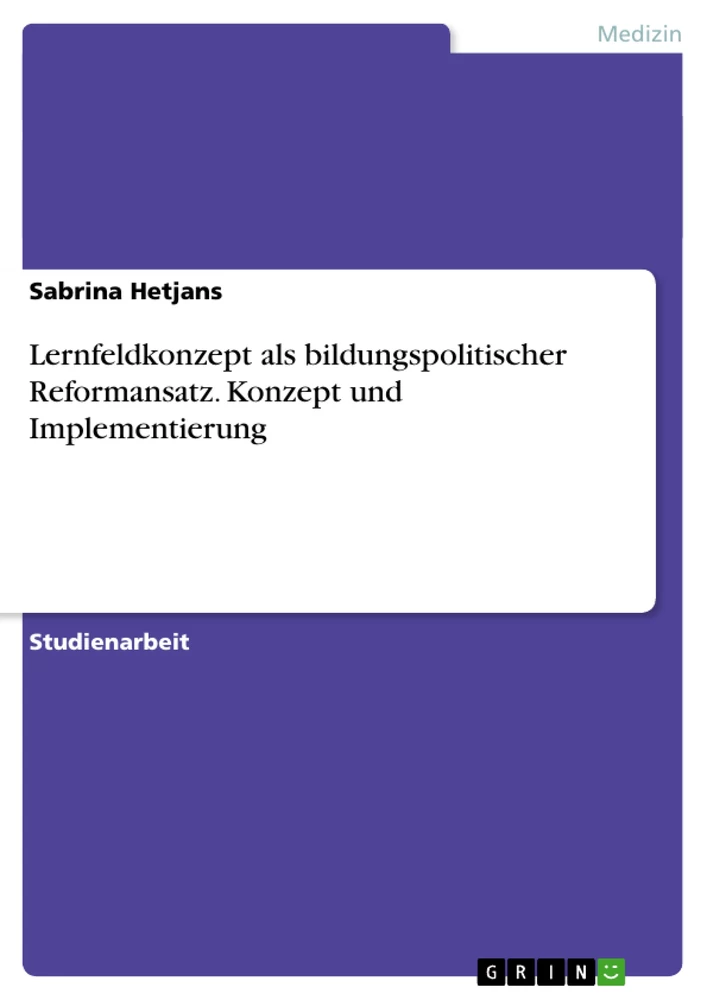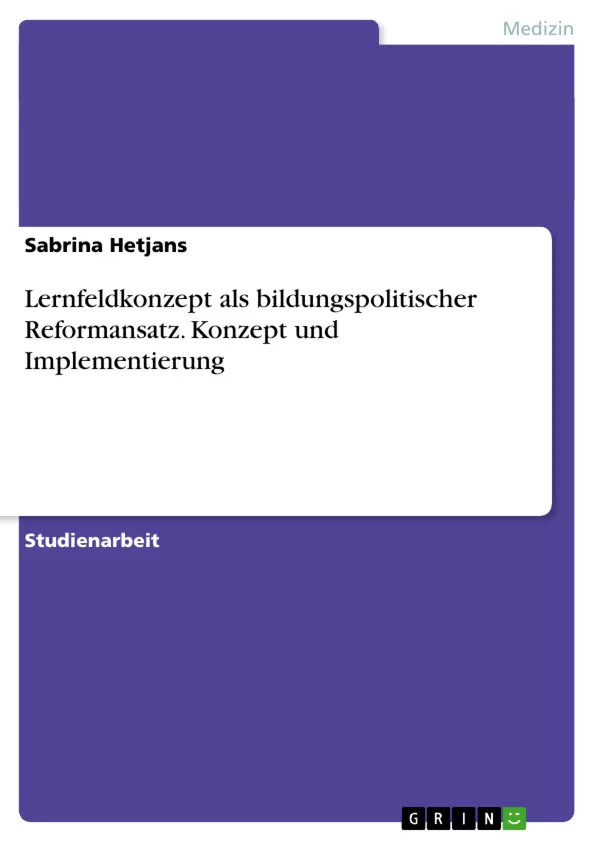Die traditionelle Idee der dualen Berufsausbildung, das heißt die Verknüpfung der Vermittlung von Fachwissen in der Schule und Fachpraxis im Ausbildungsbetrieb, entspricht immer weniger dem heutigen Verständnis vom Lernen und Lehren. Gegen das duale Modell sprechen organisatorische und didaktische Überlegungen. Ein neuer bildungspolitischer Ansatz soll das alte System reformieren. Lernfelder bzw. das Lernfeldkonzept markieren eine zur Zeit in Deutschland sehr stark diskutierte curriculare und organisatorische Reform der Berufsschule. In diesem Ansatz sollen die Idee des fächerübergreifenden Unterrichts, der Handlungsorientierung, der inneren Schulreform und weitere Faktoren miteinander kombiniert werden.
Das aus der Kultusministerkonferenz hervorgegangene Lernfeldkonzept ist aber keineswegs ein neues Reformwunder und durchaus umstritten. Die Stimmen der Kritiker weisen auf eine Reihe von Unstimmigkeiten hin, zum Beispiel die unklare Begrifflichkeit, den fehlenden Theorie-Praxis-Transfer. Die aktuelle Diskussion zeigt somit auch die Kehrseite des Lernfeldkonzeptes auf. Ob es sich bei dem neuen bildungspolitischen Reformansatz um einen Irrweg oder eine Chance für den zukünftigen Unterricht an berufsbildenden Schulen handelt, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Es stellt sich daher die Frage:
Welche Chancen bietet der neue bildungspolitische Reformansatz für den Unterricht an berufsbildenden Schulen und welche Schwierigkeiten können mit der Einführung des neuen Lernfeldkonzeptes auftreten?
Zunächst wird in einem historischen Überblick die Entwicklung vom Berufsbildungsgesetz 1969 bis zum heutigen Lernfeldkonzept aufgezeigt. Im Anschluss werden die Zusammenhänge zwischen Handlungsfeldern und Lernfeldern sowie die Transformation der Lernfelder in Lernsituationen näher erläutert. Ein weiterer Punkt ist die Implementation des Lernfeldansatzes. In diesem Zusammenhang werden der Handlungs- und Entwicklungsbedarf auf der Makroebene, Mesoebene und Mikroebene dargestellt. Anschließend werden die Vorläufer des Lernfeldkonzepts behandelt. Diesbezüglich erfolgt ein Vergleich der Frankfurter Methode und der experimentellen Werkkunde mit dem Lernfeldkonzept. Am Ende werden die fünf zentralen Problemfelder bei der Implementation erörtert, bevor ein Fazit gezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HISTORISCHER ÜBERBLICK
- VOM HANDLUNGSFELD ZUR LERNSITUATION
- HANDLUNGSFELDER
- LERNFELDER
- LERNSITUATIONEN
- IMPLEMENTATION DES LERNFELDANSATZES
- MAKROEBENE
- MESOEBENE
- MIKROEBENE
- DIE VORFAHREN DES LERNFELDKONZEPTS
- FRANKFURTER METHODE
- DIE EXPERIMENTELLE WERKKUNDE
- ZENTRALE PROBLEMFELDER BEI DER IMPLEMENTATION
- LEHRKRAFT
- ORGANISATION
- CURRICULUM
- PRÜFUNG
- SCHÜLER
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Chancen und Schwierigkeiten des Lernfeldkonzepts für den Unterricht an berufsbildenden Schulen zu beleuchten. Die Arbeit analysiert, wie sich das Lernfeldkonzept in den Kontext der beruflichen Bildung einfügt, welche Vorläufer es hat und welche Problemfelder bei der Implementation auftreten.
- Historische Entwicklung des Lernfeldkonzepts
- Zusammenhang zwischen Handlungsfeldern und Lernfeldern
- Transformation von Lernfeldern in Lernsituationen
- Implementation des Lernfeldansatzes auf verschiedenen Ebenen
- Zentrale Problemfelder bei der Einführung des Lernfeldkonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Lernfeldkonzept wird als ein neuer Ansatz zur Reform der Berufsschule vorgestellt und die Forschungsfrage nach Chancen und Schwierigkeiten seiner Einführung formuliert.
- Historischer Überblick: Die Entwicklung des Berufsbildungsgesetzes von 1969 bis zum Lernfeldkonzept wird skizziert, wobei die zunehmende Forderung nach Handlungsorientierung und lernortübergreifendem Lernen hervorgehoben wird.
- Vom Handlungsfeld zur Lernsituation: Die Zusammenhänge zwischen Handlungsfeldern und Lernfeldern werden erläutert, wobei die Transformation von Lernfeldern in Lernsituationen als didaktischer Prozess dargestellt wird.
- Implementation des Lernfeldansatzes: Der Handlungs- und Entwicklungsbedarf auf Makro-, Meso- und Mikroebene wird beschrieben.
- Die Vorfahren des Lernfeldkonzepts: Die Frankfurter Methode und die experimentelle Werkkunde werden als Vorläufer des Lernfeldkonzepts vorgestellt und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Lernfeldkonzept herausgearbeitet.
- Zentrale Problemfelder bei der Implementation: Die fünf zentralen Problemfelder Lehrkraft, Organisation, Curriculum, Prüfung und Schüler im Kontext der Implementierung des Lernfeldkonzepts werden untersucht.
Schlüsselwörter
Berufsausbildung, Lernfeldkonzept, Handlungsfeld, Lernsituation, Handlungsorientierung, Curriculum, Implementation, Frankfurter Methode, experimentelle Werkkunde, Problemfelder.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Lernfeldkonzept?
Es ist ein curricularer Reformansatz für Berufsschulen, der den Unterricht nicht mehr nach Fächern, sondern nach beruflichen Handlungsfeldern und Lernsituationen strukturiert.
Welche Vorteile bietet die Handlungsorientierung?
Schüler lernen praxisnah und fächerübergreifend, was den Transfer von theoretischem Wissen in die berufliche Praxis (Theorie-Praxis-Transfer) verbessert.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Einführung von Lernfeldern?
Herausforderungen sind unter anderem die unklare Begrifflichkeit, der hohe Organisationsaufwand für Lehrkräfte und die Anpassung von Prüfungsformaten.
Was ist der Unterschied zwischen Handlungsfeld und Lernfeld?
Handlungsfelder sind Aufgabenbereiche in der beruflichen Realität; Lernfelder sind die didaktisch aufbereiteten Entsprechungen für den Unterricht.
Was sind die "Vorfahren" des Lernfeldkonzepts?
Dazu gehören historische Ansätze wie die „Frankfurter Methode“ und die „experimentelle Werkkunde“, die bereits früher handlungsorientiertes Lernen forderten.
- Citar trabajo
- Sabrina Hetjans (Autor), 2004, Lernfeldkonzept als bildungspolitischer Reformansatz. Konzept und Implementierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43987