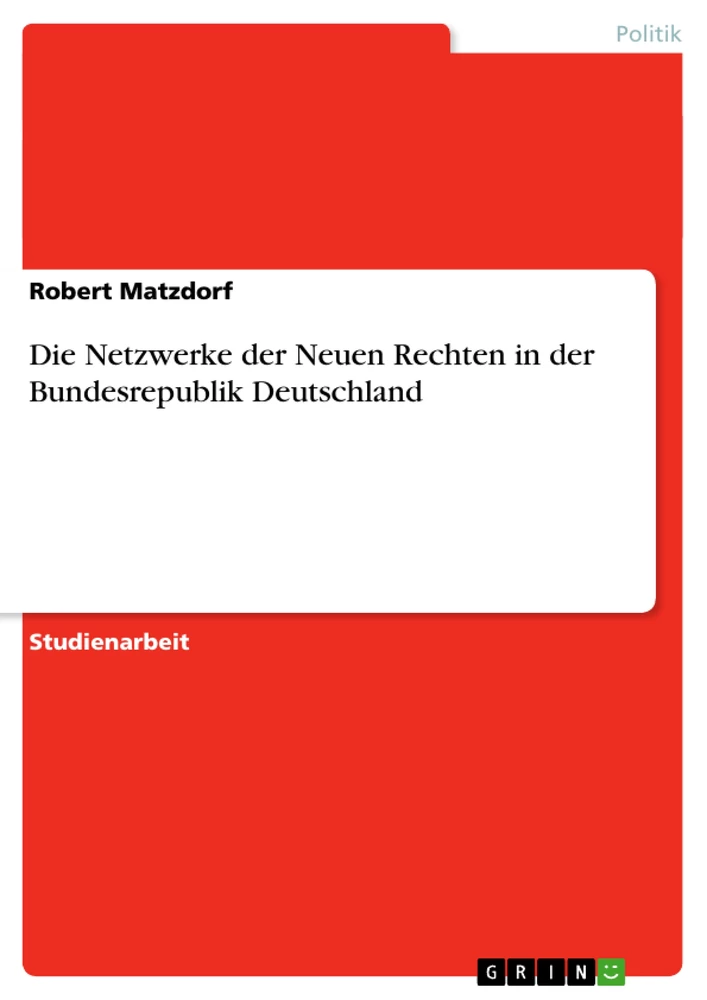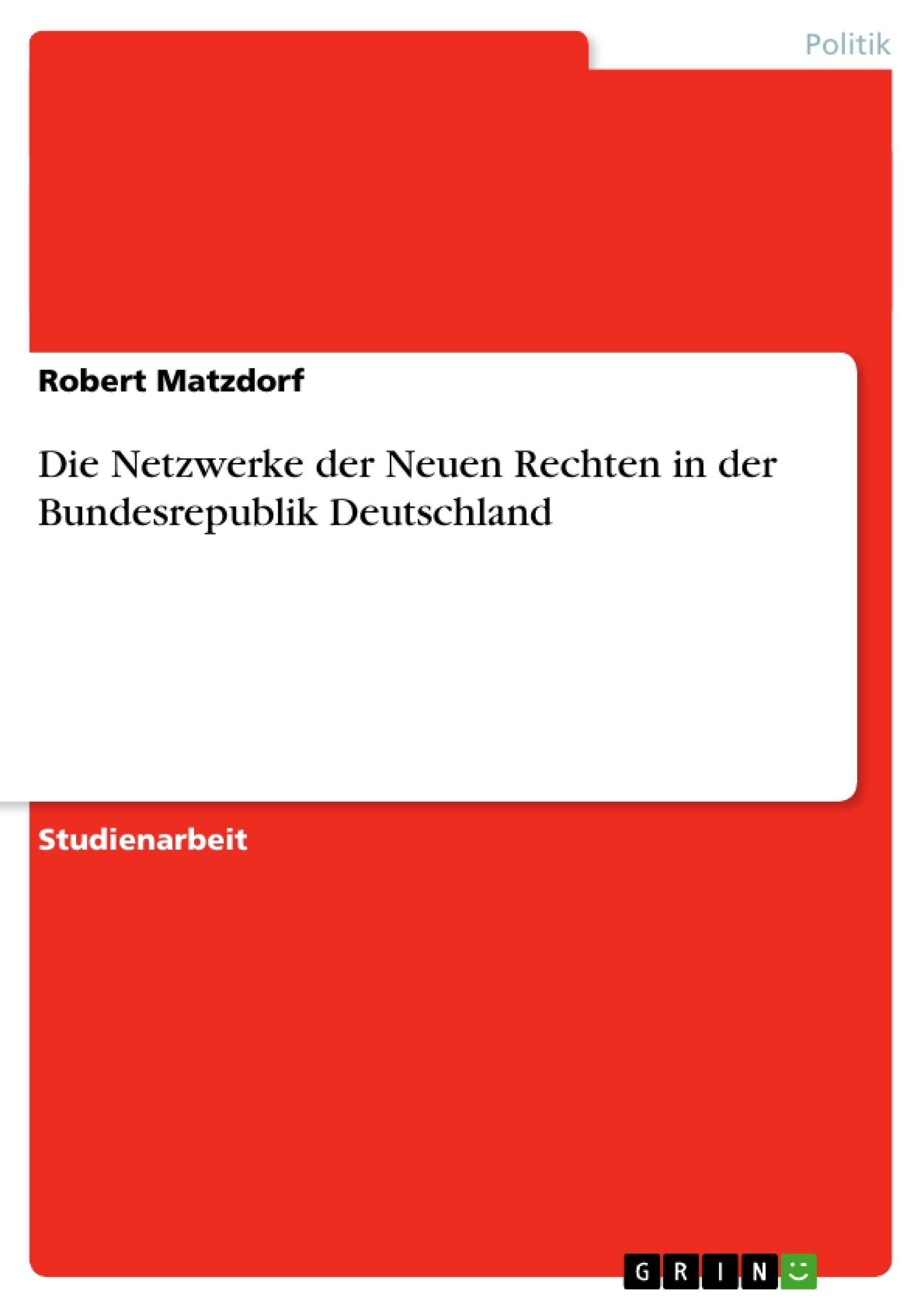Mit dem Begriff „rechtsradikal“ assoziieren die meisten Bundesbürger aus den neuen Bundesländern in erster Linie Neonaziaufmärsche von Skinheads. Bomberjacken, Springerstiefel, Glatze und ein hohes Maß an Gewaltbereitschaft kennzeichnen das typische Bild vom „Rechten“. Stellt man hingegen einem Bürger aus den alten Bundesländern die Frage, was für ihn rechtsradikal sei, so werden die rechten Parteien NPD, DVU und die Republikaner genannt. Diese Spaltung des Denkens innerhalb der Bundesrepublik erklärt sich wohl hauptsächlich dadurch, dass die rechten Parteien in den alten Bundesländern schon wesentlich länger präsent sind als auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Dort war nach der Wiedervereinigung Deutschlands die Präsenz von Skinheads im alltäglichen Straßenbild wesentlich stärker ausgeprägt, als in den alten Ländern. Selbst heute liegt der Schwerpunkt der deutschen Skinhead-Szene in Ostdeutschland: Obwohl in diesem Gebiet nur ein Fünftel der bundesdeutschen Bevölkerung lebt, sind hier 45% der gewaltbereiten Rechtsextremisten ansässig. Dass der deutsche Verfassungsschutz eine äußerst dominante Position in der öffentlichen Meinungsbildung innehat, zeigt sich darin, dass der Mehrzahl der Bürger, die sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben, den geläufigeren Begriff „Rechtsextremismus“ benutzt. Der Verfassungsschutz ist gewissermaßen Monopolist in der Definition des Rechtsextremismus, darf aber aus rechtlichen Gründen nicht den gesamten rechten Rand beleuchten. Sein Lichtkegel ist begrenzt und belässt weite Teile des rechten Spektrums in der Dunkelheit. Der in der Wissenschaftlichen Betrachtung verwendete Begriff Rechtsradikalismus hingegen umfasst das gesamte rechte Lager und schenkt auch den vom Verfassungsschutz nicht beleuchteten Gebieten Aufmerksamkeit. Hieran soll auch die vorliegende Arbeit anknüpfen die sich vornehmlich mit der Neuen Rechten und dort insbesondere mit rechten Netzwerken auseinandersetzt. Diese haben jedoch mit Skinheads und rechten Parteien wenig zu tun. Der Begriff Neue Rechte kennzeichnet eine intellektuelle Strömung des rechten Spektrums, die sich von der NS-Zeit und dem Hitler-Regime distanziert und stattdessen versucht, sich durch eine Modernisierung der rechten Ideologie zu etablieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Die Neue Rechte
- II. Die Neue Rechte und das Grundgesetz
- III. Feder statt Schwert
- IV. Exkurs: Ursachen des Rechtsradikalismus
- V. Beispiele rechter Netzwerke
- 1. Der Bund der Selbständigen und die „,Stimme der Mehrheit“
- 2. Die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.V. (SWG)
- 3. Institut für Staatspolitik (IfS)
- 4. Gesellschaft für Freie Publizistik e. V. (GFP)
- 5. Studienzentrum Weikersheim (SZW)
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Neuen Rechten in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Netzwerke dieser Strömung und untersucht deren Zielsetzungen, Überschneidungen und Konkurrenzsituationen. Darüber hinaus wird die Frage beleuchtet, inwiefern sich die Neue Rechte der politischen Mitte genähert hat.
- Die Neue Rechte als intellektuelle Strömung des rechten Spektrums.
- Die Spannungen zwischen der Neuen Rechten und dem Grundgesetz.
- Die Strategie der „politischen Mimikry“ und die Tarnung als „demokratischer Konservatismus“.
- Die Rolle der Netzwerke und ihrer publizistischen Tätigkeit.
- Die Frage nach der Annäherung der Neuen Rechte an die politische Mitte.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Neue Rechte
Dieses Kapitel stellt die Neue Rechte als eine intellektuelle Strömung des rechten Spektrums vor, die sich von der NS-Zeit distanziert, aber gleichzeitig antidemokratische Theorien aus der Weimarer Republik zitiert. Es werden wichtige Merkmale der Neuen Rechten wie die „kulturelle Hegemonie“, die „politische Mimikry“ und die „Ethnopluralismus“-Ideologie beschrieben.
II. Die Neue Rechte und das Grundgesetz
Dieses Kapitel untersucht die Spannungen zwischen den Ansichten der Neuen Rechten und dem Grundgesetz. Die Argumentationen von Carl Schmitt, dem ideologischen Wegbereiter der Neuen Rechten, werden herangezogen, um die konträre Haltung zum Grundgesetz zu verdeutlichen. Beispiele aus der neurechten Publizistik und Äußerungen von Politikern belegen die Ablehnung wichtiger Grundrechte wie die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Gleichberechtigung.
III. Feder statt Schwert
Dieses Kapitel beleuchtet die Strategie der Neuen Rechten, die sich im Gegensatz zu offenem Neonazismus auf publizistische und intellektuelle Mittel konzentriert. Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Netzwerke und die Rolle von Organisationen wie dem Institut für Staatspolitik (IfS) und der Gesellschaft für Freie Publizistik (GFP).
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Neue Rechte, Rechtsextremismus, Netzwerke, Grundgesetz, Carl Schmitt, „Ethnopluralismus“, „politische Mimikry“, „kulturelle Hegemonie“, „demokratischer Konservatismus“, Institut für Staatspolitik (IfS), Gesellschaft für Freie Publizistik (GFP), Studienzentrum Weikersheim (SZW), Verfassungsschutz, Rechtsextremismus und Neonazismus.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die „Neue Rechte“ vom klassischen Rechtsextremismus?
Die Neue Rechte versteht sich als intellektuelle Strömung. Sie distanziert sich äußerlich von der NS-Zeit und Skinhead-Gewalt und versucht stattdessen, durch eine Modernisierung rechter Ideologien Einfluss zu gewinnen.
Was ist mit dem Begriff „Politische Mimikry“ gemeint?
Es beschreibt die Strategie der Tarnung, bei der sich neurechte Akteure als „demokratische Konservative“ ausgeben, um ihre eigentlich antidemokratischen Ziele in der politischen Mitte anschlussfähig zu machen.
Was bedeutet „Ethnopluralismus“?
Ethnopluralismus ist ein zentrales Konzept der Neuen Rechten. Statt offener biologischer Rassentheorien wird die „Kultur“ als Trennungsmerkmal genutzt, um die Vermischung von Völkern abzulehnen.
Welche Organisationen gehören zum Netzwerk der Neuen Rechten?
Wichtige Akteure sind unter anderem das Institut für Staatspolitik (IfS), die Gesellschaft für Freie Publizistik (GFP) und das Studienzentrum Weikersheim (SZW).
Welchen Einfluss hat Carl Schmitt auf die Neue Rechte?
Carl Schmitt gilt als ideologischer Wegbereiter. Seine Theorien zum Ausnahmezustand und zur Freund-Feind-Unterscheidung werden genutzt, um Kritik am liberalen Rechtsstaat und dem Grundgesetz zu legitimieren.
- Citar trabajo
- Robert Matzdorf (Autor), 2005, Die Netzwerke der Neuen Rechten in der Bundesrepublik Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44000