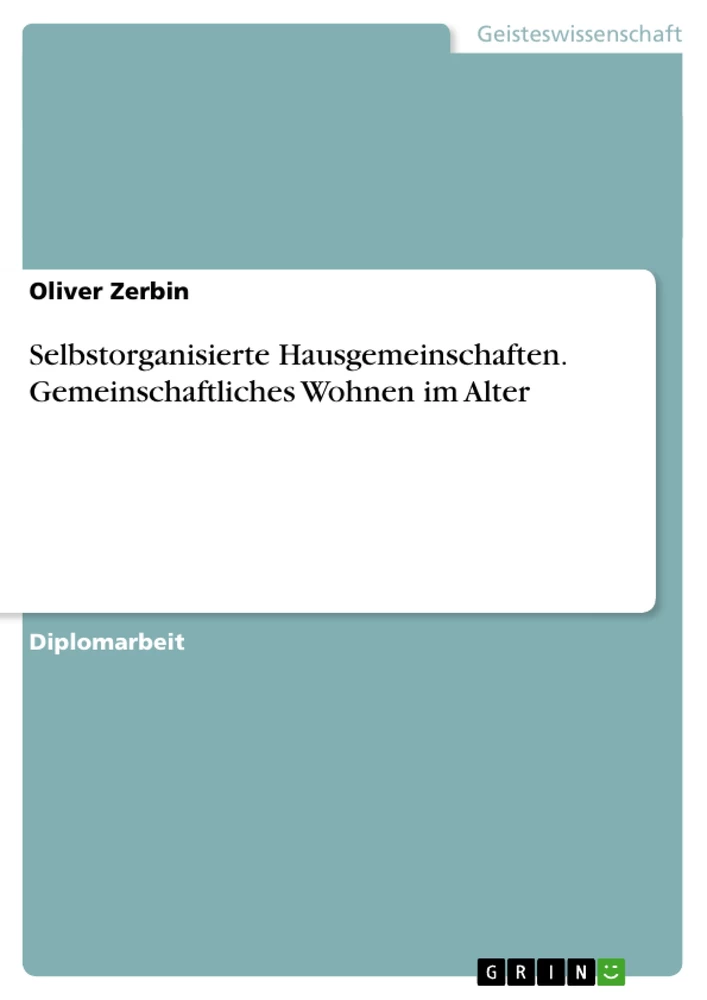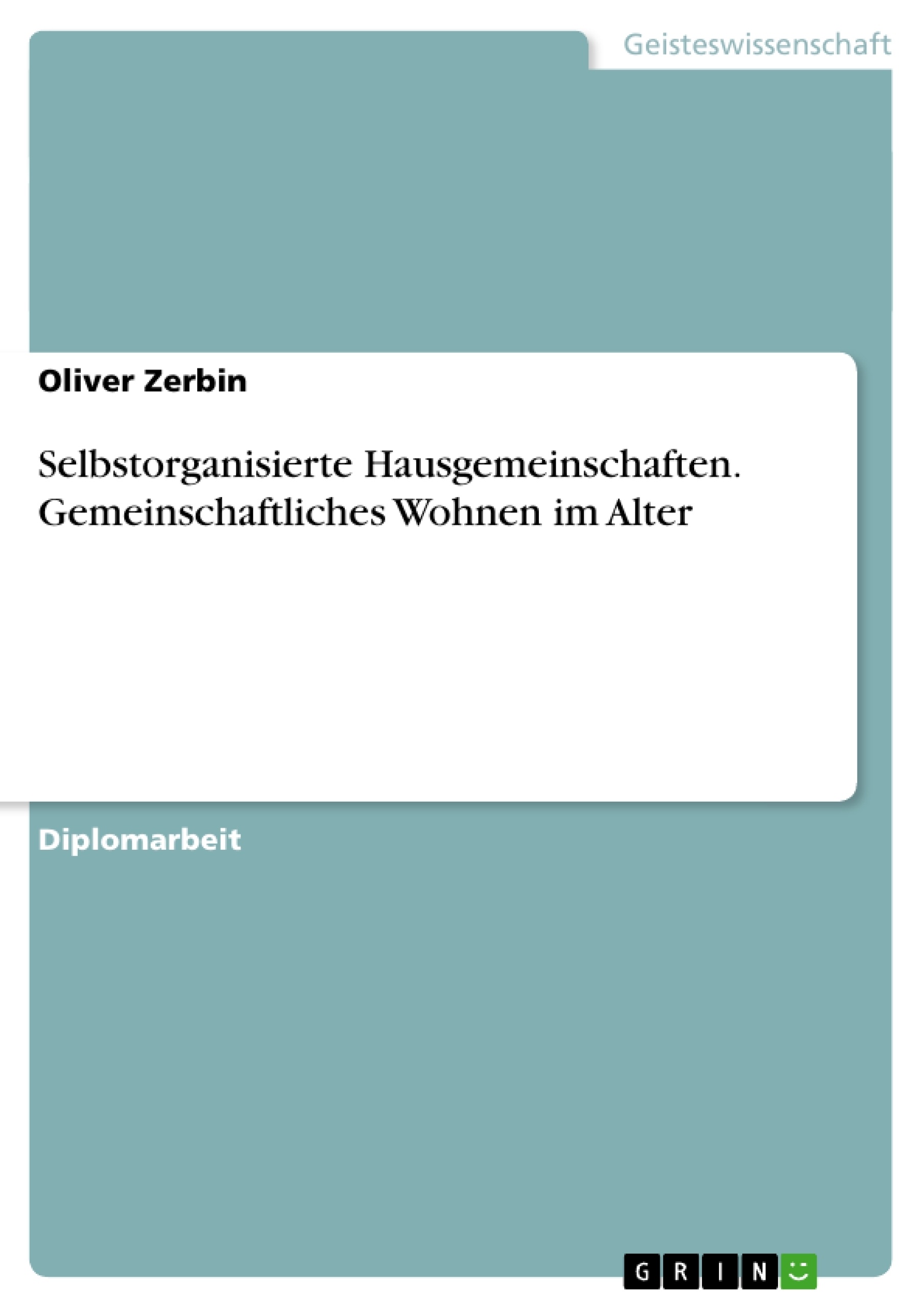Wohnbedürfnisse im Alter haben angesichts der wachsenden Anzahl von älteren Menschen in der deutschen Gesamtbevölkerung immer mehr an Bedeutung zugenommen. Dabei geht es nicht nur um die baulichen Aspekte des Wohnens, sondern auch verstärkt um die Lebensbedarfslagen von Seniorinnen und Senioren .Leben und Wohnen sind Begriffe, die gerade im Zusammenhang mit dem Alter sehr nahe verknüpft werden.
„Alltag im Alter heißt vor allem Wohnalltag“. Somit ist der räumlich - soziale Kontext von älteren Menschen zunehmend auf die Wohnung bzw. das Haus, die Nachbarschaft und das Wohnviertel konzentriert. Darüber hinaus schmälern gesellschaftsstrukturierte Individualisierungs-und Pluralisierungsprozesse den sozialen Einfluss der Familie auf den alten Menschen. Problematiken der Isolation und Singularisierung im Alter können dadurch begünstigt werden. Vor diesem Hintergrund sehen sich besonders die sogenannten „jungen Alten“ animiert, ihre Lebens- und Wohnbedarfslage den gesellschaftlichen Strukturelementen anzupassen, um ein Defizit an Wohn- und Lebenszufriedenheit zu kompensieren, so dass sich u.a. unterschiedliche Formen des gemeinschaftlichen Wohnens bilden.
Auf der Basis von einschlägiger Literatur und fokussierend auf selbstorganisierten Hausgemeinschaften im Projektraum Frankfurt/Main untersucht die vorliegende Diplomarbeit, ob diese Form von Empowerment eine tragfähige und zukunftsweisende Antwort auf defizitäre Lebens- und Wohnbedarfslagen von Senioren ist.
Der erste Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Erörterung von Bedeutungsschwerpunkten des Wohnens im Alter und einer aktuellen Übersicht bestehender Wohnformen mit teilweiser Beschreibung von Wohnkontextbedingungen. Der zweite Schwerpunkt wird gleichzeitig mit dem zweiten Kapitel eingeleitet und konzentriert sich auf einen vorhandenen Defizitbestand der Lebens- und Wohnbedarfslage von Senioren. Die daraus resultierende neue Bedarfslage des gemeinschaftlichen Wohnens wird im dritten Kapitel behandelt, worauf, nach der Zwischenbilanz im fünften Kapitel eine potenzielle Bestätigung anhand einer Projektraumerkundung in Frankfurt/Main erfolgt, die auch einen Blick auf den allgemeinen Entwicklungsstand in Deutschland und im Ausland wirft. Der dritte Schwerpunkt befasst sich im sechsten Kapitel mit Schlussfolgerungen, die einen zukunftsorientierten Handlungsbedarf implizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wohnen im Alter
- Bedeutung des Wohnens
- Psychosoziale Bedeutungskomponente
- Wohnformen im Alter – Ein Überblick
- Neue gemeinschaftliche Wohnformen
- Bedeutung des Wohnens
- Ein Defizitbestand der Lebens- und Wohnbedarfslage von Senioren
- Gesellschafts- und familienstruktureller Wandel
- Soziale Isolation und Einsamkeit
- Psychosoziale Folgen
- Wohnzufriedenheit- der bauliche Aspekt
- Gemeinschaftliches Wohnen und Leben im Alter als neue Bedarfslage
- Attribute dieser Lebens- und Wohnform
- Selbstbestimmung
- Unterstützung
- Soziales Beziehungsnetzwerk
- Psychosoziale Aspekte
- Der generationsübergreifende Aspekt
- Einflussnahme der Biografie
- Der bauliche Aspekt
- Attribute dieser Lebens- und Wohnform
- Zwischenbilanz
- Selbstorganisierte Hausgemeinschaften
- Definitionsmerkmale der Wohnform
- Entwicklungsstand in Deutschland
- Entwicklungsstand im Ausland
- Projektbeispiele aus Frankfurt/Main
- Bestandsaufnahme ausgewählter Projekte
- Hürden und Hilfen der Projektentwicklung
- Zugangsmöglichkeiten zu der Wohnform
- Zusammenarbeit mit Institutionen
- Bedeutung professioneller Projektbegleitung
- Bedeutung der Rechtsform
- Finanzierungsaspekte
- Leben und Wohnen in der Hausgemeinschaft
- Beweggründe für das Leben in gemeinschaftlicher Wohnform
- Vorurteile und Ängste
- Regeln und Zuständigkeiten
- Positive Aspekte des Zusammenlebens
- Negative Aspekte des Zusammenlebens oder: Die Schwierigkeiten der Gruppendynamik
- Pflegebedürftigkeit - Möglichkeiten und Grenzen
- Lebens- und Wohnzufriedenheit
- Schlussfolgerungen
- Handlungsbedarf
- Ausbau der Informations- und Beratungsnetzwerke oder: Aufklärungsarbeit auf verschiedenen Ebenen
- Verfahrenshürden abbauen oder: Kooperationsbereitschaft fördern
- Professionelle Begleitung und Unterstützung oder: Stärkung der Selbsthilfepotenziale
- Zukunftsperspektive
- Handlungsbedarf
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die wachsende Bedeutung gemeinschaftlichen Wohnens im Alter im Kontext der sich wandelnden Lebens- und Wohnbedarfslagen von Senioren. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich durch den demografischen Wandel und die Individualisierungsprozesse ergeben, sowie die Möglichkeiten, die gemeinschaftliche Wohnformen für die Lebensqualität von Senioren bieten.
- Defizite der Lebens- und Wohnbedarfslage von Senioren im Kontext des gesellschaftlichen Wandels
- Gemeinschaftliches Wohnen als Antwort auf veränderte Lebensbedingungen im Alter
- Selbstorganisierte Hausgemeinschaften als innovative Wohnform
- Herausforderungen und Chancen der Projektentwicklung
- Positive und negative Aspekte des gemeinschaftlichen Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Gemeinschaftliches Wohnen im Alter" dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- Wohnen im Alter: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Wohnens im Alter, insbesondere mit der psychosozialen Dimension. Es gibt einen Überblick über verschiedene Wohnformen im Alter, wobei ein Fokus auf neue gemeinschaftliche Wohnformen gelegt wird.
- Ein Defizitbestand der Lebens- und Wohnbedarfslage von Senioren: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem gesellschaftlichen und familiären Wandel für ältere Menschen ergeben. Es analysiert Themen wie soziale Isolation, Einsamkeit und die Bedeutung von Wohnzufriedenheit.
- Gemeinschaftliches Wohnen und Leben im Alter als neue Bedarfslage: Dieses Kapitel erläutert die Attribute gemeinschaftlichen Wohnens im Alter, wie Selbstbestimmung, Unterstützung und die Bedeutung eines sozialen Beziehungsnetzwerks. Es geht auch auf die generationsübergreifenden Aspekte dieser Wohnform ein.
- Zwischenbilanz: Dieses Kapitel bietet eine Zwischenbilanz der bisher vorgestellten Aspekte und stellt die Grundlage für die detailliertere Analyse von selbstorganisierten Hausgemeinschaften.
- Selbstorganisierte Hausgemeinschaften – Projektbeispiele aus Frankfurt/Main: Dieses Kapitel definiert die Merkmale dieser Wohnform, beschreibt ihren Entwicklungsstand in Deutschland und im Ausland. Es stellt anhand von Beispielen aus Frankfurt/Main die Herausforderungen und Chancen der Projektentwicklung dar.
- Schlussfolgerungen: Dieses Kapitel bietet Handlungsempfehlungen und beleuchtet die Zukunftsperspektive von gemeinschaftlichen Wohnformen im Alter.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen gemeinschaftliches Wohnen im Alter, selbstorganisierte Hausgemeinschaften, Lebens- und Wohnbedarfslage von Senioren, gesellschaftlicher Wandel, soziale Isolation, psychosoziale Folgen, Selbstbestimmung, Unterstützung, generationsübergreifendes Wohnen, Projektentwicklung, Finanzierung, Lebenszufriedenheit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind selbstorganisierte Hausgemeinschaften?
Es handelt sich um gemeinschaftliche Wohnformen für Senioren, die auf Selbstbestimmung, gegenseitiger Unterstützung und einem sozialen Beziehungsnetzwerk basieren.
Warum gewinnt gemeinschaftliches Wohnen im Alter an Bedeutung?
Durch den demografischen Wandel und die Individualisierung der Gesellschaft nehmen soziale Isolation und Einsamkeit im Alter zu. Diese Wohnformen bieten eine Antwort darauf.
Welche Hürden gibt es bei der Projektentwicklung?
Herausforderungen liegen oft in der Finanzierung, der Wahl der passenden Rechtsform sowie der Zusammenarbeit mit Institutionen und professionellen Begleitern.
Sind diese Wohnformen auch bei Pflegebedürftigkeit geeignet?
Gemeinschaftliches Wohnen bietet Unterstützung, stößt aber bei schwerer Pflegebedürftigkeit an Grenzen, die im Vorfeld klar definiert werden müssen.
Welche Rolle spielt der Standort Frankfurt am Main in der Arbeit?
Frankfurt dient als Projektraum für eine Bestandsaufnahme ausgewählter Projekte, um die praktische Umsetzung und die Lebenszufriedenheit der Bewohner zu untersuchen.
- Quote paper
- Herr Oliver Zerbin (Author), 2005, Selbstorganisierte Hausgemeinschaften. Gemeinschaftliches Wohnen im Alter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44023