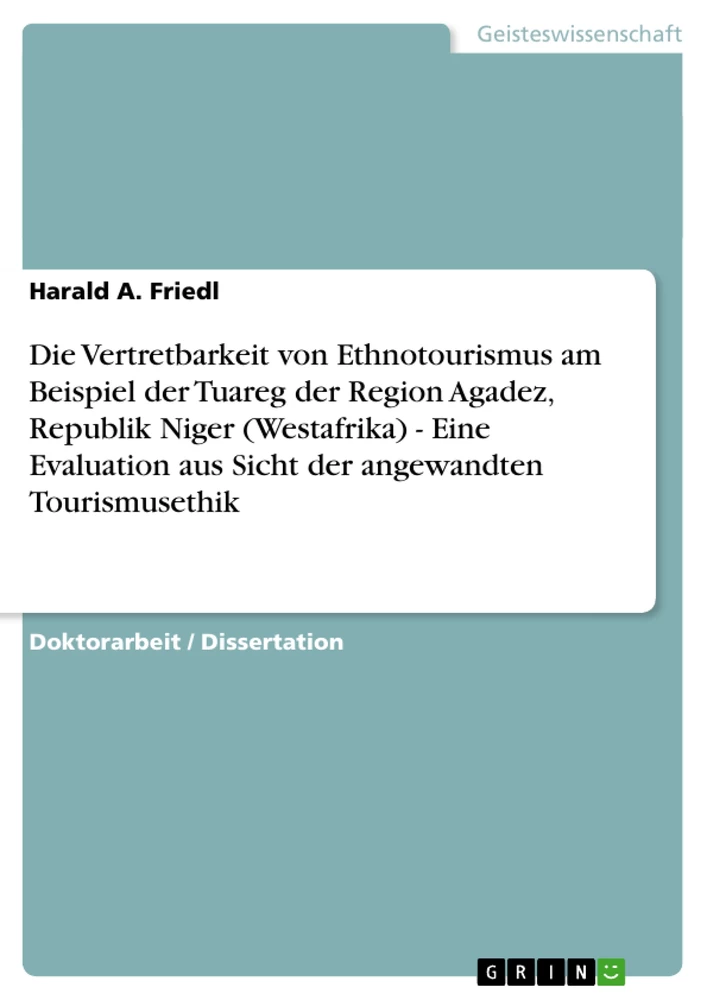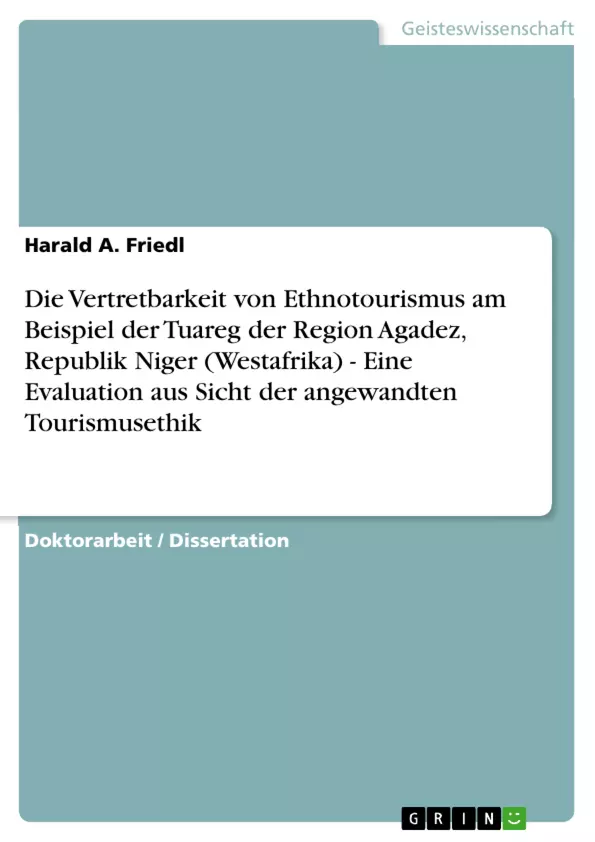Der Tourismus gilt seit dem Ende des 20. Jahrhunderts als einer der am schnellsten wachsenden, legalen Wirtschaftssektoren der Welt. Aufgrund der enormen Komplexität des Systems Tourismus berührt es praktisch alle Bereiche des menschlichen Lebens, und aufgrund der modernen, technischen Möglichkeiten und innovativen Organisationsformen sind auch längst sämtliche Winkel der Welt von Tourismus betroffen: Tourismus ist allgegenwärtig.
Die Präsenz einiger Tausend österreichischer Urlauber an den Palmenstränden von Sri Lanka, Thailand und Indonesien war die Ursache, dass die Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean in den Weihnachtsfeiertagen des Jahres 2004 zum medialen Dauerbrenner wurde. Denn erst durch die faktische „Mitbetroffenheit“ hatte sich der Horizont der Wahrnehmung und des Mitgefühls der Österreicher nachhaltig bis in diese entfernten Gegenden erweitert, wurde jene exotische Welt ein Teil unseres kollektiven Bewusstseins. Denn es hätte theoretisch jeden von uns, der die Ferne Welt zu lieben und gelegentlich auch zu besuchen pflegt, treffen können.
Am Nachmittag des 27. Dezember 2004 wurde ich von einer ORF-Redakteurin telefonisch gebeten, anlässlich dieser Naturkatastrophe zu den problematischen Auswirkungen des Massentourismus Stellung zu nehmen. Sie konfrontierte mich mit der These, dass die Folgen dieser Katastrophe- insgesamt weit über 100.000 Tote, darunter auch viele Tausend Touristen und gigantische Sachschäden - hätte verhindert werden können, wenn die Behörden ein entsprechendes Frühwarnsystem installiert hätten. Darauf hatte ich entgegnet, dass die eigentlichen Probleme des Massentourismus auf ganz anderer Ebene liegen würden. Das eigentliche Problem liege nicht in der Tatsache, dass es Massentourismus in Südostasien oder sonst irgendwo auf der Welt gebe, sondern dass Massentourismus vielerorts ungeordnet und auf Kosten der schwächsten Glieder der angestammten Gesellschaft expandiere. Der ganz normale Massentourismus produziere vielerorts massenhaft Tragödien durch Vertreibungen und Enteignungen, Sklavenarbeit und sexuellen Kindesmissbrauch, Tragödien, die von der Tourismuswirtschaft gleichsam als unvermeidbare „Kollateralschäden“ solange in Kauf genommen werden, solange nicht zahlende Touristen, davon betroffen, mit Stornos reagieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Tourismus - (k)ein Problem der angewandten Ethik?
- 1.2. Ethnotourismus - eine umstrittene Sonderform des Dritte-Welt-Tourismus
- 1.3. Sahara-Tourismus – „Neo-Kolonialisierung“ der Tuareg-Nomaden?
- 1.4. Die Fragestellungen
- 1.5. Angewandte Forschungsmethoden
- 1.5.1. Tourismusforschung als multidisziplinäres Unterfangen
- 1.5.2. Teilnehmende Beobachtung und Interviews
- 1.5.3. Die Struktur des touristischen Marktes Agadez
- 1.5.4. Strukturelemente der Agadez-Touristen und europäischer Anbieter
- 1.5.5. Evaluation eines Tuareg-Tourismusprodukts
- 1.5.6. Die Sicht der betroffenen Bevölkerung
- 1.5.7. Ideologiekritische Untersuchung von dominanten Mythen
- 1.5.8. Der Forscher als Forschungsobjekt - die Selbstbeobachtung
- 1.6. Aufbau der Arbeit
- 1.7. Persönlicher Zugang
- 2. Theoretische Grundlagen einer universellen Tourismusethik
- 2.1. Methodische Anmerkungen zu den Skizzen einer kybernetischen Ethik
- 2.2. Welche Ethik zur Lösung interkultureller, tourismusrelevanter Probleme?
- 2.2.1. Der handelnde und erkennende Mensch in der „Wirklichkeit“
- 2.3. Mensch und Gesellschaft als kybernetische Systeme
- 2.3.1. Das Feedback-Prinzip
- 2.3.2. Die Ausbildung von „Regeln“
- 2.3.3. Kybernetische Schaltelemente
- 2.3.4. Verhaltensmuster
- 2.3.5. Die Herausbildung von Wertekodizes
- 2.3.6. Zugehörigkeit als zentraler Disziplinierungsfaktor
- 2.3.7. Zugehörigkeit als Geltungskriterium?
- 2.3.8. Ethischer Relativismus als Scheinproblem
- 2.4. Ethischer Orientierungsbedarf in der Postmoderne
- 2.4.1. Der beschränkte Einsatzhorizont des Utilitarismus
- 2.4.2. Die Praxisuntauglichkeit deontologischer Ethikkonzepte
- 2.4.3. Die Wende zur prozeduralen Ethik
- 2.4.4. Die Integration von Empirie und Prinzipien: Krämers Integrative Ethik
- 2.4.5. Baumans Prinzip der Postmodernen Ethik
- 2.4.6. Kriterium „Befindlichkeit“: Rehabilitation eines ethischen Egoismus?
- 2.4.7. Strukturkonzeption des ökologischen Verantwortungsbewusstseins
- 2.5. Entscheidungsstrategien einer kybernetischen Ethik
- 2.5.1. Das Individuum als psycho-physisches System
- 2.5.2. Die Kybernetik direkter personeller Beziehungen
- 2.5.3. Die Kybernetik von Gruppenprozessen
- 2.5.4. Die Kybernetik von indirekt vermittelten sozialen Systemen
- 2.6. Zusammenfassung
- 3 „Entwicklung“ - der ideologische Wandel und die Krise eines Entwicklungsbegriffs
- 3.1 Begriffliche Grundlagen
- 3.1.1 Entwicklung
- 3.1.2 Ist Entwicklung messbar?
- 3.1.3 Armut
- 3.1.4 Entwicklungshilfe
- 3.1.5 Entwicklungspolitik
- 3.2 Der Wandel der Entwicklungsparadigmen im 20. Jahrhundert
- 3.2.1 Die Imperialismustheorien
- 3.2.2 Die Modernisierungstheorien
- 3.2.3 Strukturalismus, Dependenztheorien und Weltsystemtheorien
- 3.2.4 Das neue Paradigma der Grundbedürfnisbefriedigung
- 3.2.4.1 Was sind Grundbedürfnisse?
- 3.2.5 Die Krise der Entwicklungsländer
- 3.2.6 Das neue Paradigma der „nachhaltigen Entwicklung“
- 3.2.6.1 „Nachhaltige Entwicklung“ – ein widersprüchlicher Begriff
- 3.3 Fazit
- 4 „Entwicklungshilfe“ Tourismus?
- 4.1 Der historische Wandel der Rolle des Tourismus als Entwicklungsinstrument
- 4.1.1 Die Anfänge - Euphorie über die „weiße Industrie“
- 4.1.2 Die Ernüchterung der 70er-Jahre
- 4.1.3 Boom und Ernüchterung der 80er-Jahre
- 4.1.4 Die Wurzeln der „Community Based Tourism“-Projekte
- 4.2 Tourismus-Entwicklungspolitik der Gegenwart
- 4.2.1 Tourismus in der österreichischen EZA
- 4.2.2 Tourismus in der deutschen EZA
- 4.2.3 Tourismus in der britischen EZA
- 4.2.4 Tourismus in der US-amerikanischen EZA
- 4.2.5 Tourismus in anderen bedeutenden EZA-Organisationen
- 4.3 Die Messung von Nachhaltigkeit bei Tourismusentwicklung
- 4.3.1 Das Konzept der „Nachhaltigen Tourismusentwicklung“
- 4.3.2 Die Evaluation Nachhaltiger Tourismusentwicklung
- 4.4 Die Rolle der Institutionen: Umsetzungsbarrieren in der Praxis
- 5 Wahrnehmung und Interaktion zwischen Reisenden und „Bereisten“
- 5.1 Tourismus als Mittel zur Völkerverständigung?
- 5.1.1 Befürworter der „Verständnistheorie“
- 5.1.2 Gegner der „Verständnistheorie“
- 5.1.3 Die differenzierte Haltung
- 5.2 Fremde Kulturen „verstehen“ - ist das überhaupt möglich?
- 5.2.1 Was heißt „Verstehen“?
- 5.2.2 Ist interkulturelles „Verstehen“ grundsätzlich möglich?
- 5.2.3 Kulturkontakt
- 5.2.4 Kulturkontakt zwischen Reisenden und Bereisten
- 5.2.4.1 Das Theater-Modell von Goffman
- 5.2.4.2 Das Vier-Kulturen-Modell von Thiem
- 5.2.5 Modi des Fremderlebens
- 5.3 Der touristische Blick
- 5.3.1 Was ist Tourismus?
- 5.3.2 (Post-)Moderne Reisemotive
- 5.3.2.1 Natur
- 5.3.2.2 Erlebnis
- 5.3.2.3 Authentizität
- 5.3.2.4 Die Funktion von Klischees und Stereotypen
- 5.3.3 Die Wahrnehmung „exotischer“ Kulturen
- 5.3.3.1 Edle Wilde
- 5.3.3.2 Barbaren
- 5.3.3.3 „Grenzenlose Armut“…
- 5.3.4 Landschaftswahrnehmung
- 5.3.4.1 Bild der Wüste
- 5.3.5 Fazit
- 5.4 Der Blick der Bereisten
- 5.5 Chancen für interkulturelles Verstehen auf Reisen
- 5.6 Schlussfolgerung
- 6. Die Region Agadez
- 6.1. Kurzportrait der Republik Niger
- 6.2. Die Geschichte der Region Agadez
- 6.2.1. Das Sultanat Agadez
- 6.2.2. Die Ära der Kolonisation
- 6.2.2.1. Die Tuareg-Revolte von 1916
- 6.2.2.2. Das Massaker in Agadez
- 6.2.2.3. Die Kolonialverwaltung bis 1960
- 6.2.3. Die nationale Verwaltung seit 1960
- 6.2.4. Die Tuareg-Rebellion 1990 - 1997
- 6.2.4.1. Der Staatsstreich durch Ibrahim Maïnassara Baré
- 6.3. Die aktuelle politische Lage im Niger
- 6.4. Internationale Beziehungen
- 6.4.1. Frankreich
- 6.4.2. Libyen
- 6.4.3. Algerien
- 6.4.4. Sonstige wichtige Partner
- 6.4.4.1. USA
- 6.4.4.2. Deutschland
- 6.4.4.3. Republik China
- 6.5. Die wirtschaftliche Lage des Niger
- 6.5.1. Währung
- 6.5.2. Uran und andere Bodenschätze
- 6.5.2.1. Uran
- 6.5.2.2. Kohle
- 6.5.2.3. Gold
- 6.5.2.4. Erdöl und andere Bodenschätze
- 6.5.3. Viehwirtschaft
- 6.5.4. Ackerbau
- 6.5.5. Handel, Dienstleitungen, Industrie
- 6.5.6. Schattenwirtschaft
- 6.6. Probleme der Region Agadez
- 6.6.1. Überbevölkerung
- 6.6.2. Armut
- 6.6.3. Naturkatastrophen
- 6.6.4. Unsicherheit
- 6.7. Regionale Hilfsprojekte
- 6.8. Schlussfolgerungen
- 7. Geschichte des Tourismus in Agadez
- 7.1. Die ersten europäischen Besucher
- 7.2. Die verkehrstechnische Erschließung der Region
- 7.3. Die Entdeckung der Region Agadez als touristische Attraktion
- 7.4. Die Ära des Tuareg-Tourismus unter Mano ag Dayak im Niger
- 7.5. Tourismusförderung und Ausbruch der Tuareg-Rebellion
- 7.6. Der Neubeginn seit dem Ende der Rebellion 1997
- 7.7. Rückschläge - und Fortschritte wohin?
- 8. Die Tourismuspotentiale von Agadez
- 8.1. Die Relevanz von Attraktionen für die Tourismusentwicklung
- 8.1.1. Was sind Attraktionen?
- 8.1.2. Ursprüngliche und abgeleitete Angebote
- 8.1.3. Die Bewertung von Attraktionen
- 8.2. Das Klima während der günstigen Reisezeit
- 8.3. Von Niamey nach Agadez
- 8.3.1. Niamey
- 8.3.1.1. Das Nationalmuseum
- 8.3.1.2. Habou Bene - der „Große Markt“
- 8.3.1.3. Der Niger-Fluss
- 8.3.2. Dosso
- 8.3.2.1. Das „Réserve des girafes de Kouré“
- 8.3.2.2. Die Stadt Dosso
- 8.3.3. Tahoua
- 8.3.3.1. Die Stadt Tahoua
- 8.3.3.2. Der See von Tabalak
- 8.3.3.3. Ingall
- 8.3.3.4. Tegguida n’Tessoum
- 8.3.4. Zinder
- 8.3.5. Fazit
- 8.4. Agadez
- 8.4.1. Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Agadez
- 8.4.2. Die interessantesten Märkte von Agadez:
- 8.5. Die Naturattraktionen der Region Agadez
- 8.5.1. Das Aïr-Massiv
- 8.5.1.1. Die geologische Struktur des Aïr
- 8.5.1.2. Besondere Landschaftsformen im Aïr
- 8.5.1.2.1. Der Bagzan
- 8.5.1.2.2. Izouzaouene - die „Blauen Berge“
- 8.5.1.2.3. Arakao – die „Krabbenschere“
- 8.5.1.2.4. Adrar Bous
- 8.5.1.2.5. Adrar Chiriet
- 8.5.1.2.6. Die Tamgak-Schlucht
- 8.5.1.2.7. Die Ténéré
- 8.5.1.2.8. Temet
- 8.5.1.2.9. Die „Falais de Tiguidit“
- 8.5.1.3. Das Aïr-Ténéré-Bioreservat
- 8.5.2. Das Kawar
- 8.5.2.1. Fachi
- 8.5.2.2. Bilma
- 8.5.2.3. Dirku
- 8.5.3. Das Djado-Plateau
- 8.5.3.1. Chirfa
- 8.5.3.2. Djado
- 8.5.3.3. Djaba
- 8.5.3.4. Orida
- 8.5.3.5. Das Djado-Plateau
- 8.5.3.6. Tafassasset
- 8.6. Saurierfriedhöfe
- 8.6.1. Besichtigung von Saurierfossilien
- 8.7. Prähistorische Stätten
- 8.7.1. Die Frühgeschichte des Niger
- 8.7.2. Siedlungen
- 8.7.3. Gräber
- 8.7.4. Gravuren und Felsmalereien
- 8.7.4.1. Inhalte der Felsgravuren
- 8.7.4.2. Besondere Petroglyphen-Stätten
- 8.8. Die Kultur der Tuareg
- 8.8.1. „Antike“ Stätten: Assode
- 8.8.2. Oasen des Aïr
- 8.8.2.1. Azzel
- 8.8.2.2. Timia
- 8.8.2.3. Iferouane
- 8.8.3. Karawanen
- 8.8.4. Handwerksprodukte der Tuareg
- 8.8.4.1. Lederprodukte
- 8.8.4.2. Holzprodukte
- 8.8.4.3. Metallprodukte
- 8.8.4.4. Schmuck
- 8.8.4.5. Kleidung
- 8.8.4.6. Sonstige Gegenstände touristischen Interesses
- 8.9. Tuareg-Feste: Hochzeiten, Tabaski, Gani, Bianou
- 8.9.1. Zeremonien
- 8.9.2. Festliche Anlässe
- 8.9.2.1. Tabaski
- 8.9.2.2. Das Gani-Fest
- 8.9.2.3. Bianou
- 8.10. Überregionale Feste: Cure Salée, Air-Festival, Gerewol, FIMA
- 8.10.1. Cure Salée
- 8.10.2. Gerewol
- 8.10.3. Das Aïr-Festival
- 8.10.4. FIMA 1998 - ein Mode-Festival in der Ténéré
- 8.10.4.1. FIMA 2000, 2003 in Niamey
- 8.10.4.2. FIMA-Gründer Alphadi
- 8.11. Rallye Paris – Dakar
- 8.11.1. Die Rallye in Agadez 2000?
- 8.12. Schlussfolgerungen
- 9. Struktur des Tourismus in Agadez
- 9.1. Agenturen
- 9.1.1. Die Eigentümerstruktur
- 9.1.2. Die Ausstattung der Agenturen
- 9.1.3. Kapitalumsetzung
- 9.1.4. Reiseprodukte
- 9.1.5. Selbstverständnis der Veranstalter
- 9.1.5.1. Tourismus als Mittel zur Regionalentwicklung
- 9.1.5.2. Tourismus als Integrationsinstrument: Tchimizar Voyages
- 9.1.5.3. Tourismus als „Notlösung“
- 9.2. Personal
- 9.2.1. Unterbringung und Gastronomie
- 9.2.1.1. Hotels
- 9.2.1.2. Gastronomie
- 9.2.1.3. Schmiede, Schmuck- und Souvenirhändler
- 9.3. Politische Tourismusstrukturen
- 9.3.1. Das Tourismusministerium
- 9.3.2. Staatliche touristische Organisationen
- 9.3.3. Das Syndikat du Tourisme du Niger
- 9.3.4. Weitere Tourismusakteure: die UICN
- 9.4. Gesetzliche Rahmenbedingungen für den Tourismus
- 9.4.1. Einreise- und Aufenthaltsbedingungen für den Niger
- 9.4.2. Rundreiseregelungen
- 9.4.3. Gründung und Betreibung einer Agentur
- 9.4.4. Reiseführer
- 9.4.5. Naturschutzregelungen
- 9.4.5.1. Das Aïr-Ténéré-Bioreservat
- 9.4.5.2. Der Schutz des kulturellen und natürlichen Erbes
- 9.4.5.3. Umweltschutz
- 9.4.6. Steuern, Abgaben
- 9.5. Sonstige wichtige Einrichtungen
- 10. Strukturelle Probleme der Tourismusentwicklung in Agadez
- 10.1. Infrastruktur
- 10.1.1. Flugverbindung
- 10.1.2. Straßen
- 10.1.2.1. Vor- und Nachteile der verkehrstechnischen Erschließung
- 10.1.3. Telekommunikation
- 10.1.3.1. Kommunikation mit der Reisegruppe
- 10.1.4. Information
- 10.1.4.1. Nachschlagewerke
- 10.2. Die Mängel der Marktstruktur
- 10.2.1. Konkurrenz, Oligopolisierung, Dumping
- 10.2.1.1. Oligopolisierung
- 10.2.1.2. Dumping
- 10.2.1.3. Fazit
- 10.2.2. Mangelhafte Rechtsstaatlichkeit
- 10.2.2.1. Tourismusplanung
- 10.2.2.2. Personelle Kompetenzmängel der politischen Akteure
- 10.2.2.3. Korruption
- 10.2.2.4. Rechtliche Willkür
- 10.2.2.5. Mangelhafte Koordination zwischen Behörden und Tourismusstellen
- 10.2.2.6. Fazit
- 10.3. Mangelhafte Kooperationsbereitschaft
- 10.3.1. Kooperation mit Algerien
- 10.4. Chasses de touristes
- 10.5. Qualifikationsmängel
- 10.5.1. Die Ausbildungsinitiative der GIE von 1990
- 10.5.2. Die Ausbildungsinitiative von NIGETECH 2002
- 10.5.3. Fähigkeiten des Reiseleiters - Lehrinhalte vs. Praxis
- 10.6. Marketing der Agenturen und des Tourismusministeriums
- 10.7. Abhängigkeit von äußeren Faktoren
- 10.7.1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen in den Quellländern
- 10.7.2. Politisch-strukturelle Rahmenbedingungen in den Quellmärkten
- 10.7.3. Die internationale Sicherheitslage
- 10.8. Fazit: Die wirtschaftliche Bedeutung der Tourismus in Agadez
- 11. Die Marke „Tuareg“ – Mythos und Images
- 11.1. Herkunft des Namens „Tuareg“
- 11.2. Die Herkunft der Tuareg – ein Teil des Mythos
- 11.2.1. Tin Hinan
- 11.2.2. „Gemeinsame Wurzeln“ zwischen Tuareg und Franzosen
- 11.2.3. Die Garamanten
- 11.3. Historische Entwicklung des europäischen Tuareg-Images
- 11.3.1. Die frühen Tuareg-Berichte
- 11.3.2. Das Entsetzen nach dem Flatters-Massaker
- 11.3.3. Die Periode der französischen Konsolidierung
- 11.3.4. Das „Ende“ der (Tuareg-)Welt
- 11.3.5. Tourismus: Tuareg als Accessoires und Logo
- 11.3.6. Die Tuareg-Rebellion und ihre Folgen: Opfer und Helden
- 11.3.6.1. Tuareg als Opfer
- 11.3.6.2. Tuareg als Helden
- 11.3.6.3. Temust – die „Tuareg-Nation“
- 11.4. Elemente des gegenwärtigen Tuareg-Bildes
- 11.4.1. Der Schleier - Tagelmust
- 11.4.2. Freiheitsdrang
- 11.4.3. Duldsamkeit, Selbstdisziplin
- 11.4.4. Ritterlichkeit
- 11.4.5. Das Bild der Targia als „Herrin der Zelte“
- 11.4.6. Zusammenfassung
- 11.5. Mythos Tuareg als Marketing-Instrument: ein ethisches Problem?
- 11.5.1. Der Mythos als Werbung für die Tuareg-Destinationen
- 11.5.2. Der Mythos als Werbung für Unterstützungskampagnen
- 12. Der Markt des Tuareg-Tourismus
- 12.1. Der europäische Markt der Niger-Anbieter
- 12.1.1. Das Angebot an Niger-Touren
- 12.1.1.1. Die Preisstruktur
- 12.1.1.2. Die Angebotsvielfalt
- 12.1.2. Charakteristik der Niger-Anbieter
- 12.1.2.1. Das Unternehmensleitbild der Niger-Anbieter
- 12.1.2.2. Die regionale Angebotspalette: Spezialveranstalter oder Generalist
- 12.1.2.3. Reiseform: Kamel-, Trekking oder Generalist
- 12.1.2.4. Die Veranstalter-Sensibilität für Tourismusauswirkungen
- 12.1.2.5. Informationsqualität
- 12.1.2.6. Die Kompetenz der Reiseleiter
- 12.1.3. Schlussfolgerungen zu den europäischen Niger-Anbietern
- 12.2. Das Klientel des nigrischen Sahara-Tourismus
- 12.2.1. Anzahl, Herkunft und soziale Struktur des Niger-Klientels
- 12.2.1.1. Die Zahl der Agadez-Touristen
- 12.2.1.2. Die Herkunft der Agadez-Touristen
- 12.2.1.3. Soziale Struktur
- 12.2.1.3.1. Geschlecht
- 12.2.1.3.2. Alter
- 12.2.1.3.3. Urbane Herkunft
- 12.2.1.3.4. Bildungsstand
- 12.2.1.3.5. Beruf
- 12.2.1.3.6. Familienstand
- 12.2.1.4. Daten zur Reisesituation der Befragten
- 12.2.1.4.1. Reisebeginn und -ziel zum Zeitpunkt des Interviews
- 12.2.1.4.2. Aufenthaltsdauer
- 12.2.1.4.3. Reisestil I: Organisiert oder individuell
- 12.2.1.4.4. Reisestil II: In Gruppen oder allein
- 12.2.1.4.5. Reisemittel
- 12.2.1.4.6. Reisekosten
- 12.2.1.5. Reisemotive
- 12.2.1.5.1. Explizite Reisemotive
- 12.2.1.5.2. Erwartungen an die Reise
- 12.2.1.5.3. „Wüste“ als Reisegrund?
- 12.2.1.5.4. Bedeutung der Wüste
- 12.2.1.5.5. Höhepunkte des Programms
- 12.2.1.5.6. Kulturelle Höhepunkte
- 12.2.1.5.7. Die wichtigste, prägende Erinnerung
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Inhaltsverzeichnis: Ethnotourismus in der Sahara – „Neo-Kolonialisierung“ der Tuareg-Nomaden?
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Ethnotourismus in der Sahara, insbesondere im Niger, und untersucht dessen ethische Implikationen. Hauptthemen sind die Entwicklung einer universellen Tourismusethik, die kritische Auseinandersetzung mit dem Entwicklungsbegriff und der Entwicklungshilfe im Kontext des Tourismus, die Wahrnehmung und Interaktion zwischen Reisenden und Einheimischen, sowie eine empirische Untersuchung des Tourismusmarktes in Agadez (Niger). Dabei werden Mythen und Images der Tuareg-Kultur und deren Rolle im Tourismus kritisch beleuchtet.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine kybernetische Ethik, die interkulturelle Probleme im Tourismus lösen soll. Es werden verschiedene ethische Ansätze wie Utilitarismus, deontologische Ethik und prozedurale Ethik diskutiert, sowie die integrative Ethik von Krämer und Baumans Prinzip der postmodernen Ethik. Die Arbeit analysiert auch den Wandel von Entwicklungsparadigmen im 20. Jahrhundert und Konzepte der nachhaltigen Entwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: Teil A behandelt die theoretischen Grundlagen und eine umfassende Auseinandersetzung mit den ethischen und konzeptionellen Aspekten des Tourismus. Teil B umfasst eine empirische Untersuchung des Tourismusmarktes in Agadez, Niger. Dieser Teil beinhaltet eine Beschreibung der Region Agadez, die Geschichte des dortigen Tourismus, eine Analyse der Tourismuspotentiale (inkl. Kultur und Natur), der Tourismusstrukturen, strukturelle Probleme der Tourismusentwicklung, sowie eine detaillierte Analyse des "Tuareg"-Mythos und dessen Nutzung im Tourismusmarketing. Ein besonderer Fokus liegt auf der Untersuchung europäischer Reiseveranstalter und des Touristenklientels.
Welche Forschungsmethoden werden angewendet?
Die empirische Untersuchung in Teil B basiert auf teilnehmender Beobachtung und Interviews. Es wird die Struktur des touristischen Marktes in Agadez analysiert, einschließlich der Akteure (Agenturen, Personal, politische Strukturen), sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen und strukturelle Probleme. Die Arbeit beinhaltet eine ideologiekritische Untersuchung dominanter Mythen über die Tuareg-Kultur.
Welche Aspekte des Tourismus in Agadez werden untersucht?
Die empirische Untersuchung analysiert die Geschichte des Tourismus in Agadez, die vorhandenen Tourismuspotentiale (Natur, Kultur, Feste), die Struktur des Tourismusmarktes (Agenturen, Personal, politische Strukturen), strukturelle Probleme (Infrastruktur, Marktstruktur, Kooperation, Qualifikation, Abhängigkeit von äußeren Faktoren), sowie den "Tuareg"-Mythos als Marketinginstrument und seine ethische Dimension. Es wird auch der europäische Markt der Niger-Anbieter und das Touristenklientel detailliert untersucht (Herkunft, soziale Struktur, Reisemotive usw.).
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zu den ethischen Herausforderungen des Ethnotourismus in der Sahara und den spezifischen Problemen der Tourismusentwicklung in Agadez. Die Ergebnisse zeigen die Komplexität des Zusammenspiels zwischen Tourismus, Entwicklung und Kultur, sowie die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismuspolitik.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, Tourismusfachleute, Entwicklungshelfer und alle, die sich für die ethischen und gesellschaftlichen Aspekte des Tourismus interessieren, insbesondere im Kontext von Entwicklungsländern und kulturell sensiblen Regionen.
- Quote paper
- MMag. Dr. Harald A. Friedl (Author), 2005, Die Vertretbarkeit von Ethnotourismus am Beispiel der Tuareg der Region Agadez, Republik Niger (Westafrika) - Eine Evaluation aus Sicht der angewandten Tourismusethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44059