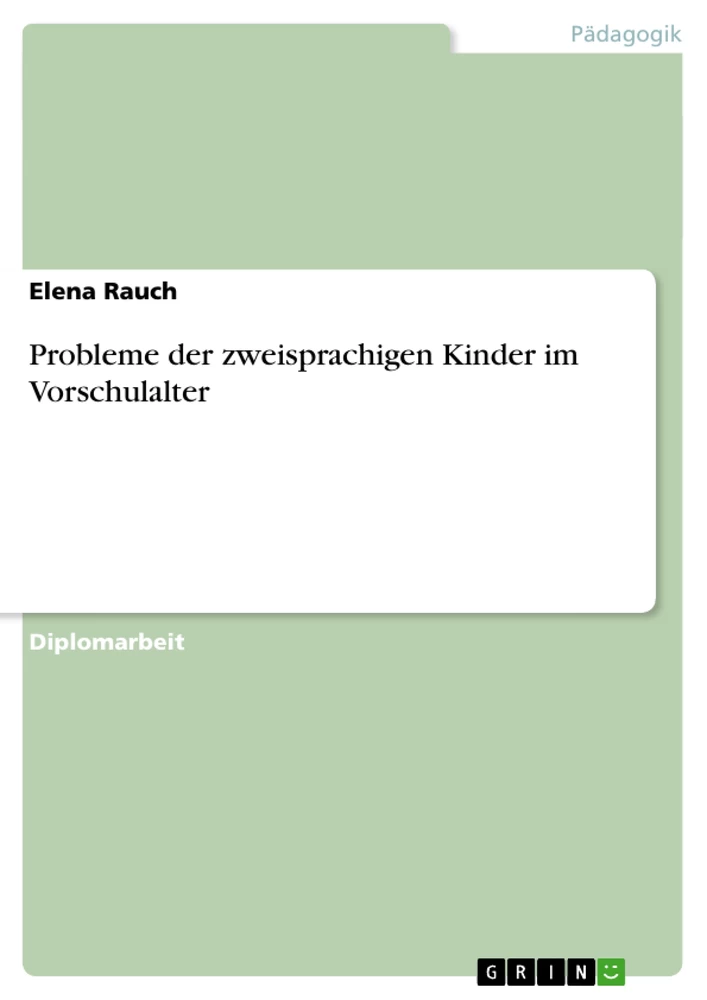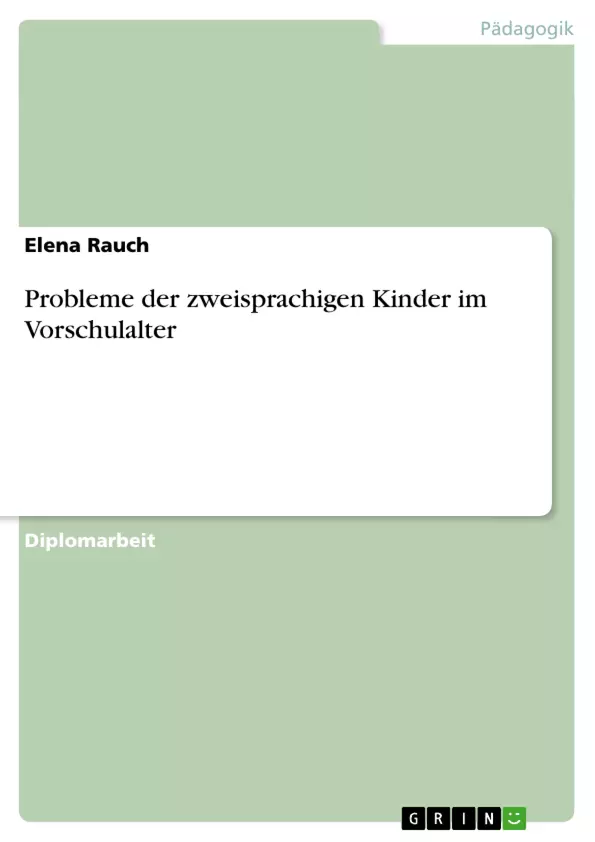Die Zahl der Menschen, deren Muttersprache nicht mit der Sprache des Landes, in dem sie leben, identisch ist, nimmt weltweit regelmäßig zu. Immer mehr Kinder wachsen zwei- oder mehrsprachig auf, weil sie mehr als nur eine Sprache benötigen, um sozial agieren zu können. Die zunehmende weltweite Mobilität ist das Resultat verschiedener Faktoren, wie beispielsweise Reisen, Studien- bzw. Aufenthalten aus beruflichen Gründen im Ausland oder der Zwang, das eigene Land aus politischen, religiösen oder ökonomischen Gründen verlassen zu müssen. Als Konsequenz aus dieser gesteigerten Mobilität ergibt sich für viele Kinder die Möglichkeit des bilingualen Erstspracherwerbs bzw. des natürlichen Zweitspracherwerbs.
Bereits 1967 hat Ruke-Dravina die Tendenz einer zunehmenden Mehrsprachigkeit in der modernen Gesellschaft erkannt und eine pluralistische Haltung gefordert:
„Da die Mehrsprachigkeit sich m. E. in der Zukunft in allen Ländern weiter und weiter verbreiten wird und ein Kennzeichen der zukünftigen Gesellschaft darstellt, geht es nicht an, die Erscheinung abzustreiten oder zu verhindern. Statt dessen wäre es mehr am Platz, den negativen Einfluss des sozialpsychischen Zwanges, wo dieser noch vorkommt und zuweilen ernsthafte psychische Hemmungen und Störungen verursacht, zu mildern oder ganz zu eliminieren.“
(Ruke-Dravina 1967, S.99f)
Der sozial-psychische Zwang ist unter anderem auf die Doktrin des Nationalstaates „une nation, une culture, une langue“, die seit der französischen Revolution in Europa verbreitet ist und auf sprachlicher Ebene die „Einheitssprachenideologie“ (Bartsch 1993, S. 4) hervorgebracht hat, zurückzuführen. Diese äußert sich in der Auffassung, „der Mensch sei im Grunde einsprachig, Zweisprachigkeit sei nur von der gesellschaftlichen Elite zu bewältigen, und die gleich gute Beherrschung zweier Sprachen überfordere das durchschnittliche Kind“ (Stölting 1980, S. 15). Dabei handelt es sich bei dem Phänomen Zweisprachigkeit weder um etwas Geheimnisvolles noch um etwas Exotisches, sondern um einen der möglichen Normalfälle.
Die Wurzeln dieser negativen Einstellungen zur Zweisprachigkeit sind in ideologisch gefärbten Veröffentlichungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu finden. Sie ziehen sich bis heute, oft in versteckter Form durch die pädagogische und psychologische Literatur (vgl. z. B. Wieczerkowski 1965, S. 41), in denen man den Zweisprachigen unter anderem Orientierungslosigkeit und eine gespaltene Persönlichkeit nachsagt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Wie kommt das Kind zur Sprache?
- Stufenförmige Entwicklung der Sprache.
- Merkmale des Spracherwerbs.
- Bedeutung und Funktion der Sprache für Kinder ..
- Kommunikative und egozentrische Funktion der Kindersprache
- Bedeutung der non-verbalen Kindersprache...
- Zweisprachigkeit........
- Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft.
- Historischer Rückblick
- Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität..
- Kulturelle Identität.
- Mehrsprachigkeit heute..
- Zweisprachigkeit in der Wissenschaft.
- Versuch einer operationalen Definition .…....
- Kategorisierung der Zweisprachigkeit.......
- Zweisprachigkeit in der Wissenschaft.
- Entwicklungsstufen bei einem Doppelspracherwerb...
- Entwicklungsstadien beim Zweitspracherwerb
- Kontrastiv- und Identitätshypothese......
- Bedeutung der Erstsprache für die Zweisprachigkeit.......
- Zum Begriff der Muttersprache.
- Erstsprache in den ersten Lebensjahren.
- Erstsprache als Vorteil..
- Probleme der zweisprachigen Kinder
- Zweisprachigkeit als Abweichung..\n.
- Zweisprachigkeit und Intelligenzentwicklung.\n.
- Psychologische Probleme
- Bedeutung der Zweisprachigkeit für den Prozess der kindlichen\nIdentitätsentwicklung..\n
- Stigmatisierung bei Kindern
- Sprachliche Stigmatisierung bei Kindern .\n
- Psychologischer Aspekt des Stotterns\n.
- Sprachlosigkeit im Kindergarten.\n
- Linguistische Probleme.......\n.
- Anzeichen der instabilen zweisprachigen Kompetenz\n.
- Sprachwahl und Kodewechsel bei Kindern .\n.
- Interferenz.\n
- Probleme der richtigen Zuordnung..\n.
- Bildungspolitische Probleme\n
- Doppelte Halbsprachigkeit\n
- Kritik und der bildungspolitische Aspekt..\n.
- Aussichten für die Schulzeit der halbsprachigen Kinder.\n
- Sprachförderung……......\n.
- Konzepte zur Sprachförderung zweisprachiger Kinder im Kindergarten\n.
- Defizittheorie\n
- IFP-Modell...\n
- Fortbildungskurse für Erzieherinnen\n.
- Zusammenfassung.\n
- Sprachentwicklung und -erwerb bei zweisprachigen Kindern
- Soziokulturelle Einflüsse auf die Zweisprachigkeit
- Linguistische und psychologische Herausforderungen für zweisprachige Kinder
- Bildungspolitische Aspekte der Zweisprachigkeit
- Sprachförderungskonzepte für zweisprachige Kinder im Kindergarten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Probleme, die zweisprachige Kinder im Vorschulalter in Deutschland erleben können. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen zu entwickeln, die mit dem Erwerb und der Entwicklung von zwei Sprachen in der frühen Kindheit verbunden sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Zweisprachigkeit im Kontext der zunehmenden globalen Mobilität vor und diskutiert die historischen Wurzeln negativer Einstellungen gegenüber der Zweisprachigkeit. Kapitel 1 beleuchtet den Prozess des Spracherwerbs, der sich durch stufenförmige Entwicklung und spezifische Merkmale auszeichnet. Es werden die Bedeutung und die verschiedenen Funktionen der Sprache im Kindesalter erläutert.
Kapitel 2 befasst sich mit der Zweisprachigkeit aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Perspektive. Es werden die historische Entwicklung der Mehrsprachigkeit, der Zusammenhang von Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität sowie die Bedeutung der kulturellen Identität erörtert. Die Arbeit definiert den Begriff der Zweisprachigkeit, kategorisiert verschiedene Erwerbssituationen und analysiert Theorien zum Zweitspracherwerb. Abschließend wird die Bedeutung der Muttersprache für die bilinguale Sprachentwicklung beleuchtet.
Kapitel 3 untersucht die Situation zweisprachiger Kinder in Deutschland und erörtert die Auswirkungen der Zweisprachigkeit auf die Intelligenzentwicklung. Im Fokus stehen dabei die Probleme, die bei zweisprachigen Kindern auftreten können. Es werden mögliche Störungen der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung im Zusammenhang mit Stigmatisierung aufgrund der Zweisprachigkeit sowie der psychologische Aspekt von Stottern und Sprachlosigkeit im Kindergarten behandelt.
Das Kapitel behandelt auch linguistische Probleme wie instabile zweisprachige Kompetenz, Sprachwahl und Kodewechsel, Interferenz sowie die Schwierigkeiten der richtigen Zuordnung von Wörtern und Begriffen. Des Weiteren werden bildungspolitische Aspekte der Zweisprachigkeit, insbesondere das Konzept der "doppelten Halbsprachigkeit", und die Aussichten für die Schulzeit zweisprachiger Kinder erörtert.
Kapitel 4 präsentiert verschiedene Sprachförderungskonzepte für zweisprachige Kinder im Kindergarten, darunter die Defizittheorie und das IFP-Modell. Es werden auch Fortbildungskurse für Erzieherinnen im Kontext der Sprachförderung behandelt.
Schlüsselwörter
Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Sprachentwicklung, Kinder, Vorschulalter, Probleme, Stigmatisierung, Identitätsentwicklung, Linguistik, Psychologie, Gesellschaft, Bildung, Sprachförderung, Kindergarten.
Häufig gestellte Fragen
Ist Zweisprachigkeit eine Überforderung für Kinder?
Die Wissenschaft zeigt, dass Zweisprachigkeit ein Normalfall ist; negative Vorurteile über Überforderung sind oft ideologisch begründet.
Was versteht man unter "doppelter Halbsprachigkeit"?
Ein umstrittener Begriff für Situationen, in denen ein Kind in keiner der beiden Sprachen eine altersgemäße Kompetenz erreicht, oft aufgrund mangelnder Förderung.
Welche psychologischen Probleme können zweisprachige Kinder haben?
Probleme können durch soziale Stigmatisierung, Orientierungslosigkeit oder Identitätskonflikte entstehen, wenn eine Sprache abgewertet wird.
Was bedeutet "Kodewechsel" (Code-Switching) bei Kindern?
Es ist das fließende Wechseln zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Gesprächs, was oft ein Zeichen für hohe kommunikative Kompetenz ist.
Wie können Kindergärten zweisprachige Kinder fördern?
Durch Konzepte wie das IFP-Modell, Fortbildungen für Erzieherinnen und die Wertschätzung der Erstsprache als Basis für den Zweitspracherwerb.
- Quote paper
- Elena Rauch (Author), 2005, Probleme der zweisprachigen Kinder im Vorschulalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44062