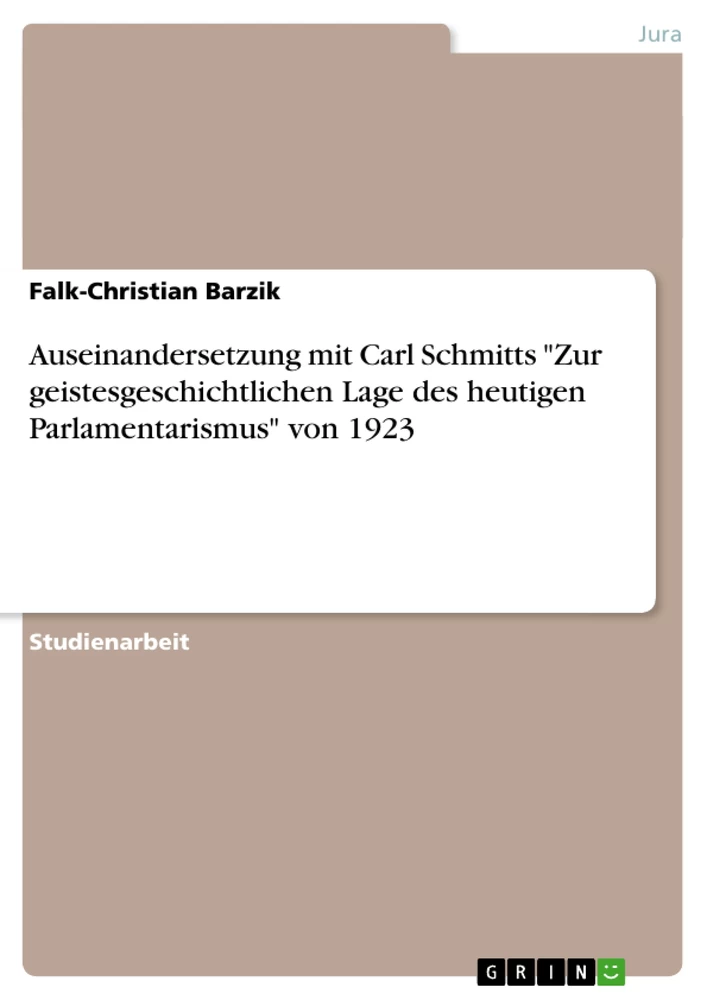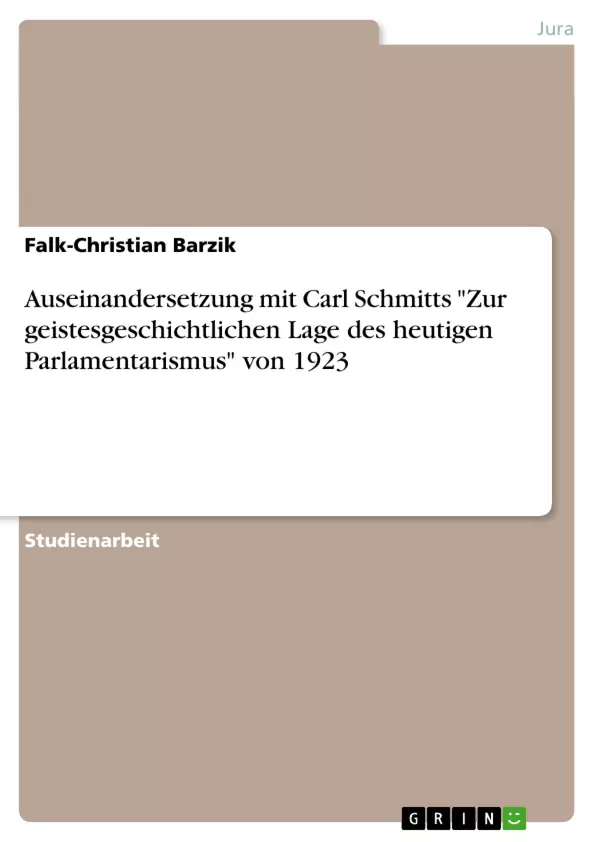In ersten Teil seines Werkes liefert der Autor einen kurzen Überblick über die wichtigsten Staatstheorien, wobei er sich insbesondere mit Rousseaus „Gesellschaftsvertrag“ auseinandersetzt, dessen Verständnis elementar wichtig für die Auseinandersetzung mit Schmitt ist.
Im 2.Teil der Arbeit setzt sich der Autor dann mit dem Hauptwerk des deutschen Staatsrechtlers Carl Schmitt auseinander. Dieser hatte 1923 in seinem Werke „Zur geistesgeschichtlichen Lage des heutigen Parlamentarismus“ versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum es im Laufe des 19.Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu der nicht zwangsläufigen Symbiose von Parlamentarismus und Demokratie gekommen war. Schmitt versuchte die Frage zu beantworten, ob der Parlamentarismus ein ihm eigenes Ideal beinhalten würde, oder ob das Parlament nur der mangelhafte Versuch einer technischen Organisationsform war. Schmitt zeigte auf, dass das Parlament eine Idee des liberalen Geistes des 19.Jahrhundert war, welches glaubte, das ökonomische Gesetz des freien Marktes in die politische Arena transportieren zu können.
Ursprünglich aus dem Glauben entstanden , dass sich die im Volke unterschiedlich verteilten Vernunftpartikel im Parlament sinnvoll zusammenfügen würden, sah sich Schmitt nicht zuletzt durch seine eigenen Erfahrungen mit der Unfähigkeit der Weimarer Demokratie eines besseren belehrt. Nicht das gemeinsame Ringen um die beste Lösung sei Ziel des Parlamentes geworden, sondern vielmehr die Beherrschung der Minderheit. Die hinter dem Gedanken des Parlamentes stehende Idee war pervertiert worden.
Im 3.Teil der Arbeit beschäftigt sich der Autor mit der Rolle Schmitts in der Weimarer Republik. Insbesondere wird ein Blick auf Schmitts Rolle im sogenannten Parteienstaatsstreit geworfen, wo um die verfassungsrechtliche Rolle der Parteien gerungen wurde, die heute durch Art. 21 GG zugunsten der Parteien entschieden worden ist.
Auch werden einige der damals angedachten Gegenentwürfe zum Parteienstaat dargestellt. Der Schwerpunkt fällt dabei auf Oswald Spenglers „Autoritativem Sozialismus“ und Othmar Spanns „Ständestaat“.
Im letzten Teil beschäftigt sich der Autor dann noch mit der Bedeutung Carl Schmitts in der Gegenwart. Carl Schmitts Kritik am Parteienstaat ist, wie die ansteigenden Rezensionen über ihn zeigen, zeitlos.
Inhaltsverzeichnis
- Schmitts Grundthese
- Die Ursprünge der Staats-, Demokratie- und Parlamentarismustheorien
- Staatsabsolutistische Theorie
- Liberalistische Theorie
- Radikaldemokratische Theorie
- Prinzipien des Parlamentarismus
- Auslese des politischen Personals
- Diskussion
- Öffentlichkeit
- Gewaltenteilung
- Die Rolle Schmitts in dem Streit um die Parteienstaatslehre
- Die positivistische Lehre vom Parteienstaat
- Organisation der Gesellschaft, der Staatswillensbildung und der Staatsorgane
- Führerauslese
- Kritik an der Lehre vom Parteienstaat
- Gegenentwürfe zum Parteienstaat
- Ständestaat
- Autoritativer Sozialismus
- Rätesystem
- Die positivistische Lehre vom Parteienstaat
- Schmitts Interpretation des Marxismus - ,,Die Extreme berühren sich”
- Die Bedeutung Schmitts für die Gegenwart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Carl Schmitts Werk „Zur geistesgeschichtlichen Lage des heutigen Parlamentarismus“ befasst sich mit einer kritischen Analyse des parlamentarischen Systems. Schmitt hinterfragt die Grundidee des Parlamentarismus und untersucht dessen historische Entwicklung sowie die verschiedenen Staatstheorien, die die Entstehung des modernen Staates beeinflusst haben.
- Die Kritik am Parlamentarismus als bloße Organisationsform
- Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Staatstheorien (Staatsabsolutismus, Liberalismus, Radikaldemokratie)
- Die Rolle des Parlamentarismus in der Weimarer Republik
- Schmitts Interpretation des Marxismus und die Bedeutung von „extremen“ Positionen
- Die Relevanz von Schmitts Gedanken für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
I. Schmitts Grundthese
In der Einleitung stellt Schmitt seine Grundthese vor, dass das parlamentarische System keine intrinsische Idee oder ein Ideal verkörpert, sondern lediglich eine „sozial-technische“ Organisationsform ist. Er kritisiert die Tendenz, das Parlament als das „kleinste aller Übel“ zu betrachten und fordert eine tiefergehende Auseinandersetzung mit seiner Legitimität.
II. Die Ursprünge der Staats-, Demokratie- und Parlamentarismustheorien
Schmitt beleuchtet die Entstehung der Demokratie im 19. Jahrhundert und argumentiert, dass sie ursprünglich als Gegenentwurf zur Monarchie entstand. Er zeigt, wie die Demokratie verschiedene politische Strömungen und Ideologien integriert hat, ohne jedoch einen eigenen inhaltlichen Kern zu besitzen. Er argumentiert, dass die Demokratie als reine Organisationsform ohne eigene politische Inhalte verstanden werden muss.
III. Prinzipien des Parlamentarismus
In diesem Kapitel werden die zentralen Prinzipien des Parlamentarismus, wie die Auswahl des politischen Personals, die Diskussion, die Öffentlichkeit und die Gewaltenteilung, analysiert.
IV. Die Rolle Schmitts in dem Streit um die Parteienstaatslehre
Schmitt diskutiert die „positivistische Lehre vom Parteienstaat“ und deren Kritik. Er stellt alternative Staatsmodelle wie den Ständestaat, den autoritären Sozialismus und das Rätesystem vor.
V. Schmitts Interpretation des Marxismus - ,,Die Extreme berühren sich”
In diesem Kapitel setzt sich Schmitt mit der Marxismus auseinander und untersucht die Beziehung zwischen „extremen“ Positionen.
Schlüsselwörter
Parlamentarismus, Staats- und Demokratietheorien, Staatsabsolutismus, Liberalismus, Radikaldemokratie, Parteienstaat, Marxismus, Ideologie, Organisationsform, Politik, Macht, Legitimität, Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Carl Schmitts Hauptkritik am Parlamentarismus?
Schmitt argumentierte, dass der Parlamentarismus seine ideelle Basis (Diskussion und Öffentlichkeit) verloren habe und nur noch eine mangelhafte technische Organisationsform zur Beherrschung von Minderheiten sei.
Wie sah Schmitt das Verhältnis von Demokratie und Parlamentarismus?
Er sah keine zwangsläufige Symbiose und glaubte, dass Demokratie auch ohne Parlament (z.B. durch Akklamation oder Diktatur) existieren könne, da sie im Kern auf Identität von Herrschern und Beherrschten beruhe.
Was ist der "Parteienstaatsstreit" in der Weimarer Republik?
Es war eine verfassungsrechtliche Debatte über die Rolle politischer Parteien, die Schmitt als Zerstörer der staatlichen Einheit betrachtete, während andere sie als notwendige Staatsorgane verteidigten.
Welche Gegenentwürfe zum Parteienstaat werden genannt?
Genannt werden Oswald Spenglers "Autoritativer Sozialismus", Othmar Spanns "Ständestaat" und das Rätesystem.
Warum ist Carl Schmitt heute noch relevant?
Seine Kritik an der Schwäche liberaler Institutionen und seine Analysen zu Macht und Legitimität werden in der modernen politischen Theorie weiterhin intensiv diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Dpilom-Finanzwirt Falk-Christian Barzik (Autor:in), 2005, Auseinandersetzung mit Carl Schmitts "Zur geistesgeschichtlichen Lage des heutigen Parlamentarismus" von 1923, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44072