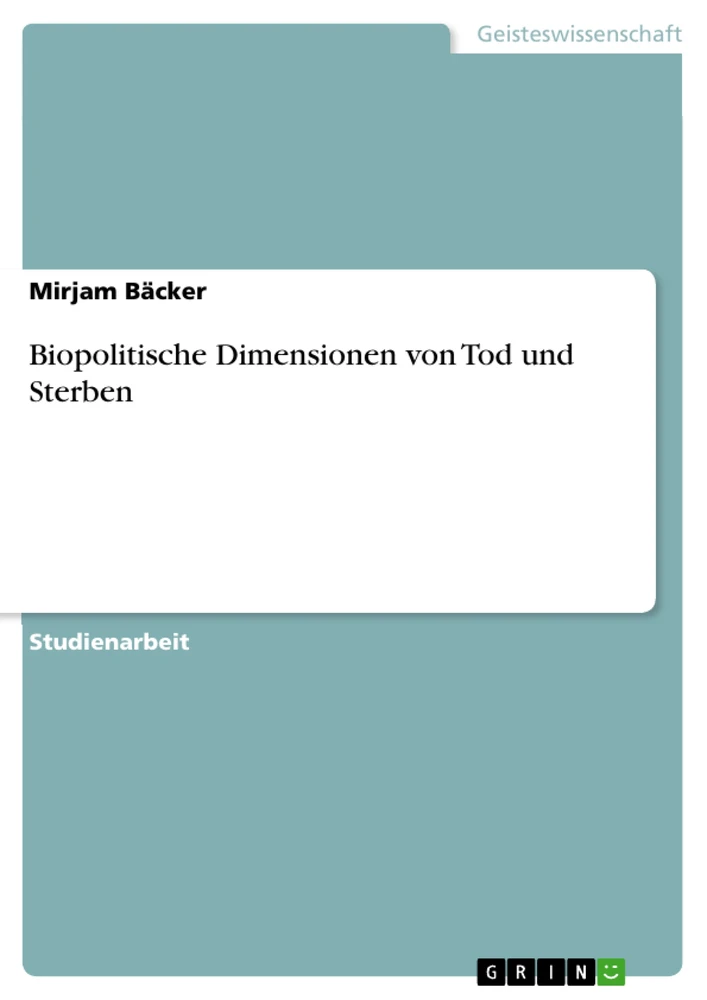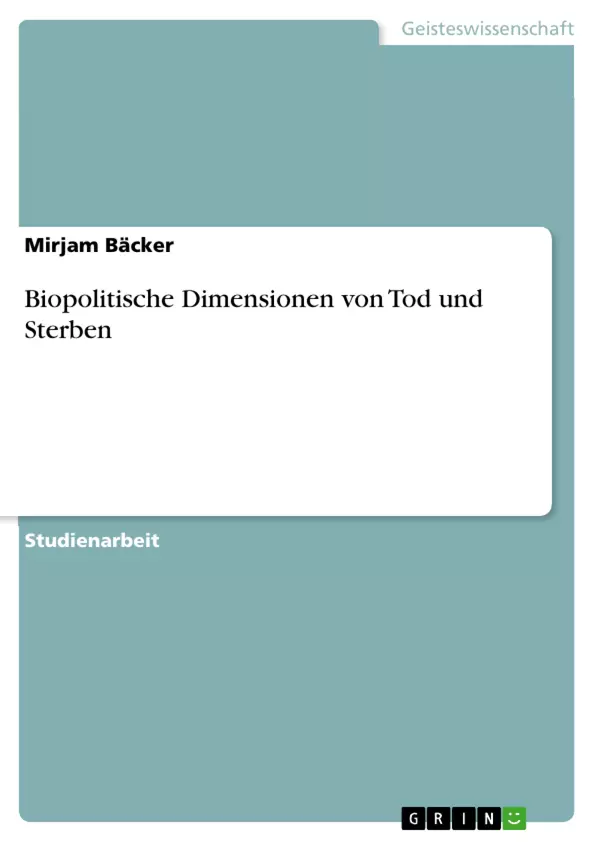Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit den biopolitischen Dimensionen von Tod und Sterben auseinander. Die Begrifflichkeiten von Biopolitik und Biomacht gehen dabei auf Michel Foucault zurück und bezeichnen Machttechniken, die sich auf die Regulierung der Bevölkerung hinsichtlich Fortpflanzung, Gesundheitszustand und Sterblichkeit konzentrieren.
Einleitend stelle ich Michel Foucaults Theorie einer Transformation von Machtstrukturen „Recht über den Tod und Macht zum Leben“ vor, welche als theoretische Grundlage zum Verständnis des Aufkommens von Biomacht fungiert. Diesem folgt eine kurze Darstellung Giorgio Agambens „Theorie des nackten Lebens“, in welcher Agamben Foucaults Begrifflichkeiten der Biomacht aufgreift und sie um den Begriff des „bloßen Lebens“ erweitert. Agambens Theorie eröffnet neben Foucault eine alternative Betrachtungsweise auf die Funktionsmechanismen von Biopolitik. Während Michel Foucault Biomacht als einen dauerhaft existenten Kontrollmechanismus etabliert, koppelt Agamben Biomacht an den politischen Ausnahmezustand.
Der Hauptteil skizziert die Veränderungen, die Tod und Sterbeprozesse seit dem Aufkommen einer Biomacht erfahren haben. Dies schließt eine immer extremer ausschlagende Ambivalenz der Sichtbarkeit des Todes in unserem Alltag ein. Tägliche Todesnachrichten und –zahlen einerseits – unbedingtes Verbergen von Sterbeverläufen im Alltag andererseits.
Betrachtet wird die Wandlung des Sterbens hin zu einem Tod, der im Hinblick auf die aktuelle demografische Entwicklung und die weltpolitischen Geschehnisse durchaus als ein biopolitischer Regulationsmechanismus angesehen werden kann. An dieser Stelle wird ein Abschnitt die Parallelen zur Sexualitätsdebatte der 1960er-Jahre erläutern, um herauszustellen, wie der Diskurs „Tod“ den Diskurs „Sex“ in der Geschichte auf politischer Ebene abgelöst hat.
Anschließend beleuchte ich beispielhaft drei Mechanismen zur Regulierung von Sterbeprozessen: die Palliativversorgung Sterbender, Sterbehilfepolitik und die Todesstrafe und synchronisiere diese mit Biopolitik als Bevölkerungsregulierungspolitik.
Nach Betrachtung der verschiedenen Diskurse und deren Symbiose skizziert das Resümee abschließend anhand der Forschungsergebnisse die politische Bedeutung des Todes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Transformation von Machtformen - Aufkommen von Biomacht
- Michel Foucault - Recht über den Tod und Macht zum Leben
- Giorgio Agamben – Bare Life Theory
- Die neue Sichtbarkeit des Todes
- Ambivalenz der Sichtbarkeit des Todes
- Wandlung des Sterbens
- Der Tod als politischer Regulationsmechanismus
- Parallelen zu der Sexualitätsdebatte
- Palliativversorgung Sterbender
- Sterbehilfe
- Todesstrafe
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die biopolitischen Dimensionen von Tod und Sterben im Kontext der Theorien von Michel Foucault und Giorgio Agamben. Sie befasst sich mit der Transformation von Machtstrukturen und dem Aufkommen von Biomacht, die auf die Regulierung der Bevölkerung in Bezug auf Fortpflanzung, Gesundheit und Sterblichkeit zielt.
- Die Transformation von Machtstrukturen im Kontext von „Recht über den Tod und Macht zum Leben“ nach Michel Foucault.
- Giorgio Agambens „Theorie des nackten Lebens“ und die Erweiterung der Biomachtkonzepte.
- Die Veränderungen in der Sichtbarkeit von Tod und Sterbeprozessen in der modernen Gesellschaft.
- Der Tod als politischer Regulationsmechanismus im Kontext von Palliativversorgung, Sterbehilfe und Todesstrafe.
- Die politische Bedeutung des Todes im Kontext der Biopolitik.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der biopolitischen Dimensionen von Tod und Sterben ein und stellt die theoretischen Grundlagen von Foucault und Agamben vor. Kapitel 2 beleuchtet die Transformation von Machtstrukturen im Kontext der Biomacht und analysiert Foucaults Theorie von „Recht über den Tod und Macht zum Leben“ sowie Agambens Erweiterung der Biomachtkonzepte. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der neuen Sichtbarkeit des Todes in der modernen Gesellschaft und untersucht die Ambivalenz und Wandlung des Sterbeprozesses. Kapitel 4 untersucht den Tod als politischen Regulationsmechanismus und beleuchtet die Parallelen zur Sexualitätsdebatte, die Palliativversorgung Sterbender, die Sterbehilfepolitik und die Todesstrafe.
Schlüsselwörter
Biopolitik, Biomacht, Michel Foucault, Giorgio Agamben, Bare Life, Tod, Sterben, Sichtbarkeit, Regulationsmechanismus, Palliativversorgung, Sterbehilfe, Todesstrafe.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeuten Biopolitik und Biomacht bei Michel Foucault?
Diese Begriffe bezeichnen Machttechniken, die auf die Regulierung der Bevölkerung hinsichtlich Gesundheit, Fortpflanzung und Sterblichkeit abzielen ("Macht zum Leben").
Wie unterscheidet sich Giorgio Agambens Theorie von Foucault?
Während Foucault Biomacht als dauerhaften Kontrollmechanismus sieht, verknüpft Agamben sie mit dem politischen Ausnahmezustand und dem Konzept des "nackten Lebens".
Inwiefern ist der Tod ein politischer Regulationsmechanismus?
Durch Bereiche wie Sterbehilfe, Palliativversorgung und die Todesstrafe wird der Sterbeprozess staatlich reguliert und politisch instrumentalisiert.
Was ist mit der "Ambivalenz der Sichtbarkeit des Todes" gemeint?
Es beschreibt den Gegensatz zwischen der ständigen medialen Präsenz von Todeszahlen und dem gleichzeitigen Verbergen des realen Sterbens im privaten Alltag.
Gibt es Parallelen zwischen dem Diskurs über Tod und Sexualität?
Ja, die Arbeit erläutert, wie der Diskurs über den Tod auf politischer Ebene den Sexualitätsdiskurs der 1960er-Jahre als zentrales Feld der Biopolitik abgelöst hat.
- Quote paper
- Mirjam Bäcker (Author), 2017, Biopolitische Dimensionen von Tod und Sterben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441059