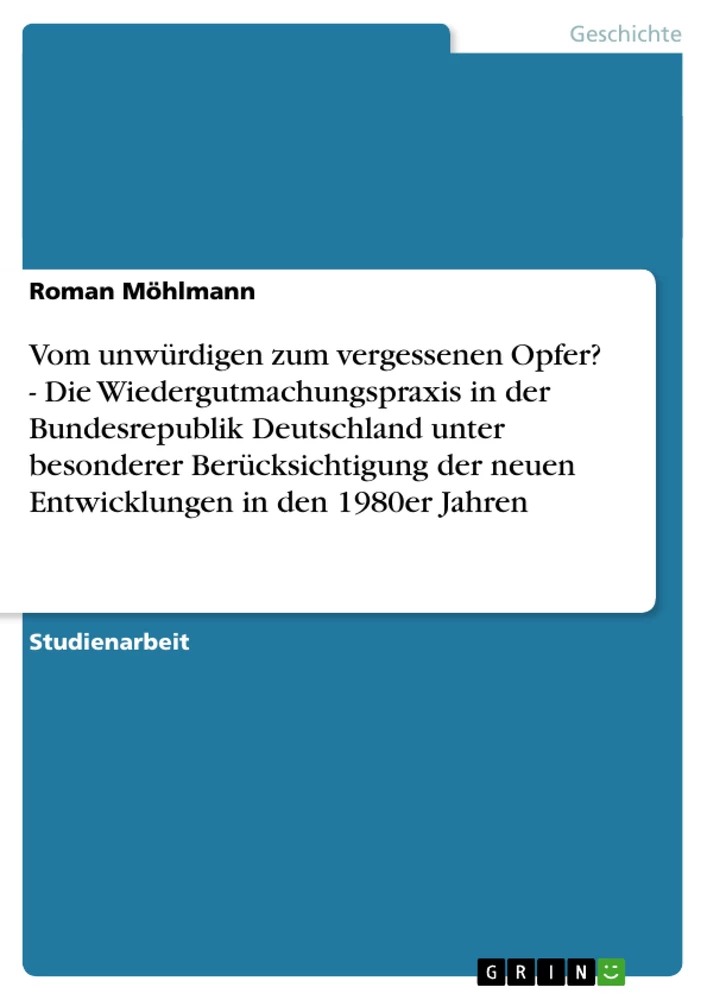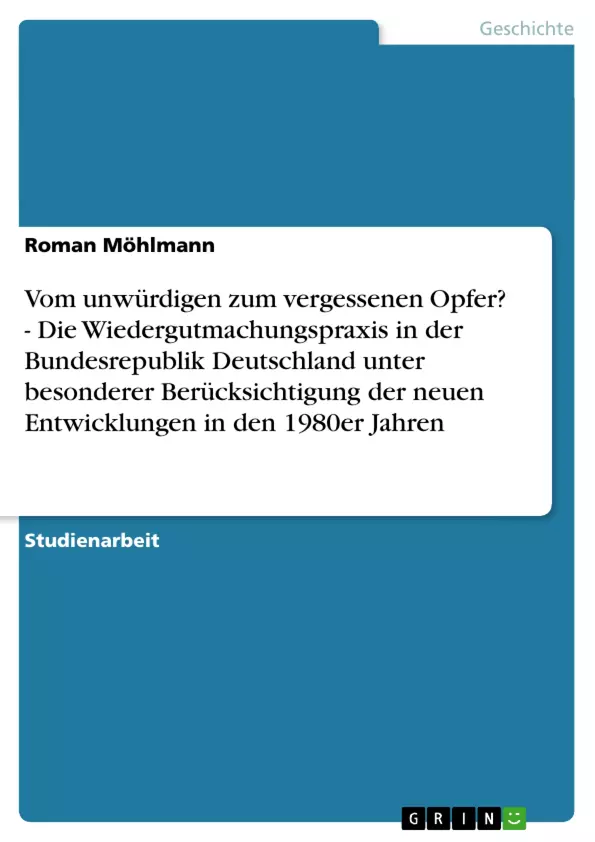Die Geschichte der „Wiedergutmachung“ in Deutschland ist facettenreich und komplex. Eingeleitet nach 1945 vornehmlich durch die US-amerikanische Besatzungsmacht, wurden entschädigungsintendierte Programme aufgenommen, sprich: Maßnahmen zur „Wiedergutmachung“ der durch den gefallenen NS-Staat verübten Verbrechen, auch wichtiger Bestandteil der Politik der Regierungen der neuen Bundesrepublik. Grundlegende und umfassende Untersuchungen zu den Anfängen und zur Entwicklung der Wiedergutmachung liegen bereits vor. Dass die Form der Wiedergutmachung sich über lange Zeit fast ausschließlich auf die jüdischen Opfer der NS-Verfolgung konzentrierte, wurde in der Forschung bereits mehrfach angemerkt. In diesen Kontext gehört die These, man habe zwischen entschädigungswürdigen und entschädigungsunwürdigen Opfern unterschieden, die aus den Entschädigungsprogrammen ausgespart wurden. Nach einer gewissen Abgeschlossenheitsmentalität im Hinblick auf die Frage der Wiedergutmachung Mitte der 60er Jahre dauerte es, abgesehen von einigen behelfsartigen Initiativen der sozialliberalen Ära im Zuge der neuen Ostpolitik, fast 15 Jahre, bis der Wiedergutmachungs- und Entschädigungsdiskurs um neue Aspekte und Perspektiven ergänzt wurde. Der Übergang von den 70ern in die 80er Jahre brachte einhergehend mit einem gesellschaftlichen Wertewandel brachte die sogenannten vergessenen Opfer zurück in eine aktualisierte Wiedergutmachungsdebatte und eröffnete den entsprechenden Gruppen neue Möglichkeiten der breiteren Artikulation.
Die vorliegende Arbeit möchte nach einem kurzen Einblick in die Wiedergutmachungspolitik der Nachkriegszeit zuerst in groben Zügen die Entwicklung der Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsschlussgesetz von 1965 skizzieren. Dabei soll auch die Begrifflichkeit der „unwürdigen Opfer“ besprochen werden. Im Anschluss soll untersucht werden, wie in der Mentalität der westdeutschen Gesellschaft aus den „unwürdigen“ die „vergessenen“ Opfer werden konnten und wie bzw. warum gerade in den 80er Jahren die Auseinadersetzung mit der Frage der „vergessenen Opfer“ wieder zu einem bedeutenden Thema wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wiedergutmachung bis zum „Schlussgesetz“
- Zum Begriff der „Wiedergutmachung“
- Die Wiedergutmachung bis 1965 und der Begriff der „unwürdigen Opfer“
- Wiedergutmachung nach 1965
- ,,Abschlussmentalität“
- Der Umgang mit der Wiedergutmachung in der sozialliberalen Ostpolitik
- Die 80er Jahre und die Debatte um die „vergessenen Opfer“
- Der Begriff der „vergessenen Opfer“
- Die Re-Thematisierung der „vergessenen Opfer“ in den 1980er Jahren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der Wiedergutmachungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 mit besonderem Fokus auf die 1980er Jahre. Ziel ist es, die Transformation der Wiedergutmachung vom Konzept der „unwürdigen Opfer“ hin zu den „vergessenen Opfern“ zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die politischen, sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen, die diese Entwicklung beeinflusst haben.
- Die Entwicklung des Wiedergutmachungsbegriffs und dessen Bedeutung für die Politik der Bundesrepublik
- Die Diskurse um „unwürdige Opfer“ und die Gründe für deren Ausschluss aus den Entschädigungsprogrammen
- Die „Abschlussmentalität“ der 1960er Jahre und der Einfluss der sozialliberalen Ostpolitik auf die Wiedergutmachungsdebatte
- Die Re-Thematisierung der „vergessenen Opfer“ in den 1980er Jahren und deren gesellschaftliche und politische Bedeutung
- Die Rolle der verschiedenen Opfergruppen in der Wiedergutmachungsdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen kurzen Einblick in die Geschichte der Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Wiedergutmachungspolitik bis zum „Schlussgesetz“ von 1965. Es werden die Begrifflichkeiten der „Wiedergutmachung“ und der „unwürdigen Opfer“ diskutiert.
Kapitel drei analysiert die Weiterentwicklung der Wiedergutmachungspolitik nach 1965. Es werden die „Abschlussmentalität“ der 1960er Jahre und der Einfluss der sozialliberalen Ostpolitik auf die Wiedergutmachungsdebatte untersucht.
Das vierte Kapitel behandelt die Debatte um die „vergessenen Opfer“ in den 1980er Jahren. Es wird der Begriff der „vergessenen Opfer“ erklärt und die Re-Thematisierung dieser Opfergruppe in den 1980er Jahren beleuchtet.
Schlüsselwörter
Wiedergutmachung, Entschädigung, Opfer, Nationalsozialismus, Bundesrepublik Deutschland, „unwürdige Opfer“, „vergessene Opfer“, 1980er Jahre, gesellschaftlicher Wandel, Ostpolitik, Geschichtspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Wiedergutmachung“ im Kontext der BRD?
Es bezeichnet die Entschädigungsprogramme für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, die nach 1945 initiiert wurden.
Wer waren die sogenannten „unwürdigen Opfer“?
Gruppen wie Sinti und Roma, Homosexuelle oder als „asozial“ Verfolgte, die lange Zeit von Entschädigungsleistungen ausgeschlossen blieben.
Warum änderte sich die Debatte in den 1980er Jahren?
Ein gesellschaftlicher Wertewandel und neue historische Forschungen brachten die „vergessenen Opfer“ zurück in das öffentliche Bewusstsein.
Was war das Bundesentschädigungsschlussgesetz von 1965?
Ein Gesetz, das die Phase der Wiedergutmachung formal abschließen sollte, was zu einer „Abschlussmentalität“ in Politik und Gesellschaft führte.
Welchen Einfluss hatte die Ostpolitik auf die Wiedergutmachung?
Die sozialliberale Ostpolitik eröffnete neue Wege für Entschädigungen gegenüber Opfern in osteuropäischen Staaten.
- Citation du texte
- Roman Möhlmann (Auteur), 2004, Vom unwürdigen zum vergessenen Opfer? - Die Wiedergutmachungspraxis in der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der neuen Entwicklungen in den 1980er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44119