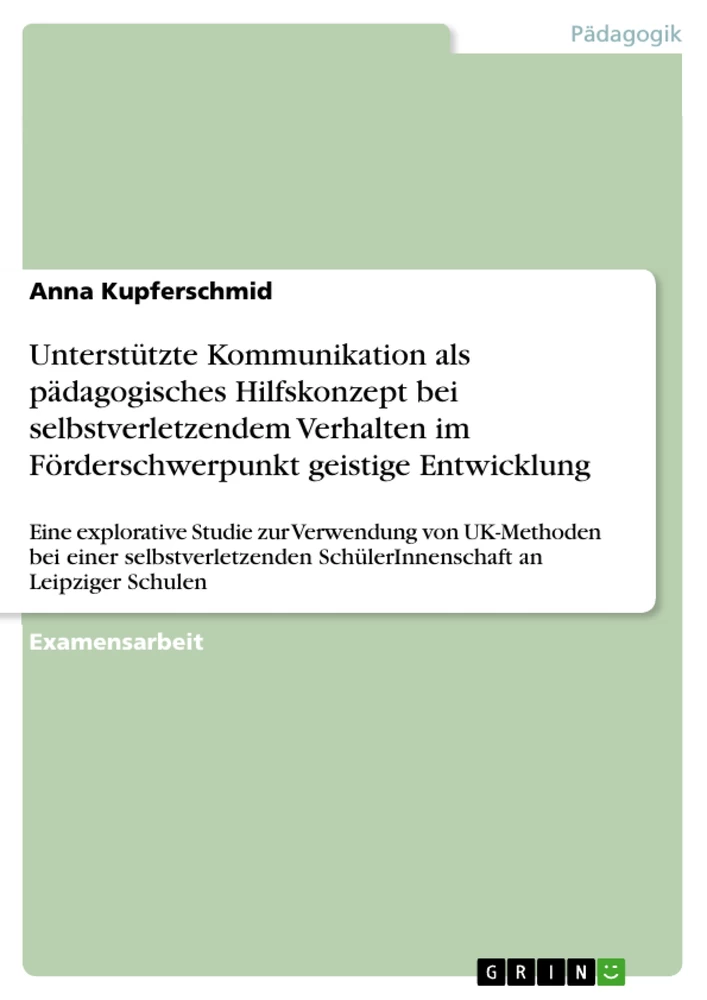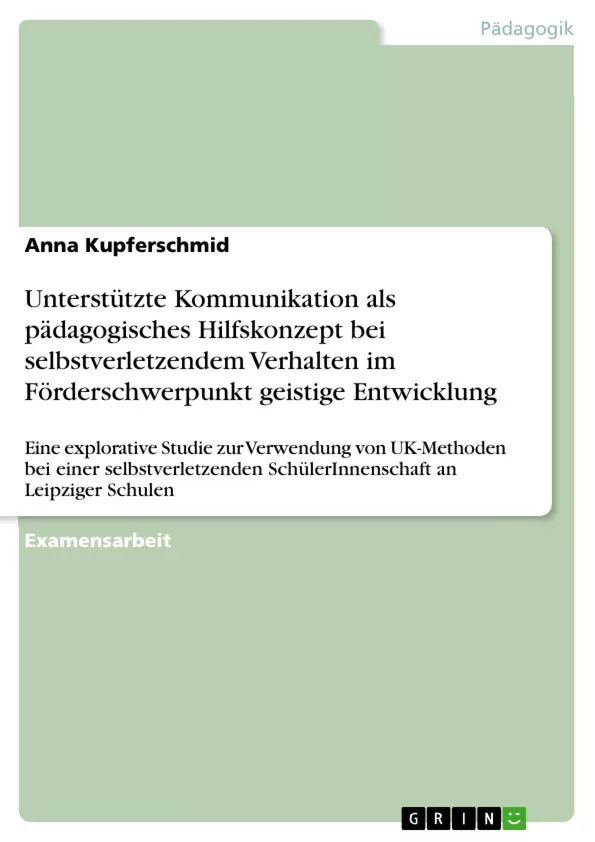Kommunikation ist für die menschliche Existenz essentiell. Über sie teilt sich der Mensch mit, kann Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche verdeutlichen. Menschen mit einer sogenannten zugeschrieben geistigen Behinderung jedoch, bilden häufig keine expressive Lautsprache aus. Die kognitive Entwicklung, Motivation, Selbstvertrauen sowie das eindeutige Kommunizieren von Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen ist für diesen Personenkreis stark eingeschränkt. Diverse Untersuchungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass diese Einschränkung zu einer Begünstigung von selbstverletzenden Verhaltensweisen führen kann. Nicht selten verwenden nicht-lautsprachlich-kommunizierende Menschen Selbstverletzungen als Reaktion auf kommunikative Einschränkungen. Hier übernimmt die Förderpädagogik die Aufgabe bei nicht-lautsprachlich kommunizierenden SchülerInnen, durch systematische Interventionen und adaptive Unterrichtsgestaltung selbstverletzenden Verhaltensweisen entgegenzuwirken.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit trafen drei Lehrkräfte an zwei verschiedenen Leipziger Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Aussagen zu der Verwendung von Methoden der Unterstützten Kommunikation (UK) als pädagogisches Hilfskonzept bei selbstverletzenden Verhaltensweisen. Die Ergebnisse zeigen ein sehr heterogenes Bild. Während die Schilderungen der befragten Lehrkräfte, UK als pädagogische Methode im Unterricht durch den Einsatz von unterstützenden Gebärden, Symbolen und elektronischen UK-Mitteln und teilweise auch in Pausensituationen erkennen ließen, verwendeten nur zwei der drei Befragten die Mittel konkret als pädagogisches Hilfskonzept, um selbstverletzenden Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Durch die Auswertung der Interviews konnten diese Differenzen insbesondere auf personale Grenzen zurückgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Begrifflichkeiten und theoretischer Hintergrund
- 2.1 Bestimmung des Personenkreises
- 2.2 Herausforderndes Verhalten
- 2.3 Selbstverletzendes Verhalten
- 2.3.1 Ätiologie
- 2.4 Kommunikation
- 2.4.1 Kommunikation bei Menschen mit sogenannter zugeschriebener geistiger Behinderung
- 2.5 Pädagogische Hilfskonzepte bei selbstverletzenden Verhaltensweisen
- 2.5.1 Funktionales Kommunikationstraining
- 2.5.2 Unterstützte Kommunikation
- 2.5.2.1 Zielgruppe und Zielstellungen
- 2.5.2.2 Methoden und Ansätze
- 3. Explorative Studie
- 3.1 Vorüberlegungen
- 3.2 Fragestellung
- 3.3 Aktueller Forschungsstand und Quellenlage
- 3.4 Erhebungsinstrument
- 3.4.1 Forschungsethische Aspekte
- 3.5 Durchführung der Datenerhebung
- 3.5.1 Datenaufbereitung
- 3.6 Ergebnisdarstellung
- 3.6.1 Angaben zur Stichprobe
- 3.6.2 Darstellung und Ausführung der Ergebnisse
- 4. Konklusion und Ausblick
- 4.1 Inhaltliche Diskussion und Fazit
- 4.2 Methodische Diskussion und Fazit
- 4.3 Forschungsdesiderate
- Verzeichnis der Tabellen
- 5. Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Verwendung von Unterstützter Kommunikation (UK) als pädagogisches Hilfskonzept bei selbstverletzendem Verhalten von SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Sie zielt darauf ab, die Erfahrungen von Lehrkräften im Einsatz von UK-Methoden in diesem Kontext zu untersuchen und ein besseres Verständnis für die Anwendungsmöglichkeiten und Herausforderungen zu entwickeln. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit folgenden Themen:
- Kommunikationsdefizite bei Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung
- Selbstverletzendes Verhalten als Reaktion auf kommunikative Einschränkungen
- Die Rolle von pädagogischen Hilfskonzepten im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten
- Die Bedeutung von UK als Instrument zur Verbesserung der Kommunikation und zur Reduktion von selbstverletzendem Verhalten
- Die Anwendung von UK-Methoden in schulischen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, die den theoretischen und empirischen Hintergrund der Forschungsfrage beleuchten.
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Hintergrund der Forschungsfrage.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel präsentiert die relevanten Begrifflichkeiten und den theoretischen Hintergrund. Es definiert den Personenkreis mit zugeschriebener geistiger Behinderung, erläutert das Phänomen des herausfordernden Verhaltens und untersucht das selbstverletzende Verhalten im Detail.
- Kapitel 3: Das Kernstück der Arbeit bildet die explorative Studie. Hier werden die Vorüberlegungen zur Forschungsfrage, die Fragestellung, der aktuelle Forschungsstand und die methodischen Aspekte der Studie dargelegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Menschen mit sogenannter zugeschriebener geistiger Behinderung, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, herausforderndes Verhalten, selbstverletzendes Verhalten, Kommunikation, Unterstützte Kommunikation, Pädagogische Hilfskonzepte, Empowerment.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Unterstützte Kommunikation (UK)?
UK umfasst Methoden wie Gebärden, Symbole oder elektronische Hilfsmittel, um Menschen ohne ausreichende Lautsprache eine Verständigung zu ermöglichen.
Wie hängen Kommunikationsdefizite und selbstverletzendes Verhalten zusammen?
Menschen mit geistiger Behinderung nutzen Selbstverletzungen oft als Reaktion auf die Unfähigkeit, Wünsche oder Schmerzen verbal mitzuteilen.
Welches Ziel verfolgt die explorative Studie in Leipzig?
Sie untersucht, inwieweit Lehrkräfte an Förderschulen UK-Methoden gezielt einsetzen, um herausforderndem und selbstverletzendem Verhalten entgegenzuwirken.
Was ist ein „Funktionales Kommunikationstraining“?
Es ist eine pädagogische Intervention, bei der das Problemverhalten durch eine angemessene kommunikative Form (z. B. Zeigen auf ein Symbol) ersetzt wird.
Welche Barrieren gibt es beim Einsatz von UK-Mitteln?
Die Studie zeigt, dass oft „personale Grenzen“ der Lehrkräfte oder mangelnde systematische Umsetzung verhindern, dass UK als echtes Hilfskonzept genutzt wird.
Warum ist Kommunikation für die menschliche Existenz essenziell?
Über Kommunikation werden Gefühle, Bedürfnisse und soziale Teilhabe erst ermöglicht; ihr Fehlen führt oft zu Frustration und Isolation.
- Quote paper
- Anna Kupferschmid (Author), 2018, Unterstützte Kommunikation als pädagogisches Hilfskonzept bei selbstverletzendem Verhalten im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441242