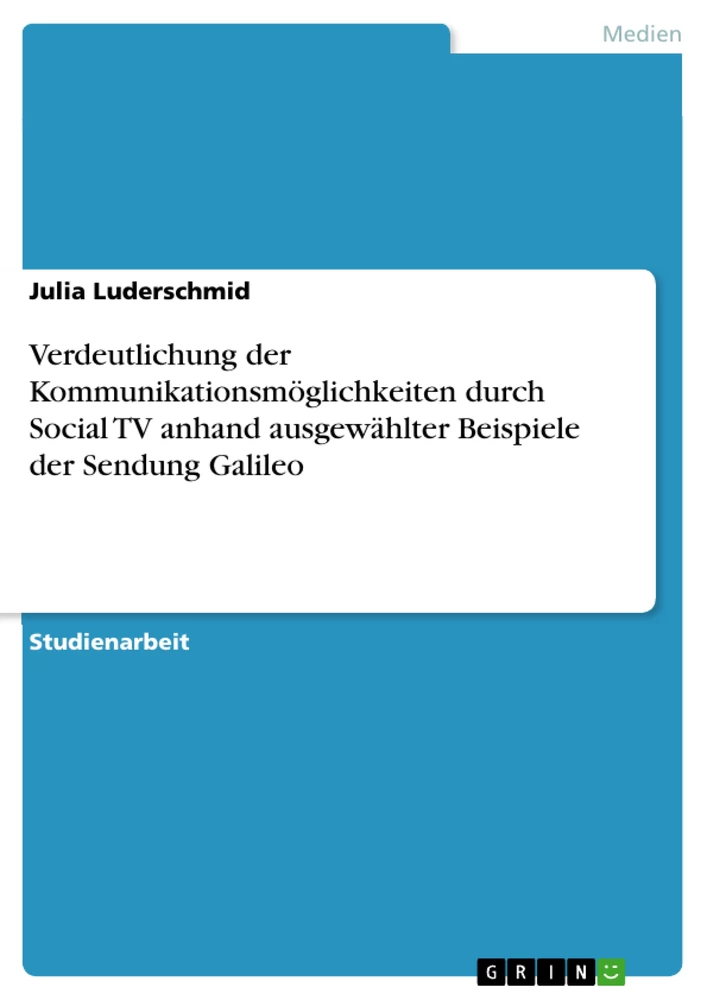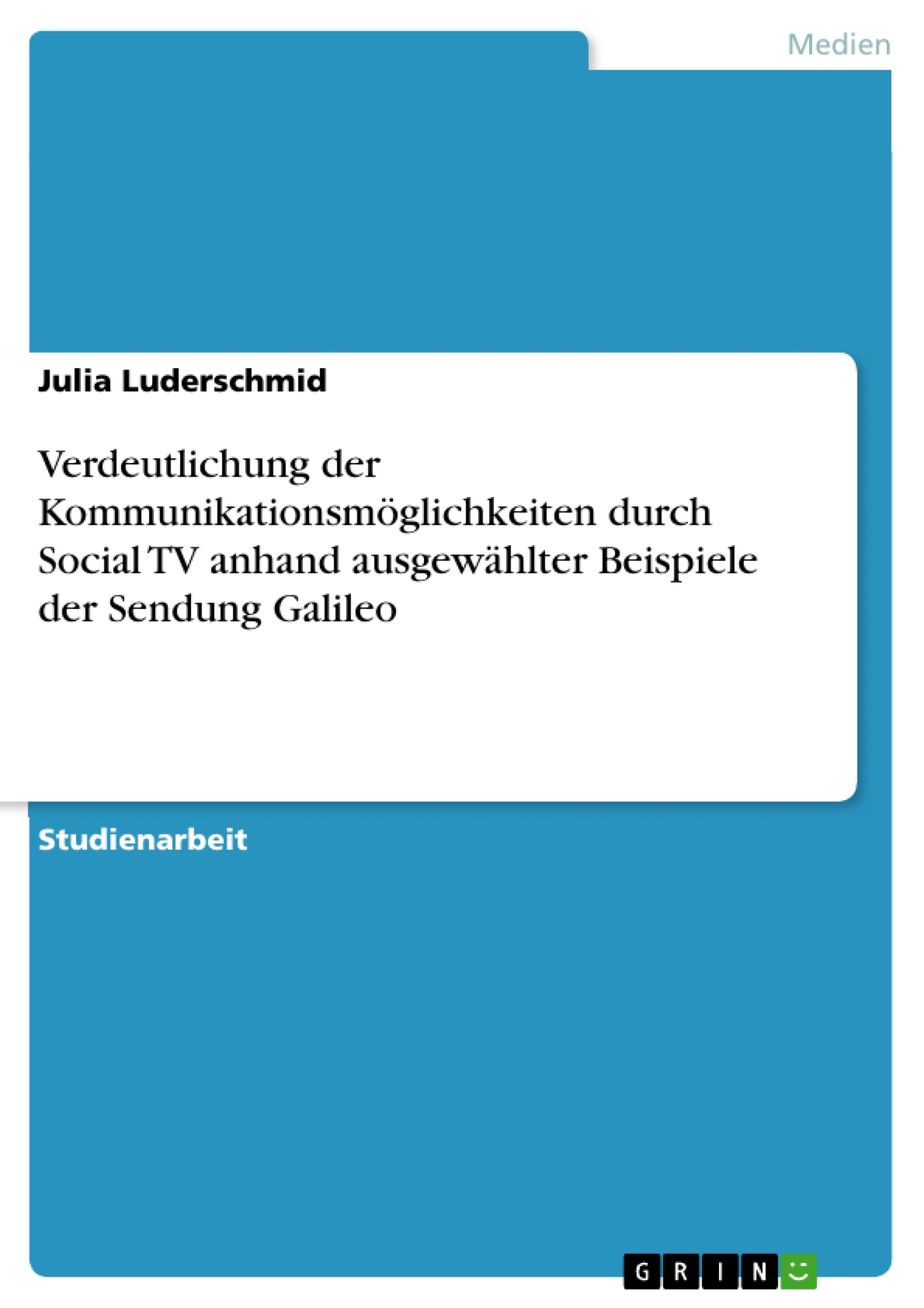Fernsehen am Laptop, Telefonieren übers Tablet oder Surfen übers Smartphone – all diese Formen der Mediennutzung sind besonders für die junge Generation zur Normalität geworden. Es ist selbstverständlich eine verpasste Sendung online nachzuschauen oder sich parallel Zusatzinformationen übers Web zu holen. Die permanente Verfügbarkeit des Internets auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop verändern unser Fernseherlebnis immens. Nur durch die parallele Mediennutzung zu anderen Tätigkeiten ist es möglich, sich im Schnitt täglich 580 Minuten mit Medien zu beschäftigen und gleichzeitig ausreichend Zeit für andere Aktivitäten zu haben. Laut einer Studie der SevenOne Media nutzten 2017 in Deutschland 65 Prozent der 14- bis 69-jährigen Internet und TV gleichzeitig. Das ist ein Anstieg von 16 Prozent innerhalb von drei Jahren. Fernsehen ist interaktiv geworden, der Bildschirm wird zum sozialen Erlebnis: Social TV lautet hier das Stichwort. Aus den isolierten Einzelmedien Fernsehen und Internet entstehen geräteübergreifend neue Nutzungsformen und Funktionalitäten. Diese Medienkonvergenz eröffnet dem klassischen Fernsehen neue Möglichkeiten der Interaktion und lässt den bisher passiven Zuschauer zum aktiven Social TV-Nutzer werden. Nicht nur die Kommunikation unter den Zuschauern, auch die zwischen Programmanbietern und Empfängern gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das klassische Sender-Empfänger-Modell von Claude E. Shannon und Warren Weaver wird durch diesen neu entstandenen Rückkanal aufgelöst, wodurch das Leitmedium Fernsehen eine neue Art der Transformierung erfährt. Durch kreative Ideen binden ihn die Sender live in ihr Programm ein und bieten ihm vor, während oder nach der Sendung ein völlig neues Fernseherlebnis.
Social TV ist als Teil des interaktiven Fernsehens Gegenstand dieser Arbeit. Es beschreibt die Verschmelzung von klassischem TV mit den digitalen sozialen Medien. Doch was genau steckt hinter diesem Phänomen? Welche Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen sich und wie können sie umgesetzt werden? Die folgenden Ausführungen widmen sich diesen Fragen und bestärken die genannten theoretischen Ansätze durch adäquate Beispiele der Sendung Galileo.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinition – Was ist Social TV?
- 3 Kommunikationsmöglichkeiten durch Social TV
- 3.1 Vorabkommunikation
- 3.2 Parallelkommunikation
- 3.3 Anschlusskommunikation
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Social TV anhand der Sendung Galileo. Ziel ist es, die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten von Social TV zu beleuchten und deren Umsetzung anhand konkreter Beispiele zu verdeutlichen. Dabei wird die Verschmelzung von klassischem Fernsehen und digitalen sozialen Medien analysiert.
- Definition und Abgrenzung von Social TV
- Kommunikationsformen im Social TV (Vorab-, Parallel-, Anschlusskommunikation)
- Beispiele für Social TV-Strategien von Galileo
- Interaktive Elemente und Zuschauerpartizipation
- Social TV 2.0 und 3.0 im Kontext von Galileo
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik von Social TV ein und beschreibt den Wandel des Fernseherlebnisses durch die zunehmende Medienkonvergenz und die parallele Mediennutzung. Sie hebt die Bedeutung der Interaktion zwischen Zuschauern und Sendern hervor und stellt die Fragestellung der Arbeit vor: Was ist Social TV, und welche Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet es?
2 Begriffsdefinition – Was ist Social TV?: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs Social TV. Es werden verschiedene Definitionen aus der Literatur vorgestellt und diskutiert, wobei die zeitliche und kommunikative Dimension, die Nutzeraktivität und die Art der Rezeption analysiert werden. Die Arbeit legt eine eigene Definition von Social TV fest, die die parallele und zeitversetzte Kommunikation, sowie die Interaktion zwischen Zuschauern und Sender umfasst.
3 Kommunikationsmöglichkeiten durch Social TV: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten von Social TV, unterteilt in Vorab-, Parallel- und Anschlusskommunikation. Es analysiert, wie Galileo diese Möglichkeiten nutzt, um Zuschauer zu binden und zu aktivieren. Die fünf Stufen der Interaktion nach Gugel werden als Rahmen für die Analyse der Galileo-Beispiele verwendet.
3.1 Vorabkommunikation: Dieser Abschnitt behandelt die Kommunikationsaktivitäten von Galileo vor der Sendung. Es werden Beispiele wie WhatsApp-Newsletter, Facebook-Posts und Twitter-Meldungen analysiert, die dazu dienen, die Zuschauer auf die Sendung aufmerksam zu machen und ihre Vorfreude zu steigern. Zusätzlich werden interaktive Elemente wie Votings und Live-Streams eingeordnet.
3.2 Parallelkommunikation: Hier wird die Kommunikation während der Sendung untersucht. Beispiele wie Social-Media-Posts von Zuschauern, die Galileo AR-App, und interaktive Projekte wie "Du bist Kanzler" werden detailliert beschrieben und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Zuschauerinteraktion und das Sendegeschehen analysiert.
3.3 Anschlusskommunikation: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Kommunikation nach der Sendung. Beispiele für die Anschlusskommunikation sind das Nachspielen von interaktiven Experimenten online, Q&As auf Facebook, und die Reaktion des Galileo-Teams auf Zuschauerfeedback in sozialen Medien. Die Bedeutung dieses Rückkanals für den Sender und die Zuschauerbindung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Social TV, Medienkonvergenz, Zuschauerinteraktion, Kommunikationsmodelle, Galileo, Parallele Mediennutzung, Vorabkommunikation, Parallelkommunikation, Anschlusskommunikation, Interaktives Fernsehen, Zuschauerpartizipation, Second Screen, Medienwandel, Online-Buzz, Galileo AR App, Interaktive Woche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Social TV am Beispiel Galileo"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Phänomen Social TV anhand der Sendung Galileo. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten von Social TV und deren Umsetzung anhand konkreter Beispiele. Es wird die Verschmelzung von klassischem Fernsehen und digitalen sozialen Medien untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Social TV; Kommunikationsformen im Social TV (Vorab-, Parallel-, Anschlusskommunikation); Beispiele für Social TV-Strategien von Galileo; interaktive Elemente und Zuschauerpartizipation; Social TV 2.0 und 3.0 im Kontext von Galileo.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsdefinition von Social TV, Kommunikationsmöglichkeiten durch Social TV (inkl. Unterkapiteln zu Vorab-, Parallel- und Anschlusskommunikation), und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Was versteht die Arbeit unter Social TV?
Die Arbeit legt eine eigene Definition von Social TV fest, die die parallele und zeitversetzte Kommunikation sowie die Interaktion zwischen Zuschauern und Sender umfasst. Verschiedene Definitionen aus der Literatur werden vorgestellt und diskutiert.
Welche Kommunikationsmöglichkeiten von Social TV werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet drei Kommunikationsmöglichkeiten: Vorabkommunikation (Kommunikation vor der Sendung), Parallelkommunikation (Kommunikation während der Sendung) und Anschlusskommunikation (Kommunikation nach der Sendung).
Wie werden die Kommunikationsmöglichkeiten am Beispiel Galileo veranschaulicht?
Die Arbeit analysiert konkrete Beispiele aus der Sendung Galileo für jede der drei Kommunikationsformen. Beispiele für Vorabkommunikation sind WhatsApp-Newsletter und Facebook-Posts. Beispiele für Parallelkommunikation sind Social-Media-Posts von Zuschauern und die Galileo AR-App. Beispiele für Anschlusskommunikation sind Online-Q&As und die Reaktion des Galileo-Teams auf Zuschauerfeedback.
Welche Rolle spielt die Zuschauerinteraktion?
Die Zuschauerinteraktion spielt eine zentrale Rolle in der Arbeit. Die Analyse konzentriert sich auf die verschiedenen Möglichkeiten der Interaktion und deren Auswirkungen auf das Sendegeschehen und die Zuschauerbindung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Social TV, Medienkonvergenz, Zuschauerinteraktion, Kommunikationsmodelle, Galileo, Parallele Mediennutzung, Vorabkommunikation, Parallelkommunikation, Anschlusskommunikation, Interaktives Fernsehen, Zuschauerpartizipation, Second Screen, Medienwandel, Online-Buzz, Galileo AR App, Interaktive Woche.
Welche konkreten Beispiele von Galileo werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene interaktive Elemente und Projekte von Galileo, darunter die Galileo AR-App und interaktive Projekte wie "Du bist Kanzler". Es werden auch die verschiedenen Social-Media-Aktivitäten der Sendung untersucht.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im Kapitel 5 zusammengefasst. Es fasst die wichtigsten Ergebnisse der Analyse der Social-TV-Strategien von Galileo zusammen und bewertet deren Effektivität.
- Quote paper
- Julia Luderschmid (Author), 2018, Verdeutlichung der Kommunikationsmöglichkeiten durch Social TV anhand ausgewählter Beispiele der Sendung Galileo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441284