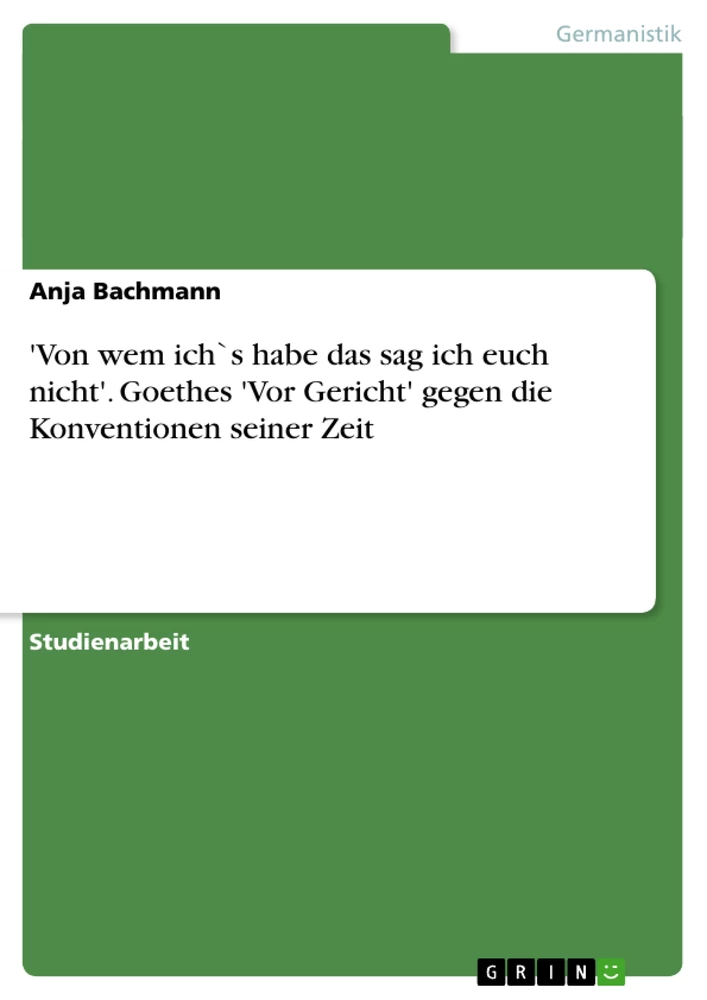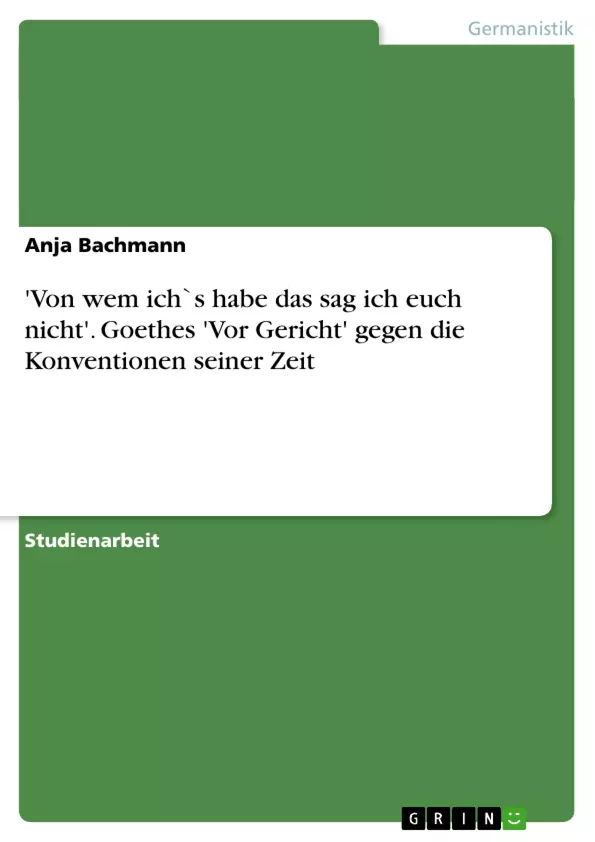Goethes Ballade Vor Gericht ist in mehr als einer Hinsicht außergewöhnlich. Weder lässt sie sich formal in das Schema der Kunstballade pressen, die zur Zeit des Sturm und Drang eine beliebte literarische Ausdrucksweise darstellte, noch orientiert sie sich inhaltlich an den Konventionen einer Zeit, die die uneheliche Mutterschaft als Straftat betrachtete. Die formale und inhaltliche Rebellion gegen aufklärerisches Gedankengut entspricht zwar der Idee des Sturm und Drang, der Umgang mit dem Thema der ledigen Mutterschaft geht aber weit über die in diesem Zusammenhang übliche moralische oder sentimental-bedauernde Betrachtungsweise hinaus.
Die knappe, prägnante Ausdrucksweise und die lediglich vier Strophen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ballade kunstvoll aufgebaut, in ihrer Konzeption nichts dem Zufall überlassen ist.
Der junge Goethe verfasste diese literarische Verteidigungsrede einer ledigen Mutter, die sämtliche Konventionen der Gesellschaft in der sie lebt für nichtig erklärt, im Jahr 1776, lange bevor er als Politiker und Mitglied des Geheimen Conseils in die Lage versetzt wurde, staatspolitischen Zielen Genüge zu tun und in deren Sinne zu handeln und entscheiden. Veröffentlicht wurde die Ballade jedoch erstmals 1815, nachdem sie zuvor nur in der handschriftlichen Gedichtsammlung für Frau von Stein enthalten war. Im Folgenden soll versucht werden, die Einzigartigkeit dieser Ballade herauszuarbeiten. Eine Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit, die auch auf die Stellung der ledigen Mutter im ausgehenden 18. Jahrhunderts eingehen und sich mit der rechtlichen Situation sowie politischen Zielen der Regierungen auf deutschem Gebiet beschäftigen wird, soll einer ausführlichen formalen und inhaltlichen Analyse der Ballade vorausgehen und bei deren Verständnis helfen.
Zuletzt werde ich einen Vergleich zwischen Dichtung und Realität ziehen. Hierbei will ich zeigen, dass Vor Gericht eher der sozialkritischen Balladendichtung der Moderne als der Kunstballade nahe steht, was sie zur Zeit des Sturm und Drang absolut einzigartig macht. Des weiteren sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, sich noch eingehender oder unter anderen Gesichtspunkten mit dieser Ballade zu befassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Frau in der Gesellschaft von 1770
- Spätfeudalistische Gesellschaft und Bevölkerungszuwachs in den Städten
- Frauenbild der Gesellschaft: Die Mutterrolle
- Uneheliche Schwangerschaften und strafbare Unzucht: Die Rolle von Kirche und Staat
- Johann Wolfgang von Goethe: Vor Gericht
- Die Ballade
- Form und Inhalt
- Interpretation
- Ballade contra Gesellschaft: Schlussworte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Analyse von Goethes Ballade "Vor Gericht" und die Einordnung in den Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Dabei steht die Frage nach der Einzigartigkeit der Ballade im Mittelpunkt.
- Die Rolle der Frau in der spätfeudalistischen Gesellschaft
- Die rechtliche und soziale Situation unehelicher Mütter
- Die literarische Form der Ballade im Kontext des Sturm und Drang
- Goethes Darstellung der ledigen Mutterschaft in "Vor Gericht"
- Die gesellschaftliche und politische Kritik in der Ballade
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Diese Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Besonderheiten von Goethes Ballade "Vor Gericht" im Hinblick auf Form und Inhalt. Die Einordnung in die Epoche des Sturm und Drang und die Auseinandersetzung mit den Konventionen der Zeit werden angedeutet.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftliche Situation der Frau im ausgehenden 18. Jahrhundert. Es werden die spätfeudalistische Gesellschaft, das Frauenbild der Zeit und die rechtliche Situation unehelicher Mütter beleuchtet.
- Kapitel 3: Hier steht Goethes Ballade "Vor Gericht" im Fokus. Die Analyse umfasst Form und Inhalt der Ballade sowie eine Interpretation ihrer Botschaft.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Goethes Ballade "Vor Gericht", Sturm und Drang, Spätfeudalismus, Frauenrolle, uneheliche Mutterschaft, gesellschaftliche Konventionen, literarische Form, sozialkritik.
- Citation du texte
- Anja Bachmann (Auteur), 2005, 'Von wem ich`s habe das sag ich euch nicht'. Goethes 'Vor Gericht' gegen die Konventionen seiner Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44134