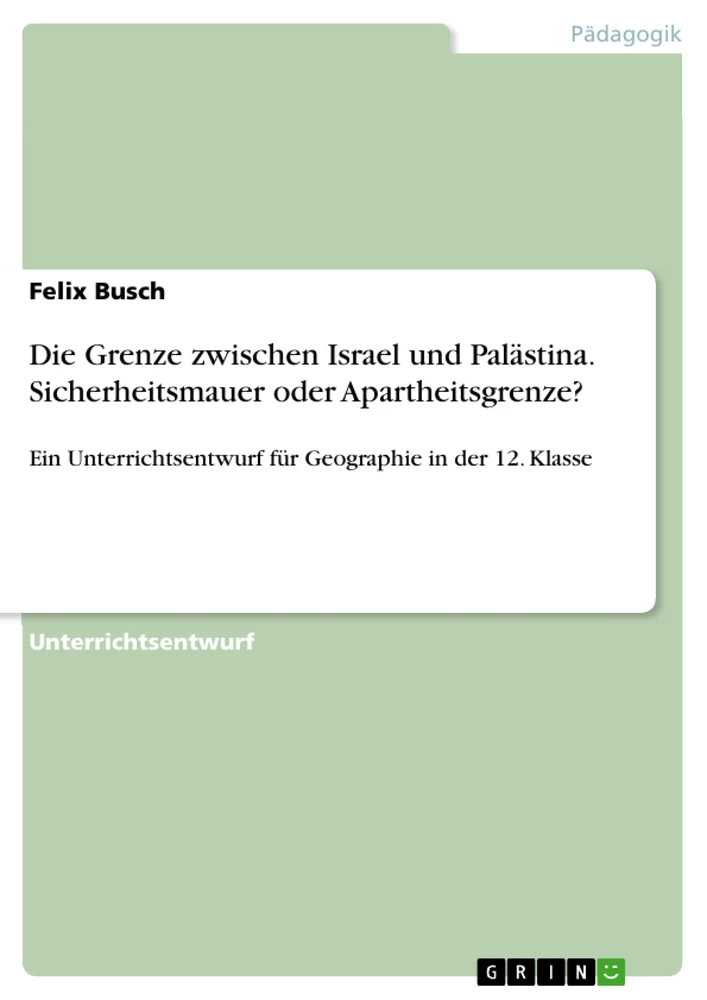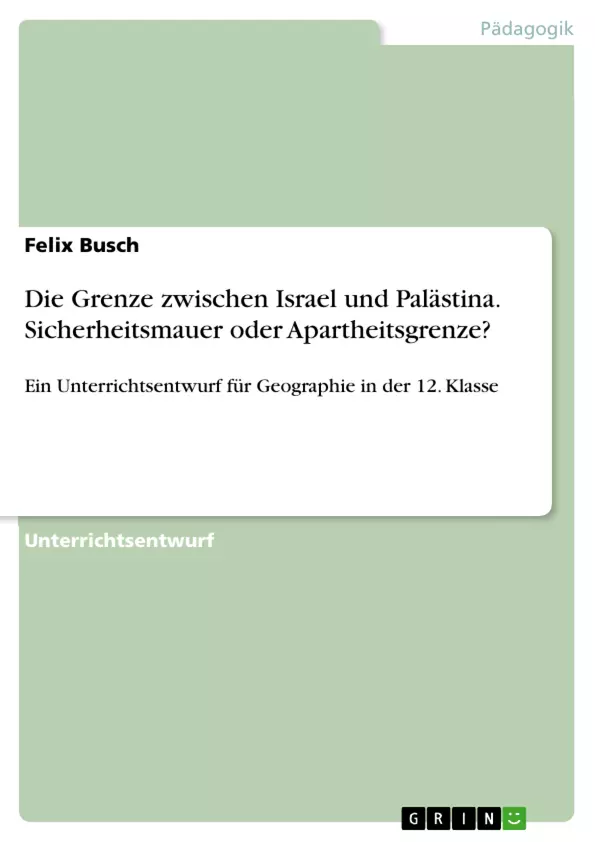Der dieser Hausarbeit zu Grunde liegende Konflikt zwischen Israel und Palästina geht in der Geschichte bis in das Jahr 3000 v. Chr. zurück. Hierbei handelt es sich um einen Ressourcen- und Gebietskonflikt zwischen Juden und Arabern. Im Zentrum der Auseinandersetzung standen hier seit Beginn des Konfliktes, der von den Juden neu errichtete Staat Israel, sowie die arabischen Staaten, wie Libanon, Ägypten, Jordanien und Syrien, welche zuvor im Osmanischen Reich größtenteils inbegriffen waren. Um die Ausgangslage zu verstehen muss zunächst betrachtet werden, weshalb Araber und Juden Anspruch auf das Gebiet um Palästina erheben. 3000 - 2000 v. Chr. besiedelten sowohl gläubige Juden als auch Araber das Gebiet um Palästina und machten Jerusalem zu ihrem zentralen „Glaubensort“.
Diese Hausarbeit bietet die Möglichkeit für die 12. oder 13. Klasse "8" Unterrichtsstunden zu gestalten. Hierbei werden der Ressourcenkonflikt, sowie der religiöse Konflikt zwischen Israel und Palästina beleuchtet. Es befinden sich außerdem einige Seiten mit Materialien, welche komplett ausgearbeitet sind im Anhang. Eine didaktische Auswertung und Analyse ist ebenfalls inbegriffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Konfliktvorstellung zwischen Israel und Palästina
- Fachwissenschaftliche Einordnung (Sachanalyse)
- Didaktisches Potential (Didaktische Analyse)
- Didaktisierung (Didaktisches Drehbuch)
- Begründung zentraler didaktischer Entscheidungen (Begründung des Ablaufs)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, den Konflikt zwischen Israel und Palästina aus geographischer Perspektive zu analysieren und didaktisch aufzuarbeiten. Dabei wird die Geschichte des Konflikts beleuchtet, die geographischen Raumkonzepte angewendet und die didaktischen Möglichkeiten zur Vermittlung des Themas im Unterricht erörtert.
- Raumkonflikte und Grenzziehungen
- Ressourcenkonflikte und territoriale Ansprüche
- Politische und soziale Auswirkungen des Konflikts
- Didaktische Ansätze zur Vermittlung komplexer geopolitischer Themen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung - Konfliktvorstellung zwischen Israel und Palästina
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den historischen Hintergrund des Konflikts zwischen Israel und Palästina, die zentralen Akteure, die strittigen Gebiete und die wichtigsten Ursachen des Konflikts.
Fachwissenschaftliche Einordung (Sachanalyse)
In diesem Kapitel werden verschiedene geographische Raumkonzepte auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina angewendet. Die Bedeutung der geographischen Lage, der Ressourcenverteilung und der unterschiedlichen Wahrnehmung des Raumes durch die Konfliktparteien wird untersucht.
Didaktisches Potential (Didaktische Analyse)
Hier werden die didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Vermittlung des Themas im Unterricht beleuchtet. Die Relevanz des Themas für die Schülerinnen und Schüler sowie die geeigneten Lernziele und Methoden werden diskutiert.
Didaktisierung (Didaktisches Drehbuch)
Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes didaktisches Drehbuch für die Unterrichtsgestaltung zum Thema. Es enthält eine detaillierte Beschreibung der Unterrichtseinheiten, der Lernaktivitäten und der benötigten Materialien.
Schlüsselwörter
Der Konflikt zwischen Israel und Palästina, Raumkonflikte, Grenzziehungen, Ressourcenkonflikte, territoriale Ansprüche, politische Geographie, Didaktik, Unterrichtsplanung, geographische Raumkonzepte.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Kern des Israel-Palästina-Konflikts?
Die Arbeit beschreibt den Konflikt als einen Ressourcen- und Gebietskonflikt zwischen Juden und Arabern, der historische Wurzeln bis 3000 v. Chr. hat.
Wie wird der Konflikt didaktisch aufbereitet?
Die Hausarbeit bietet ein Konzept für 8 Unterrichtsstunden in der 12. oder 13. Klasse, inklusive Materialien und einem didaktischen Drehbuch.
Welche Rolle spielt die Geographie in dieser Analyse?
Es werden geographische Raumkonzepte angewendet, um Grenzziehungen, Ressourcenverteilung und territoriale Ansprüche zu untersuchen.
Warum ist Jerusalem ein zentraler Punkt des Konflikts?
Jerusalem gilt für beide Seiten als zentraler "Glaubensort", was den religiösen Charakter des territorialen Streits verstärkt.
Welche Materialien sind im Anhang enthalten?
Der Anhang enthält komplett ausgearbeitete Materialien für den Unterricht sowie eine didaktische Auswertung.
- Quote paper
- Felix Busch (Author), 2018, Die Grenze zwischen Israel und Palästina. Sicherheitsmauer oder Apartheitsgrenze?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441716