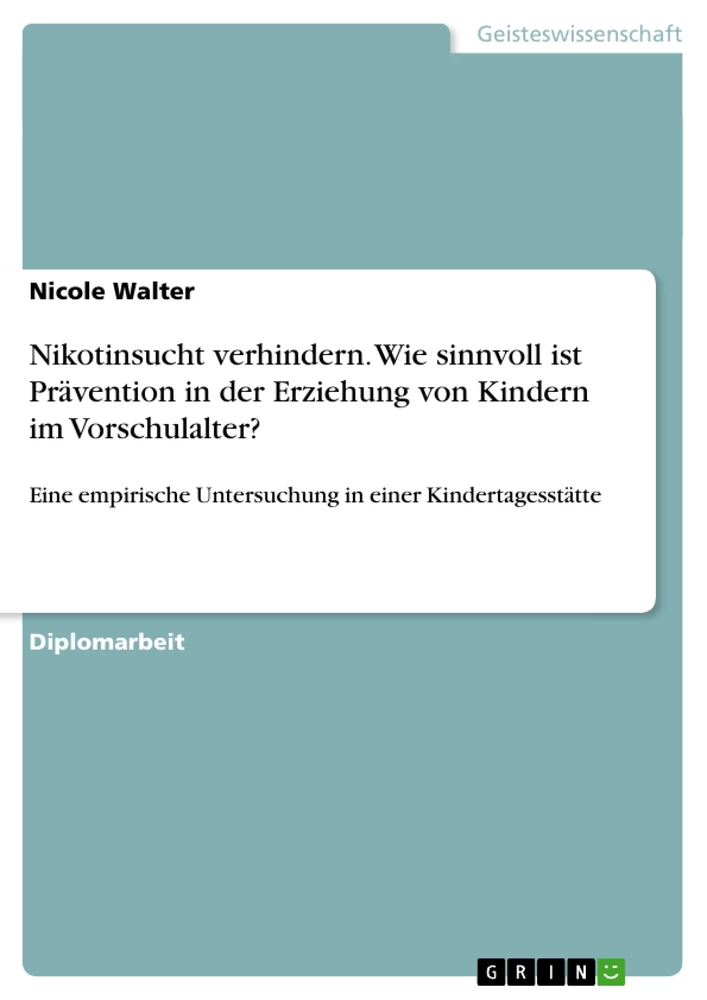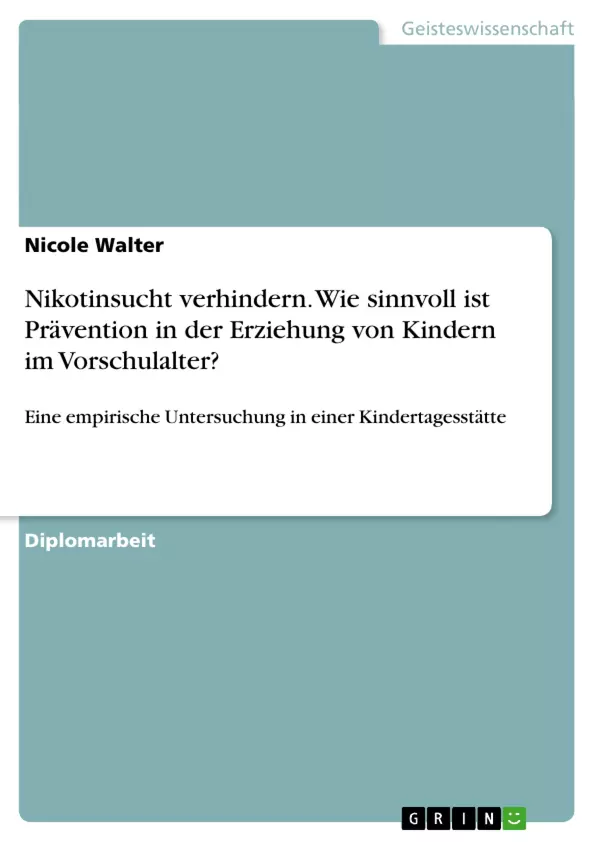Um das Arbeitsthema der Nikotinprävention im Elternhaus bei Kindern im Vorschulalter unter wissenschaftlichen Aspekten in Augenschein nehmen zu können, erscheint es sinnvoll, etwas weiter auszuholen und den Umgang mit Drogen in unserer Gesellschaft sowie das Phänomen der allgemeinen Suchtentstehung zu untersuchen.
Ein Großteil der Arbeit wird sich ohne eine spezielle Differenzierung der Nikotinsucht auf die gesamten stoffgebundenen Drogen beziehen. Dies geschieht aus dem Grund, da beispielsweise eine Suchtgefährdung oder eine suchtmittelunspezifische Prävention nicht an einen bestimmten Suchtstoff gebunden ist, sondern sich aus dem süchtigen Verhalten im Allgemeinen herausbildet(vgl. Haug-Schnaben, Schmid-Steinbrunner, 2000, S. 10 ff.).Nachdem daher anfangs die Bereiche der Sucht und Gesellschaft, der Ätiologie von Süchten sowie die Folgen der Sucht im Hinblick auf die Nikotinsucht thematisiert werden, werde ich anschließend auf die Frage der Präventionsrelevanz im Vorschulalter und die diesbezügliche Verantwortung sowie die Möglichkeiten der Familie eingehen. Der darauf folgende empirische Teil bezieht sich auf die Untersuchungsergebnisse aus einer Befragung von Eltern, deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung in Magdeburg untergebracht sind. Im Mittelpunkt dieser Befragung stehen das Verhalten des Kindes und der Umgang mit dem Kind, das familiäre Gesundheitsbewusstsein, der Umgang mit Alltagsdrogen sowie die eigene erlebte Kindheit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sucht und Gesellschaft
- Leben in einer Konsumgesellschaft
- Bagatellisierung der legalen Sucht
- Sucht und ihre Folgen am Beispiel der Nikotinsucht
- Wissenschaftliches Verständnis von Sucht
- Geschichte des Tabaks
- Nikotin in der Gesellschaft
- Nikotin als Droge
- Zahlen und Fakten zum Konsum
- Gesundheitliche Schädigungen durch die Nikotinsucht
- Tabakkonsum als Einstieg in die gekoppelte Abhängigkeit
- Sucht als Ergebnis eines Entwicklungsprozesses
- Ätiologie süchtigen Verhaltens
- Risikoorientierte Konzepte
- Suchtprotektive Konzepte
- Theoretische Konzepte zur Entwicklung einer Nikotinsucht
- Determinanten des Rauchbeginns
- Ätiologie süchtigen Verhaltens
- Relevanz der Drogenthematik im Vorschulalter
- Suchtgefährdung in der Kindheit
- Vorläufer einer Sucht
- Die Rolle der ersten Sozialisationsinstanz der Familie
- Risikofaktoren in der Familie
- Protektive Faktoren in der Familie
- Familiärer Wandel und pädagogische Grenzen
- Familiäre Suchtprävention
- Empirischer Teil
- Angewandte Methodik
- Darstellung der Ergebnisse aus der Untersuchung
- Allgemeine Lebenssituation
- Einstellungen zur Gesundheit
- Einstellungen zu Alltagsdrogen
- Verhalten des Kindes
- Verhalten gegenüber dem Kind
- Kindheit der Probanden
- Prüfung und Diskussion der Hypothesen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Nikotinprävention im Elternhaus bei Kindern im Vorschulalter. Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung einer frühzeitigen Prävention zu beleuchten und den Einfluss des elterlichen Verhaltens auf die Entwicklung einer Nikotinsucht bei Kindern im Vorschulalter zu untersuchen.
- Die Rolle der Familie als primäre Sozialisationsinstanz in Bezug auf die Nikotinprävention
- Risikofaktoren und protektive Faktoren im Familiensystem, die die Entwicklung einer Nikotinsucht beeinflussen können
- Die Bedeutung von elterlichem Vorbildverhalten und Kommunikation hinsichtlich Nikotinsucht
- Die Herausforderungen und Chancen der Nikotinprävention in einer Gesellschaft, in der Rauchen immer noch weit verbreitet ist
- Die Relevanz einer altersgemäßen und effektiven Präventionsarbeit im Vorschulalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Nikotinprävention im Kontext der Sucht und Gesellschaft einordnet. Anschließend werden das wissenschaftliche Verständnis von Sucht, die Geschichte des Tabaks und die Folgen des Nikotinkonsums für die Gesundheit und Gesellschaft betrachtet. Im Anschluss wird auf die Ätiologie süchtigen Verhaltens eingegangen, wobei verschiedene Konzepte und Theorien zur Entwicklung einer Nikotinsucht vorgestellt werden. Die Arbeit untersucht dann die Relevanz der Drogenthematik im Vorschulalter und beleuchtet die besonderen Herausforderungen und Chancen der Prävention in dieser Altersgruppe. Ein wichtiger Teil der Arbeit widmet sich der Rolle der Familie als erster Sozialisationsinstanz und analysiert sowohl Risikofaktoren als auch protektive Faktoren innerhalb des Familiensystems. Es werden verschiedene Strategien der familiären Suchtprävention vorgestellt. Im empirischen Teil der Arbeit werden die Ergebnisse einer Untersuchung in einer Kindertagesstätte in Magdeburg präsentiert und diskutiert. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen sowie einer Diskussion der Limitationen der Studie und zukünftiger Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Nikotinprävention, Sucht, Familie, Elternhaus, Vorschulalter, Risikofaktoren, Protektive Faktoren, Vorbildverhalten, Kommunikation, Prävention, Gesellschaft, Gesundheit, Entwicklung, Ätiologie, Tabakkonsum, Kindertagesstätte, Magdeburg
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Nikotinprävention bereits im Vorschulalter relevant?
Suchtverhalten entwickelt sich oft als Prozess. Frühzeitige Prävention stärkt Schutzfaktoren und sensibilisiert Kinder, bevor sie in Kontakt mit Suchtmitteln kommen.
Welche Rolle spielt das Elternhaus bei der Suchtentwicklung?
Die Familie ist die erste Sozialisationsinstanz. Elterliches Vorbildverhalten, Kommunikation und das allgemeine Gesundheitsbewusstsein prägen die Einstellung des Kindes zu Drogen.
Was sind protektive Faktoren im Familiensystem?
Protektive Faktoren sind Merkmale wie eine stabile emotionale Bindung, offene Kommunikation, soziale Unterstützung und die Förderung des Selbstwertgefühls des Kindes.
Wie wirkt sich die Bagatellisierung legaler Drogen aus?
Die gesellschaftliche Akzeptanz von Nikotin und Alkohol erschwert die Präventionsarbeit, da diese Stoffe oft nicht als gefährliche Drogen wahrgenommen werden.
Was wurde in der empirischen Untersuchung in Magdeburg ermittelt?
Die Befragung untersuchte das Verhalten von Eltern und Kindern sowie den Umgang mit Alltagsdrogen, um Zusammenhänge zwischen familiärem Umfeld und Suchtgefährdung aufzuzeigen.
- Citation du texte
- Nicole Walter (Auteur), 2005, Nikotinsucht verhindern. Wie sinnvoll ist Prävention in der Erziehung von Kindern im Vorschulalter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44179