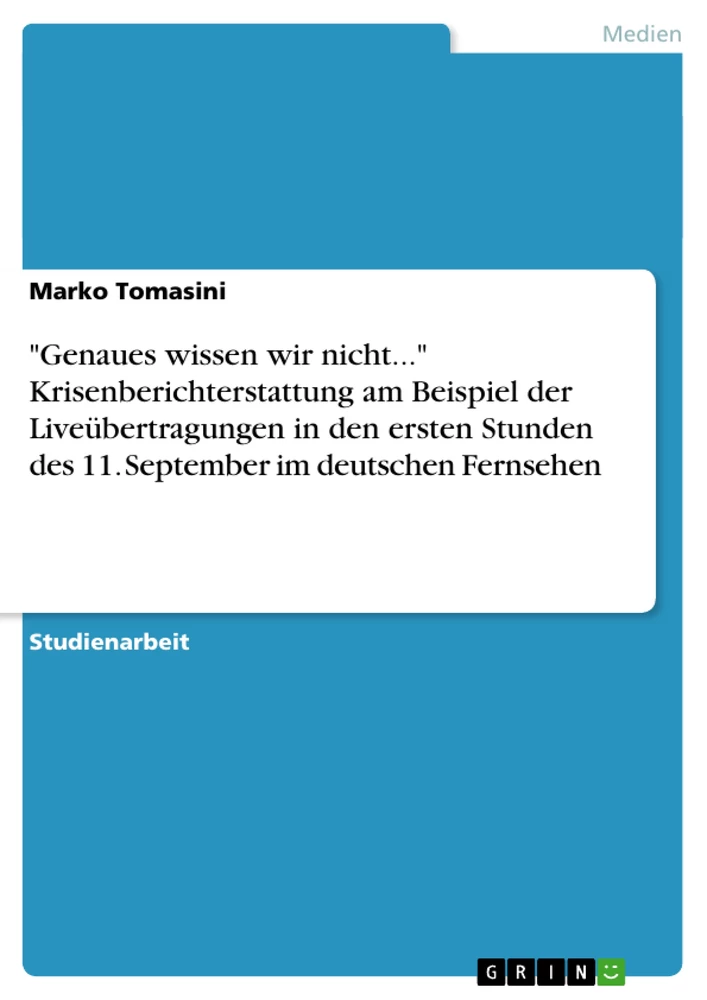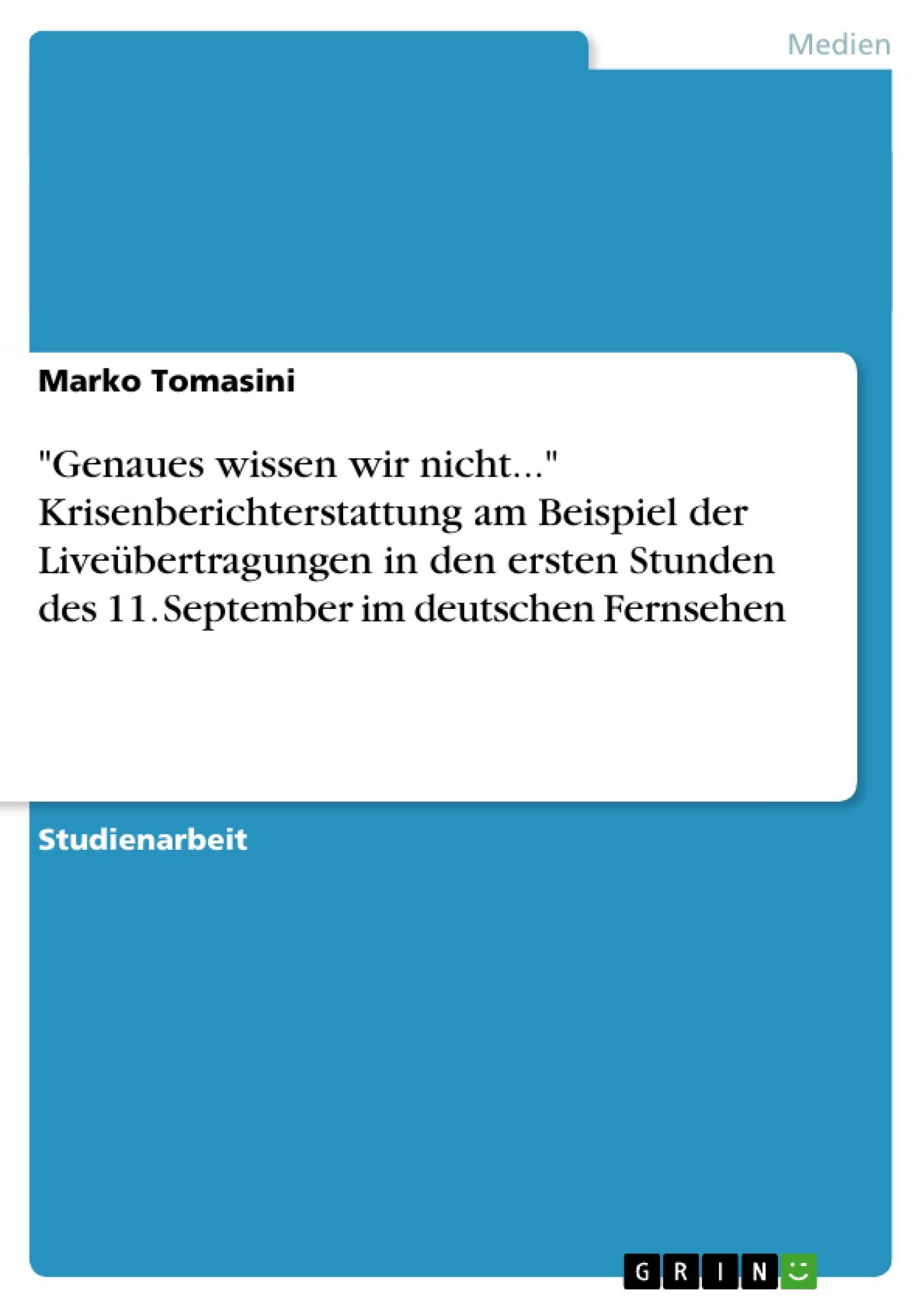Mit dem Datum des 11. Septembers verbindet man heute den wohl grausamsten Terroranschlag in der Geschichte der Menschheit, welcher im Anschluss die gesamte Weltordnung in Frage stellen sollte.
Es gibt mehrere Gründe, warum dieser Anschlag und der Tag an dem er geschah, solch gravierende Folgen für die Weltpolitik hatte. Zum Einem natürlich der Angriff auf die USA auf eigenem Territorium. Nie zuvor ist dieses Land so tief in seinem Selbstverständnis und in seinem Gefühl der Unangreifbarkeit verletzt worden, zudem von einer nichtstaatlichen, terroristischen Organisation. Zum Anderen natürlich das Ausmaß, welches dieser Anschlag erreichte.
Nicht zuletzt allerdings muss man auch den Eindruck dieses Ereignisses und dieses Tages erwähnen, den er weltweit hinterlassen hat. Es war ein mediales Großereignis. Die ganze Welt konnte die Ereignisse in (vor allem) New York live am Fernsehen verfolgen. Das Unfassbare per Direktübertragung. Der zweite Einschlag in den Südturm war bereits live auf CNN zu sehen. Eine Repräsentativstudie der TU Ilmenau hat ergeben, dass fast 70% der deutschen Bevölkerung innerhalb von einer Stunde über das Geschehen in den USA informiert war. Der Einsturz der brennenden Bürotürme wurde von mehr Zuschauern am Bildschirm verfolgt, als irgendeine andere Katastrophe zuvor. Ulrich Wickert meint dazu: „Am Tag der Terroranschläge waren es die Fernsehbilder […], die die Zuschauer vor den Fernseher bannten.“
Es darf vermutet werden, dass die Terroristen vom 11. September 2001 auch diese Wirkung im Auge hatten. Neben der Tatsache, dass ihnen das Unglaubliche gelungen war, die USA zu demütigen, wollten sie mit Sicherheit auch genau diesen Effekt erzielen. Die Verbreitung des Schreckens von New York aus über die ganze Welt. Anderes wäre dieser Anschlag auch nicht zu erklären. Die Heftigkeit, mit der man hier vorging und die Brutalität sollten so real wie möglich auch die Leute erreichen, welche nicht vor Ort waren. Auf diese Art haben sie es erreicht, Angst und Schrecken auch dorthin zu transportieren, wo sie selbst nicht zugegen waren. Um die Berichterstattung am 11. September soll es in dieser Arbeit gehen. Dazu soll zunächst die Krisen- und Kriegsberichterstattung allgemein vorgestellt, später auf das Verhältnis von Terrorismus und (Massen-) Medien eingegangen und im Hauptteil auf die Berichterstattung am 11. September speziell im deutschen Fernsehen eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Krisen- und Kriegsberichterstattung
- Information als Ware
- Der Krieg und die Experten
- Die Darstellungsform des „Infotainments“
- Politischer Einfluss
- Terrorismus und die Medien
- Die Berichterstattung am 11. September 2001
- Chronologie des Anschlags
- Das Unfassbare beschreiben
- Die Spontaneität des Ereignisses
- Etwas kommentieren, das man selbst nicht versteht
- Zu schnelle Klischees, zu schnell Krieg?
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Berichterstattung im deutschen Fernsehen zum Terroranschlag vom 11. September 2001. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der Krisenberichterstattung, insbesondere in Bezug auf die Darstellung von Terrorismus und Krieg. Dabei wird untersucht, wie das Ereignis medial konstruiert wurde und welche Auswirkungen die Berichterstattung auf die öffentliche Meinung hatte.
- Die Rolle der Medien in der Krisen- und Kriegsberichterstattung
- Die Herausforderungen der Berichterstattung über Terrorismus
- Die Konstruktion des Ereignisses in der Medienlandschaft
- Der Einfluss der Berichterstattung auf die öffentliche Meinung
- Die Bedeutung von visuellen Medien in der Krisenkommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Terroranschlag vom 11. September 2001 in seinen historischen Kontext und betont dessen Bedeutung für die Weltpolitik. Kapitel 2 beleuchtet die Herausforderungen der Krisen- und Kriegsberichterstattung im Allgemeinen, fokussiert auf die Problematik der Informationsvermittlung in Zeiten von Krieg und Terrorismus. Kapitel 3 diskutiert das Verhältnis von Terrorismus und Medien, während Kapitel 4 die Berichterstattung im deutschen Fernsehen zum 11. September 2001 analysiert. Dieses Kapitel untersucht die Chronologie des Anschlags, die Darstellung des Unfassbaren, die Spontaneität des Ereignisses, die Schwierigkeit, etwas zu kommentieren, das man selbst nicht versteht, sowie die Frage nach der schnellen Verbreitung von Klischees und der Gefahr, die Ereignisse zu schnell als Krieg zu deuten.
Schlüsselwörter
Krisenberichterstattung, Kriegsberichterstattung, Terrorismus, Medien, Fernsehen, 11. September 2001, Informationsvermittlung, öffentliche Meinung, visuelle Medien, Konstruktion von Ereignissen.
Häufig gestellte Fragen
Warum war der 11. September ein „mediales Großereignis“?
Weil die Welt die Anschläge fast in Echtzeit verfolgen konnte; fast 70% der Deutschen waren innerhalb einer Stunde informiert.
Was sind die Herausforderungen der Live-Krisenberichterstattung?
Journalisten müssen Ereignisse kommentieren, die sie selbst noch nicht verstehen, was die Gefahr von Klischees und vorschnellen Deutungen birgt.
Welches Verhältnis besteht zwischen Terrorismus und Medien?
Terroristen nutzen Medien bewusst als Instrument zur Verbreitung von Angst und Schrecken über den eigentlichen Tatort hinaus.
Was versteht man unter „Infotainment“ in der Berichterstattung?
Die Vermischung von Information und Unterhaltung, die auch bei Katastrophenberichten zur Steigerung der Zuschauerbindung eingesetzt wird.
Wie reagierte das deutsche Fernsehen in den ersten Stunden?
Die Arbeit analysiert die Spontaneität und die Schwierigkeiten der deutschen Sender, das Unfassbare live für die Zuschauer einzuordnen.
- Arbeit zitieren
- Marko Tomasini (Autor:in), 2005, "Genaues wissen wir nicht..." Krisenberichterstattung am Beispiel der Liveübertragungen in den ersten Stunden des 11. September im deutschen Fernsehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44184