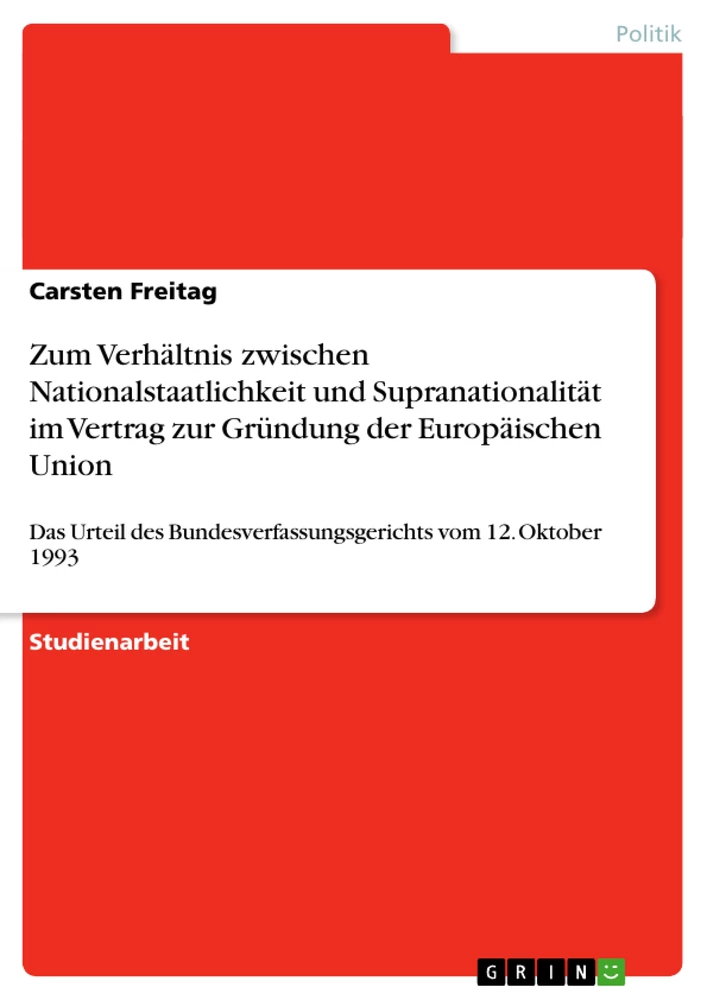Die Probleme und Hindernisse die sich aus der Europäischen Integration ergeben sind vielschichtig. Die Tatsache, daß sich der Prozeß hauptsächlich auf intergouvernementaler Ebene vollzieht, ist sicherlich ein Hauptproblem, das bedingt daß die Entwicklung schwerfällig und häufig von Minimalkonsens geprägt ist, da keine Regierung ihre Interessen vernachlässigen kann und die Integration im eigenen Land rechtfertigen muß. Vielen Bürgern in Europa fällt es daher schwer, die Europäische Einigung zu unterstützen und sich von der starken Rolle der Nationalstaaten zu trennen. Ein strukturelles Problem stellt die Union in ihrer derzeitigen Form selbst dar, indem sie nur über eine mangelnde demokratische Legitimation verfügt.
Daher rührte auch der Grund für Manfred Brunners Verfassungsbeschwerde, der fürchtete, daß mit der im EU-Vertrag festgelegten Ausweitung der Supranationalität und der Erweiterung der Entscheidungskompetenzen auf EU-Ebene, die vom Volk legitimierten Nationalstaaten zu stark entmachtet und ihre demokratischen Kompetenzen ausgehöhlt werden. Er vertritt die Meinung, allein der Nationalstaat ist geeignet Demokratie in Europa zu verwirklichen, da nur der Nationalstaat vom Staatsvolk demokratisch legitimiert werden kann. Gleichzeitig wies er darauf hin, daß die Europäische Union ihrerseits nicht über eine ausreichende demokratische Legitimation verfügt, denn es gäbe zwar ein europäisches Parlament, jedoch kein europäisches Volk. Mit dem Maastrichter Vertrag würde nun, unter Abgabe von Hoheitsrechten an die Europäische Union, der Einfluß der nationalen Parlamente weiter verringert und so das Mitbestimmungsrecht der Bürgers unterminiert. Dies verstoße gegen Artikel 38 GG, der jedem Bürger das Recht garantiert an der Legitimation der Staatsgewalt (durch Wahl des Bundestages) mitzuwirken, da der Bundestag entmachtet und der Bürger entmündigt würde. Brunner befürchtete ebenfalls einen unumkehrbaren Automatismus hin zu einer Währungsunion, sowie weiterer Kompetenzausweitung seitens der Union, dem sich die Bundesrepublik nicht mehr entziehen könne.
Somit mußte sich das oberste deutsche Gericht nicht nur mit der staatsrechtlichen Frage der Verfassungskonformität der Verträge befassen, sondern, aus o.g. Gründen, auch mit der europäischen Integration allgemein. Diese Situation, internationaler Aufmerksamkeit, nutzte das BVerfG zu einer Standortbestimmung und Festlegung von Grenzen für die weitere Entwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung
- Einleitung: Der Vertrag von Maastricht im Spannungsfeld von Supranationalität und Nationalstaatlichkeit
- Der Vertrag von Maastricht aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts
- Wie interpretiert das BVerfG den Charakter des Vertrags von Maastricht?
- Demokratische Legitimation und Legitimität der Europäischen Union
- Richtlinien des BVerfG für die Europapolitik
- Das Urteil im Spiegel ausgewählter Kommentare
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Oktober 1993 zum Vertrag von Maastricht. Das Gericht beurteilte die Vereinbarkeit des Vertrags mit dem deutschen Grundgesetz im Kontext der europäischen Integration und der Spannung zwischen Nationalstaatlichkeit und Supranationalität.
- Interpretation des Vertrags von Maastricht durch das BVerfG
- Demokratische Legitimation der Europäischen Union
- Grenzen der europäischen Integration
- Spannungsfeld von Supranationalität und Nationalstaatlichkeit
- Verhältnis von Nationalstaatlichkeit und europäischer Integration
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Vertrag von Maastricht im Spannungsfeld von Supranationalität und Nationalstaatlichkeit: Die Einleitung stellt den Vertrag von Maastricht als wichtigen Meilenstein der europäischen Integration vor und beleuchtet die Kontroversen um seine Neuerungen, insbesondere die drei Säulen (Europäische Gemeinschaft, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, verstärkte Zusammenarbeit in der Innen- und Justizpolitik). Sie erläutert die deutsche Ratifizierung des Vertrags und die daraus resultierende "Integrationsskepsis", die sich auf die Stabilität der neuen Gemeinschaftswährung und die Verfassungskonformität des Vertrags bezog.
- Der Vertrag von Maastricht aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts: Dieser Abschnitt beleuchtet die Interpretation des Vertrags von Maastricht durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Es analysiert, wie das BVerfG den Charakter des Vertrags beurteilt, welche Aspekte der demokratischen Legitimation und Legitimität der Europäischen Union hervorgehoben werden und welche Richtlinien das BVerfG für die deutsche Europapolitik formuliert. Zudem werden ausgewählte Kommentare zum Urteil diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Vertrags von Maastricht, dem deutschen Grundgesetz, der europäischen Integration, der Supranationalität, der Nationalstaatlichkeit, der demokratischen Legitimation, dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft, den Grenzen der Integration und der deutschen Europapolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Grund für Manfred Brunners Verfassungsbeschwerde gegen den Vertrag von Maastricht?
Brunner fürchtete, dass durch die Ausweitung der Supranationalität im EU-Vertrag die demokratisch legitimierten Nationalstaaten entmachtet und ihre Kompetenzen ausgehöhlt würden. Er argumentierte, dass nur der Nationalstaat vom Volk legitimiert werden könne, da es kein „europäisches Volk“ gebe.
Wie beurteilt das Bundesverfassungsgericht die demokratische Legitimation der EU im Maastricht-Urteil?
Das Gericht setzte sich kritisch mit der mangelnden demokratischen Legitimation der Union auseinander. Es betonte, dass die Abgabe von Hoheitsrechten Grenzen hat und die Mitbestimmungsrechte der Bürger über den Bundestag gewahrt bleiben müssen.
Was sind die sogenannten „drei Säulen“ des Vertrags von Maastricht?
Der Vertrag basiert auf der Europäischen Gemeinschaft (EG), der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich Inneres und Justiz.
Welchen Einfluss hat der Vertrag von Maastricht auf die nationalen Parlamente?
Kritiker wie Brunner sahen durch die Übertragung von Entscheidungskompetenzen auf die EU-Ebene eine Schwächung der nationalen Parlamente und eine Entmündigung der Bürger, was gegen Artikel 38 des Grundgesetzes verstoßen könnte.
Welche Rolle spielt die Supranationalität im Verhältnis zur Nationalstaatlichkeit?
Die Arbeit analysiert das Spannungsfeld zwischen der Souveränität der Nationalstaaten und der zunehmenden Verlagerung von Macht auf die überstaatliche (supranationale) Ebene der EU, wie sie im Vertrag von Maastricht festgeschrieben wurde.
- Quote paper
- Carsten Freitag (Author), 2001, Zum Verhältnis zwischen Nationalstaatlichkeit und Supranationalität im Vertrag zur Gründung der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44194