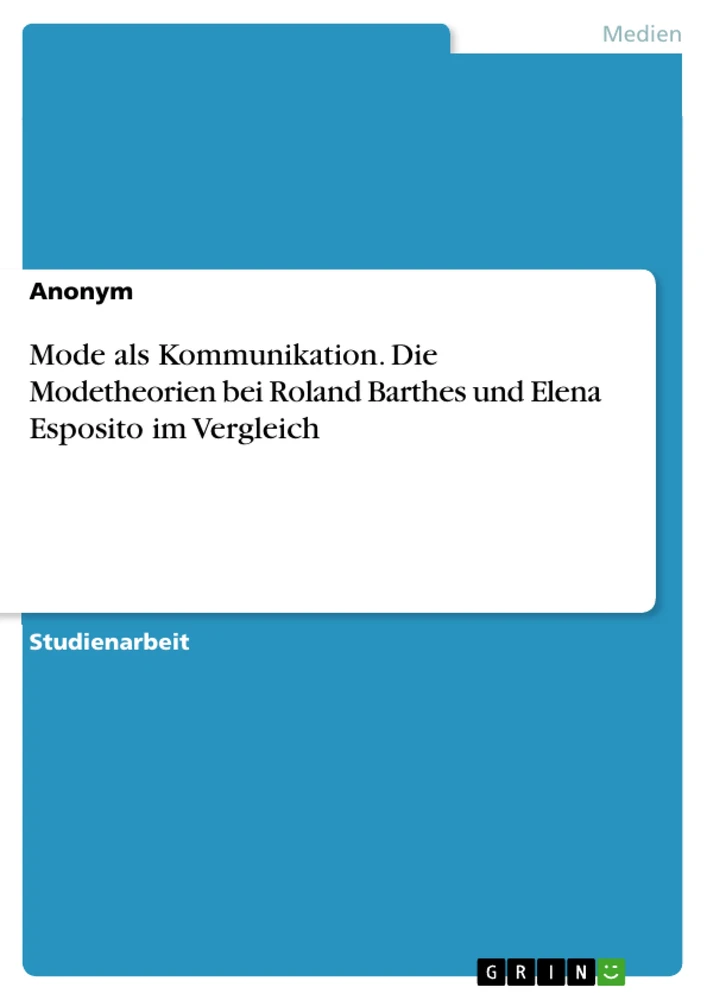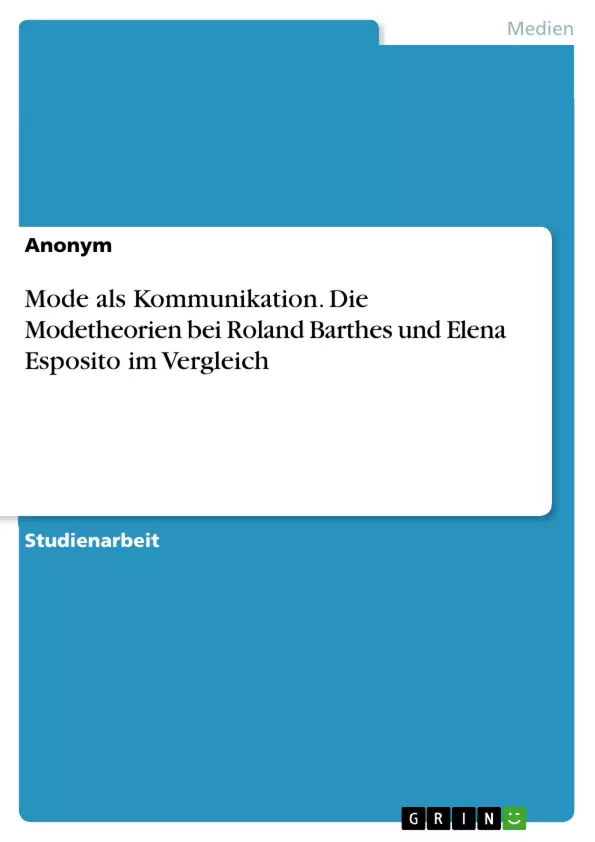Was ist Mode, wie funktioniert sie, was drückt sie aus? Diese Arbeit geht diesen Fragen anhand der Modetheorien des französischen Sprachphilosophen Roland Barthes und der italienischen Soziologin Elena Esposito nach. Beide Autoren haben sich zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem Thema Mode auseinandergesetzt und wurden in der Mode- und Bekleidungsforschung breit rezipiert. So haben sie durch ihren strukturalistischen (Barthes) und systemtheoretischen Ansatz (Esposito) der allgemeinen Modetheorie neue Impulse gegeben.
Dabei untersucht die Arbeit Mode als „Medium der Bedeutungsgenerierung, Bedeutungszuschreibung, aber auch der Dekonstruktion von Bedeutung [...].“ Es steht also das kulturelle Phänomen Mode, weniger Mode im Sinne von Kleidungsobjekten im Mittelpunkt. Am Beispiel des 1967 erschienen modetheoretischen Hauptwerkes „Die Sprache der Mode“ von Barthes und entsprechender Sekundärliteratur werden die Eckpunkte einer sprachwissenschaftlich-zeichentheoretischen Beschäftigung mit dem Gegenstand „Mode“ herausgearbeitet, Schwachstellen des Ansatzes offengelegt und die Aktualität von Barthes Erkenntnissen geprüft. An dieser Stelle kann allerdings nicht die gesamte Vielschichtigkeit von Barthes Überlegungen abgebildet werden, weshalb sich die Arbeit daher auf die theoretischen Einlassungen im ersten Teil des Werkes beschränkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Mode? Zur Definition eines einheitlich uneinheitlichen Begriffs
- Der soziologische Modebegriff: Mode als sozialer Wandel
- Kleidermode und material culture
- Kulturwissenschaftlicher Modebegriff: Mode als kulturelle Praktik
- Philosophischer Modebegriff: Dialektik von Differenzierung und Nachahmung
- Fazit: Mode, ein „geheimnisvolles Phänomen“
- Roland Barthes: Mode als Zeichensystem
- Ikonische, verbale und technologische Strukturen von Bekleidung
- Zentrale Bedeutungssysteme: vestimentärer Code und rhetorisches System
- Fazit: Barthes Einfluss auf die Modetheorie
- Elena Esposito: Mode als zirkuläres System
- Soziale und temporale Paradoxien von Mode
- Mode als Normalisierung von Devianz
- Mode als Kontingenzbewältigung?
- Fazit: Die Paradoxien der Mode
- Schlussbetrachtung: Barthes und Esposito im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem kulturellen Phänomen Mode und untersucht die Bedeutungstheorien von Roland Barthes und Elena Esposito. Dabei soll die Entstehung von Bedeutung in Mode analysiert werden sowie die jeweiligen Ansätze der beiden Autoren verglichen werden. Der Fokus liegt auf der sprachwissenschaftlich-zeichentheoretischen Beschäftigung mit dem Thema Mode, wobei die Aktualität von Barthes Erkenntnissen geprüft wird. Die Arbeit beleuchtet zudem die Paradoxien von Mode nach Elena Esposito, die im Rückgriff auf die systemtheoretischen Ideen Niklas Luhmanns das Phänomen Mode zu entschlüsseln versucht.
- Die Bedeutung von Mode als kulturelles Phänomen und Medium der Bedeutungsgenerierung
- Die sprachwissenschaftlich-zeichentheoretische Perspektive auf Mode nach Roland Barthes
- Die Analyse der Paradoxien von Mode nach Elena Esposito im systemtheoretischen Rahmen
- Der Vergleich der Ansätze von Barthes und Esposito
- Die Aktualität von Barthes Erkenntnissen für die heutige Modetheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Mode als tägliches Phänomen ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Im zweiten Kapitel wird der vielschichtige Begriff der Mode näher betrachtet und verschiedene Disziplinen und Sichtweisen auf Mode aufgezeigt. Das dritte Kapitel analysiert Barthes' "Die Sprache der Mode" und untersucht die sprachwissenschaftlich-zeichentheoretischen Aspekte von Mode. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Paradoxien von Mode nach Esposito und beleuchtet die systemtheoretische Perspektive.
Schlüsselwörter
Mode, Kultur, Bedeutung, Zeichensystem, Sprache, Systemtheorie, Paradoxien, Roland Barthes, Elena Esposito, "Die Sprache der Mode", "Die Verbindlichkeit der Vorübergehenden: Paradoxien der Mode", Sozialer Wandel, Individuation, Sozialisierung, Kommunikation
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2016, Mode als Kommunikation. Die Modetheorien bei Roland Barthes und Elena Esposito im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442013