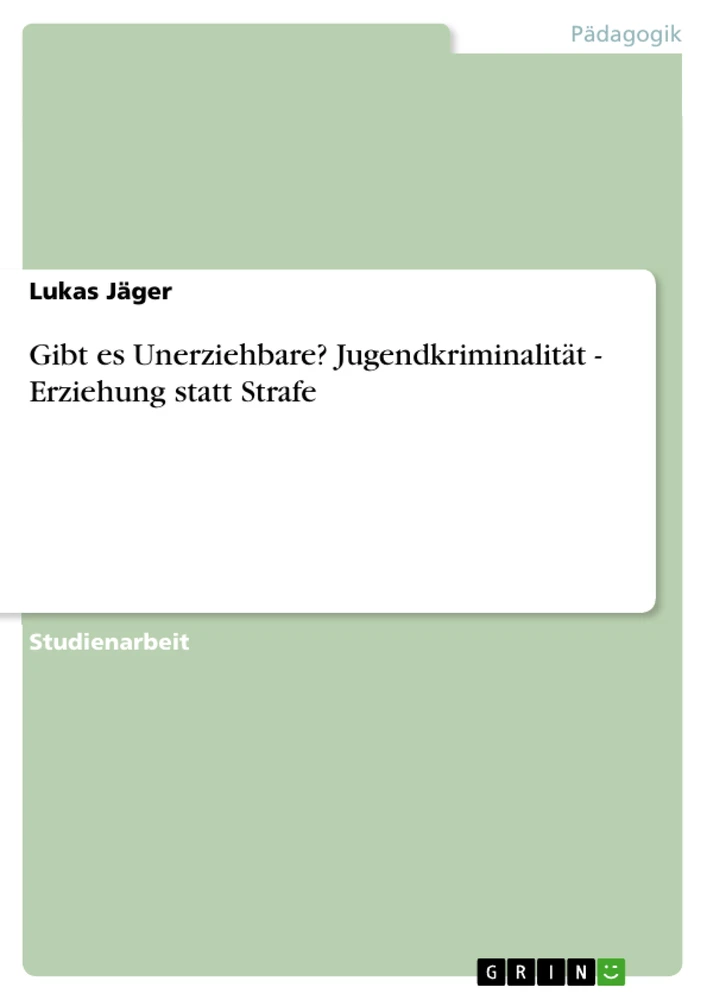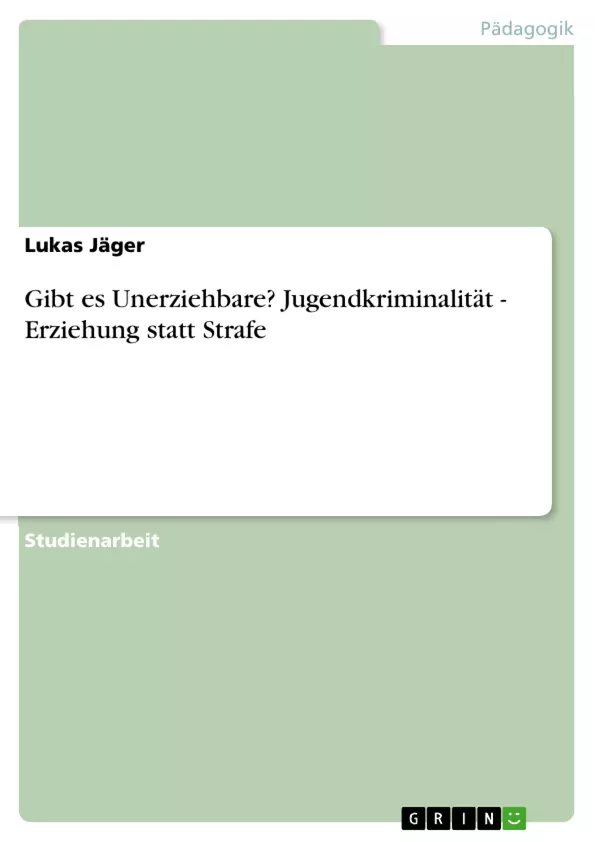In der Erziehungsdebatte als auch in den Medien wird immer wieder von den aussichtslosen Erziehungsmethoden bei den „schwererziehbaren“ Jugendlichen berichtet, bei denen „doch eh alles hoffnungslos sei“. Doch ist dem so? Gibt es „unerziehbare“ Jugendliche? Jugendliche, welche aufgegeben werden können und in die weder Zeit noch Geld investiert werden muss? Welche, die nur noch „weggesperrt“ werden können?
Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der „Unerziehbaren“ zwar im weiten Feld der Pädagogik abgeschafft wurde, doch die aussondernden Bezeichnungen von - nun eben - „Schwererziehbaren“ oder „Verhaltensauffälligen“ in gleicher Bedeutung verwendet werden. Diesem Skandal der Gesellschaft ist ein untragbarer Zustand, denn fest steht: „Unerziehbare“ gibt es nicht, sie werden gemacht!
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Erziehbar - Unerziehbar
- „Unerziehbarkeit“ und Jugend: gesellschaftliche Diskurse
- Jugenddiskurse
- Die Konjunktur der Neuro- und Biowissenschaften
- Präventionsdiskurse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob es „unerziehbare“ Jugendliche gibt. Sie analysiert die historische Entwicklung des Begriffs „Unerziehbarkeit“ und stellt ihn in den Kontext gesellschaftlicher Diskurse über Jugend. Die Arbeit untersucht die Gefahren von Präventionsdiskursen und kritisiert die Verwendung von Begriffen wie „Verhaltensstörung“ als Ausdruck gesellschaftlicher Ausgrenzung.
- Definition und historische Entwicklung des Begriffs „Unerziehbarkeit“
- Gesellschaftliche Diskurse über Jugend und „Unerziehbarkeit“
- Die Rolle von Neuro- und Biowissenschaften in der Debatte
- Kritik an Präventionsdiskursen und ihrer Auswirkung auf die soziale Arbeit
- Die Konstruktion von „Normalität“ und „Abnormalität“ in Bezug auf Jugend
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema „Unerziehbarkeit“ in den Kontext der Erziehungswissenschaft und beleuchtet die aktuelle Debatte über „schwererziehbare“ Jugendliche.
- Kapitel 2 untersucht verschiedene Definitionen von „Unerziehbarkeit“ und „Schwererziehbarkeit“ aus historischen pädagogischen Lexika und Enzyklopädien. Es wird deutlich, wie diese Begriffe im Laufe der Zeit und in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten verstanden wurden und welche impliziten Annahmen über „Normalität“ und „Abnormalität“ in ihnen stecken.
- Kapitel 3 setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern es möglich oder unmöglich ist, „unerziehbar“ zu sein. Es untersucht die gesellschaftlichen Vorstellungen von Erziehbarkeit und zeigt, wie diese die Definition von „Unerziehbarkeit“ beeinflussen.
- Kapitel 4 analysiert verschiedene (Jugend-)Diskurse zur Thematik der „Unerziehbaren“. Es werden die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Weltbilder betrachtet, die den Blick auf das Thema „Unerziehbarkeit“ prägen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen „Unerziehbarkeit“, „Schwererziehbarkeit“, „Verhaltensstörung“, gesellschaftliche Diskurse, Jugend, Präventionsdiskurse, Normalität, Abnormalität, Neuro- und Biowissenschaften, soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es wirklich "unerziehbare" Jugendliche?
Nein, die pädagogische Fachwelt lehnt diesen Begriff ab. Er wird oft als soziale Konstruktion gesehen, um Jugendliche auszugrenzen, bei denen herkömmliche Methoden versagt haben.
Was ist der Unterschied zwischen "schwererziehbar" und "verhaltensauffällig"?
Beide Begriffe dienen oft als Ersatz für "unerziehbar" und beschreiben Jugendliche, deren Verhalten von gesellschaftlichen Normen abweicht, wobei die Ursachen oft im sozialen Umfeld liegen.
Welche Rolle spielen Neuro- und Biowissenschaften in der Debatte?
Sie werden oft herangezogen, um abweichendes Verhalten biologisch zu begründen, was die Gefahr birgt, soziale Probleme als rein medizinische Störungen zu behandeln.
Warum wird der Präventionsdiskurs kritisiert?
Kritiker warnen davor, dass Prävention zur frühen Etikettierung und Überwachung von Jugendlichen führen kann, statt echte soziale Unterstützung zu bieten.
Was bedeutet "Erziehung statt Strafe"?
Es ist ein Leitprinzip des Jugendstrafrechts, das darauf abzielt, durch pädagogische Maßnahmen die Resozialisierung zu fördern, anstatt nur repressiv zu wirken.
- Quote paper
- B.A. Bildungs- und Erziehungswissenschaften Lukas Jäger (Author), 2012, Gibt es Unerziehbare? Jugendkriminalität - Erziehung statt Strafe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442305