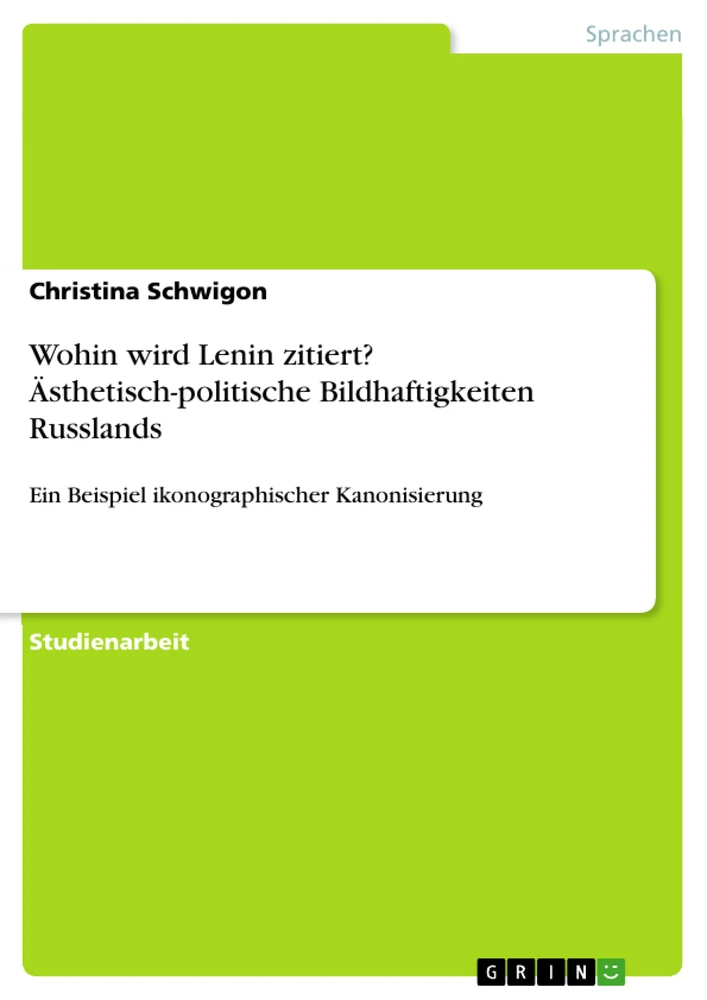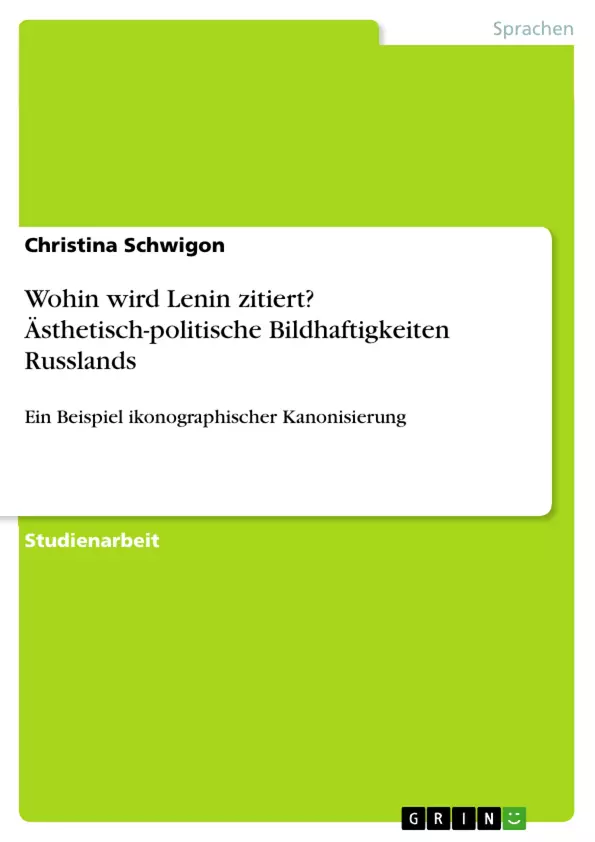Dass Kriege sowohl die Nationen im Kampf zusammenführen, als auch einen komplexen Impulsgeber und Rahmen für die abbildende fotografische Dokumentation und Fotobearbeitung liefern, zeigt sich auch am Beispiel des 5. Mai 1920 in Moskau: Lenin spricht, flankiert von Trotzkiund Kamenev, zu den Truppen der Rotgardisten. Grijgorij Gol’dštein schießt an diesem Tag mehrere Fotos, von denen eines Eingang in den zeitgenössischen Rezeptionshorizont fand und durch den Künstler Isaak Brodskij in die Kunst des sozialistischen Realismus eingefügt wurde. Im Spannungsfeld der Wahrnehmung dieser Abbildungen, stehen zudem bearbeitete Abarten der Gol’dšteinfotografien. In Bezug auf die zeitnahe Rezeption dieser Abbildungen, zeigt die wissenschaftliche Betrachtung keine eindeutige Perspektive. Im Hinblick auf die Nennung eines konkreten Bildstatus, schreibt David King: „Diese Fotografie, die von G.P. Goldstein stammt [...], ist wahrscheinlich das erste und sicher das berühmteste Beispiel der stalinistischen Retuschen. Das Original, das zu Lenins Lebzeiten und als Trotzki noch an der Macht war zum Kultbild wurde, ging um die Welt.“ Während King auf die Kanonisierung des Pressefotos und die politisch motivierten Umformungsprozess unter Stalin verweist, deutet Klaus Waschik auf die heute bestehende fehlerhafte Wahrnehmung, die im Spannungsverhältnis der rezeptiven Relationen zwischen Bildern und Abbildern zu suchen ist: „Vielleicht entwickelten sich diese Fotografien gerade deshalb zu Bild-Ikonen mit einem festen Platz in der Lenin-Ikonographie und damit im Kanon revolutionärer Herrscherbilder. Dies betrifft jedoch nicht alle Aufnahmen der Serie vom 5. Mai 1920, die wenigen ausgewählten nicht in Gänze und nicht zwingend als Fotodokumente.“ Angesichts dieser Positionen stellt sich die Frage nach dem Rezeptionskonzept, einer Vermittlungsabsicht und deren Transportelementen, d.h. bildimmanenten Mitteln und bildtranszendenten, symbolischen Bezügen, sowie den zeitgemäßen Kanonisierungsstrategien, die sich für den Zeitraum von 1920 bis zur vollen Etablierung von Stalins Herrschaft bis. ca. 1935 ergeben. Für die Beantwortung, stellt sich eine kultur- und kunsthistorische Analyse als Notwendigkeit dar. Ihr möchte ich nachkommen, in dem ich zunächst den traditionellen Ikonenhorizont und dessen Rezeptionsmöglichkeiten in Bezug auf die Visualisierung von Herrschaft offen lege um daran in Bezug auf das Medium der Fotografie einen modernen Rezeptionshorizont darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ikone und das Gewaltbild
- Die moderne Ikone
- Schlagbilder
- Russland und die semantische Herrschaft
- Die Ästhetische Kanonisierung des russischen Kultursinns
- Das affektive Monopol der Herrschaft
- Leninsche Bildhaftigkeit
- „Die Überwindung der Sekundarität“
- Die ,,Gol'dšteinbilder"
- Das Pressefoto - Die Pressefotos?
- Wo ist Trotzki? Das Gemälde als prädeformierte Fotografie?
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die ästhetisch-politische Bildhaftigkeit Russlands am Beispiel der ikonografischen Kanonisierung eines Pressefotos von Lenin. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung von Lenins Bild im Kontext der russischen Herrschaft und der ästhetischen und politischen Strömungen der Zeit zu untersuchen.
- Die Ikone als Vermittlerfunktion zwischen Übersinnlichem und Irdischem im Kontext der Bildpolitik
- Die Kanonisierung von Bildern im Zusammenhang mit politischer Herrschaft
- Die Rolle der Fotografie in der Konstruktion von Geschichtsbildern
- Die semantische Herrschaft und die Ästhetisierung von Gewalt
- Die Bedeutung von Bildmanipulation und Retuschen in der sowjetischen Propaganda
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Foto von Lenin, aufgenommen von Grijgorij Gol❜dštein am 5. Mai 1920, als Ausgangspunkt der Analyse vor. Es wird die wissenschaftliche Debatte über die Interpretation dieses Fotos und dessen Bedeutung im Kontext der russischen Geschichte beleuchtet.
Das Kapitel "Die Ikone und das Gewaltbild" untersucht die Ikone als ein traditionelles, religiöses Symbol und dessen Bedeutung für die Vermittlung von Herrschaft. Es wird die Frage gestellt, inwieweit sich diese Funktionsweise in die Moderne übertragen lässt und wie sich Bilder im Kontext von Gewalt und Krieg verstehen lassen.
Das Kapitel "Russland und die semantische Herrschaft" beleuchtet die ästhetische Kanonisierung des russischen Kultursinns und das affektive Monopol der Herrschaft. Es wird die Frage gestellt, wie sich die Bildhaftigkeit von Lenin im Kontext der russischen Herrschaft entwickelt hat und welche Bedeutung sie für die politische Stabilität und Legitimierung hatte.
Das Kapitel "Die ,,Gol'dšteinbilder"" widmet sich der Analyse des Pressefotos von Lenin und dessen verschiedenen Bearbeitungen. Es werden die verschiedenen Interpretationen des Bildes und dessen Bedeutung für die Konstruktion von Geschichtsbildern diskutiert.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit den Themen Ikone, Gewaltbild, Bildpolitik, semantische Herrschaft, Ästhetisierung, Kanonisierung, Fotomanipulation, sozialistischer Realismus, russische Geschichte, Lenin, Trotzki, Gol❜dštein, Propaganda.
Häufig gestellte Fragen
Welches Ereignis steht im Zentrum dieser Bildanalyse?
Im Zentrum steht der 5. Mai 1920 in Moskau, an dem Lenin, flankiert von Trotzki und Kamenev, eine Rede vor Rotgardisten hielt und dabei fotografiert wurde.
Was ist das Besondere an den Fotografien von Grijgorij Gol'dštein?
Sie gelten als berühmte Beispiele stalinistischer Retuschen, bei denen politische Gegner wie Trotzki später aus den Bildern entfernt wurden.
Wie definiert die Arbeit den Begriff der „modernen Ikone“?
Die Arbeit untersucht, wie traditionelle religiöse Ikonenfunktionen auf moderne politische Herrscherbilder übertragen wurden, um Macht zu legitimieren.
Welche Rolle spielt der „sozialistische Realismus“ in diesem Kontext?
Künstler wie Isaak Brodskij fügten dokumentarische Fotografien in die Kunst des sozialistischen Realismus ein, um einen Kanon revolutionärer Herrscherbilder zu schaffen.
Was versteht man unter „semantischer Herrschaft“?
Es beschreibt die Kontrolle über die Bedeutung und Interpretation von Bildern und Symbolen zur Festigung politischer Macht.
Warum ist die wissenschaftliche Perspektive auf diese Fotos nicht eindeutig?
Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Foto als Dokument und seiner späteren Funktion als bearbeitete Bild-Ikone innerhalb der sowjetischen Propaganda.
- Citation du texte
- Christina Schwigon (Auteur), 2013, Wohin wird Lenin zitiert? Ästhetisch-politische Bildhaftigkeiten Russlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442587