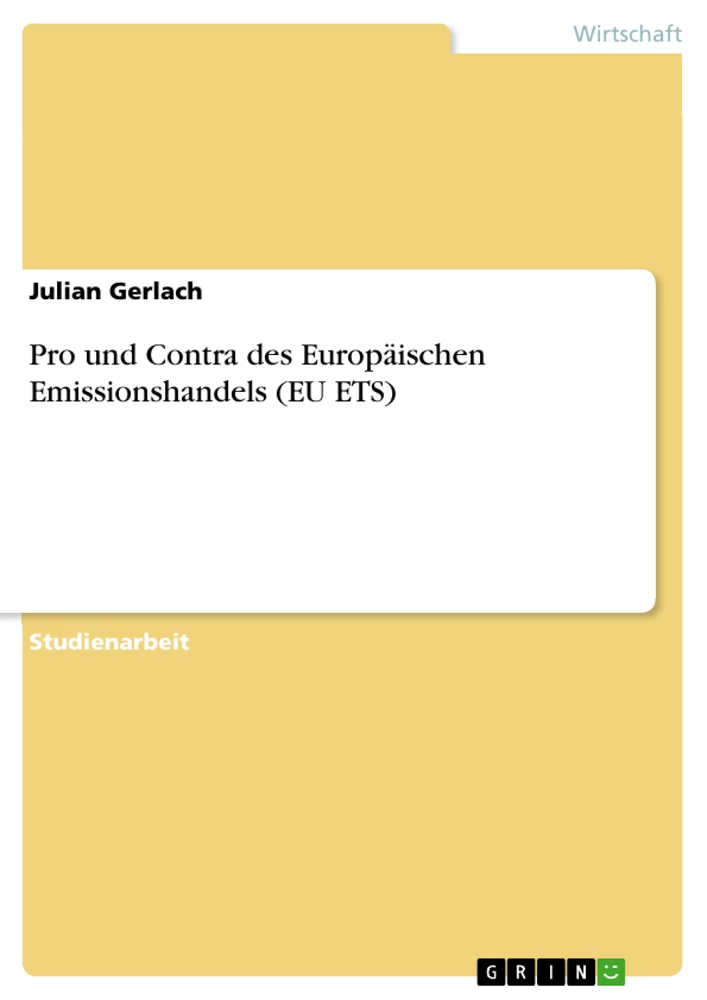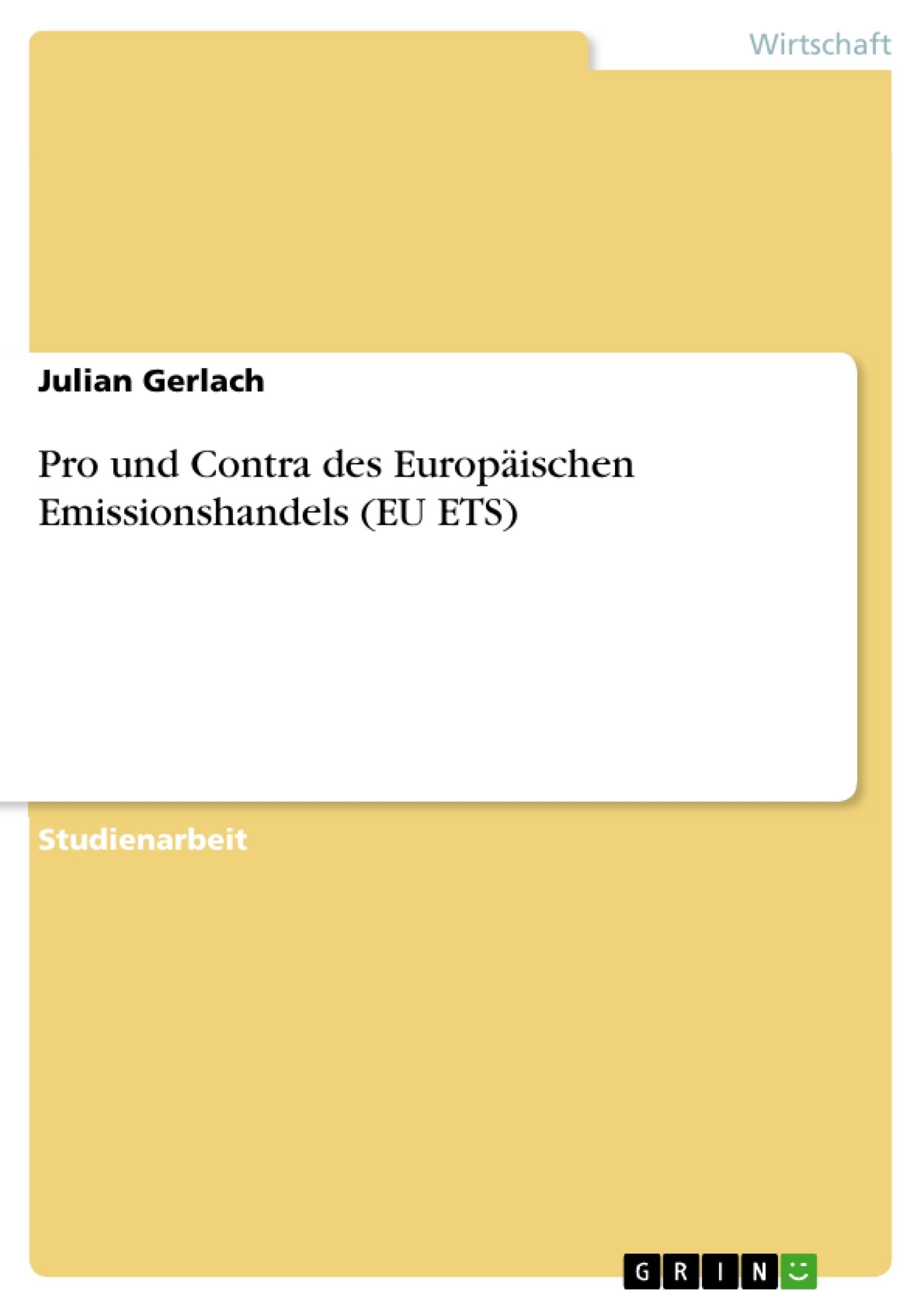Die nachfolgende Arbeit befasst sich mit den Pro und Contra Seiten des europäischen Emissionshandels. Dieses marktwirtschaftliche Instrument soll dazu dienen das Klima zu schützen, indem die ausgestoßenen Emissionen begrenzt und mit der Zeit reduziert werden.
Seit dem 20. Jahrhundert verschlechtert sich die Klimasituation fortschreitend. Diese zunehmende Verschlechterung der klimatischen Verhältnisse auf dem Planeten, führt unter anderem zum Anstieg der Meeresspiegel und zu einer Erwärmung der Weltmeere. Zurückzuführen ist diese Klimaänderung maßgeblich auf den stetig ansteigenden Kohlendioxidausstoß auf der ganzen Welt (Sesli, A, 2015). Die europäische Kommission hat sich mit der Einführung des europäischen Emissionshandels das Ziel gesetzt, die ausgestoßenen Emissionen zu begrenzen und zu reduzieren, um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Die Verdopplung der CO2-Emissionen in den letzten Jahrzehnten wird als Hauptverursacher der Temperaturerhöhung der Erde angesehen (Sesli, A, 2015).
Einer Langzeitbetrachtung zur Folge ist die CO2- Konzentration in der Umgebungsluft auf einem Höhepunkt angelangt. Erhöht sich die Konzentration von dem für die Atmosphäre schädlichen Kohlendioxid weiter, kann es zu einer drastischen Verschlimmerung von Klimaereignissen kommen. Um einer weiteren Klimaänderung entgegenzuwirken, ist es daher zwingend erforderlich, eine Reduktion der Treibhausgasemissionen zu bewirken (Sesli, A, 2015).
Diese Arbeit befasst sich mit der Problemstellung der europäischen Kommission bei der Umsetzung des Emissionshandels. Hierzu werden dem Leser erst allgemeine Informationen, sowie die Funktionsweise des EU-Emissionshandels nähergebracht. Mit Hilfe der Historischen Entwicklung sollen der Verlauf und die entstandenen Probleme bei der Umsetzung, welche teilweise bis heute andauern, veranschaulicht werden.
Auf Basis dieser Informationen ist es das Ziel dieser Arbeit, die Vor- und Nachteile des europäischen Emissionshandels zu erarbeiten und zu erläutern.
Die Hausarbeit gliedert sich in 6 Kapitel. Die Einleitung gibt einen Überblick über das zu erörternde Thema, hier soll vor allem der Zusammenhang zwischen der Klimaerwärmung und den CO2-Emissionen erkenntlich werden. Im zweiten Kapitel werden allgemeine Informationen und Kennzahlen, sowie die Funktionsweise des Emissionshandels und die der flexiblen Mechanismen beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen des EU ETS
- 2.1 Allgemeine Informationen
- 2.2 Funktionsweise
- 2.3 Flexible Mechanismen
- 3. Historische Entwicklung des EU ETS
- 3.1 Phase I
- 3.2 Phase II
- 3.3 Phase III
- 3.4 Ausblick Phase IV
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Beurteilung des EU ETS
- 4.2 Fazit und Ausblick
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile des europäischen Emissionshandelssystems (EU ETS). Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Umsetzung des EU ETS durch die Europäische Kommission zu beleuchten und die Effektivität dieses marktwirtschaftlichen Instruments im Klimaschutz zu bewerten.
- Der Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und Klimawandel
- Funktionsweise und Mechanismen des EU ETS
- Historische Entwicklung und Herausforderungen des EU ETS
- Bewertung der Effektivität des EU ETS
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen des EU ETS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen dem steigenden CO2-Ausstoß, der sich verschlechternden Klimasituation und der Notwendigkeit einer Emissionsreduktion dar. Sie führt in das Thema des europäischen Emissionshandelssystems (EU ETS) ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die Vor- und Nachteile des EU ETS zu analysieren. Die Einleitung betont die Relevanz des Themas im Kontext des Klimawandels und begründet die Notwendigkeit einer effektiven Emissionsreduktionsstrategie.
2. Grundlagen des EU ETS: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen des EU ETS, beginnend mit allgemeinen Informationen zu seiner Entstehung im Kontext des Kyoto-Protokolls und seiner Einführung im Jahr 2005. Es beschreibt detailliert die Funktionsweise des Systems, einschließlich der Rolle von Emissionszertifikaten und der flexiblen Mechanismen, die zur Optimierung des Handels beitragen. Die Bedeutung des EU ETS als Instrument zum Klimaschutz wird hervorgehoben, und die Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der nachfolgenden Analysen der historischen Entwicklung und der Bewertung des Systems.
Schlüsselwörter
Europäischer Emissionshandel, EU ETS, Klimawandel, CO2-Emissionen, Kyoto-Protokoll, Emissionszertifikate, Marktwirtschaftliches Instrument, Klimaschutz, Emissionsreduktion, Bewertung, Vor- und Nachteile.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Europäisches Emissionshandelssystem (EU ETS)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das europäische Emissionshandelssystem (EU ETS), seine Vor- und Nachteile, Herausforderungen bei der Umsetzung und die Effektivität als marktwirtschaftliches Instrument im Klimaschutz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und Klimawandel, die Funktionsweise und Mechanismen des EU ETS, dessen historische Entwicklung und Herausforderungen, die Bewertung der Effektivität und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen des EU ETS, ein Kapitel zur historischen Entwicklung (Phasen I-III und Ausblick auf Phase IV), ein Kapitel mit Ergebnissen (Beurteilung und Fazit) und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Zielsetzung dar. Die Grundlagen des EU ETS werden detailliert erklärt, inklusive Funktionsweise und flexibler Mechanismen. Die historische Entwicklung wird chronologisch dargestellt. Die Ergebnisse beinhalten eine Bewertung des EU ETS und einen Ausblick.
Was sind die zentralen Ziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Beleuchtung der Herausforderungen bei der Umsetzung des EU ETS durch die Europäische Kommission und die Bewertung der Effektivität dieses Systems im Klimaschutz. Es werden die Vor- und Nachteile des Systems untersucht.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Europäischer Emissionshandel, EU ETS, Klimawandel, CO2-Emissionen, Kyoto-Protokoll, Emissionszertifikate, Marktwirtschaftliches Instrument, Klimaschutz, Emissionsreduktion, Bewertung, Vor- und Nachteile.
Was wird im Kapitel "Grundlagen des EU ETS" behandelt?
Dieses Kapitel erklärt die allgemeinen Informationen zum EU ETS, seine Entstehung im Kontext des Kyoto-Protokolls, seine detaillierte Funktionsweise inklusive der Rolle von Emissionszertifikaten und flexibler Mechanismen. Die Bedeutung des EU ETS als Klimaschutzinstrument wird hervorgehoben.
Was wird im Kapitel zur "Historischen Entwicklung des EU ETS" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des EU ETS in den Phasen I, II und III und gibt einen Ausblick auf Phase IV. Es beleuchtet die Herausforderungen in den verschiedenen Phasen.
Was wird im Kapitel "Ergebnisse" behandelt?
Dieses Kapitel beinhaltet eine Beurteilung des EU ETS bezüglich seiner Effektivität und ein abschließendes Fazit mit Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Welche Informationen enthält die Einleitung?
Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen steigendem CO2-Ausstoß, der sich verschlechternden Klimasituation und der Notwendigkeit einer Emissionsreduktion dar. Sie führt in das Thema EU ETS ein, beschreibt die Zielsetzung der Arbeit (Analyse der Vor- und Nachteile des EU ETS) und betont die Relevanz des Themas im Kontext des Klimawandels.
- Quote paper
- Julian Gerlach (Author), 2017, Pro und Contra des Europäischen Emissionshandels (EU ETS), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442642