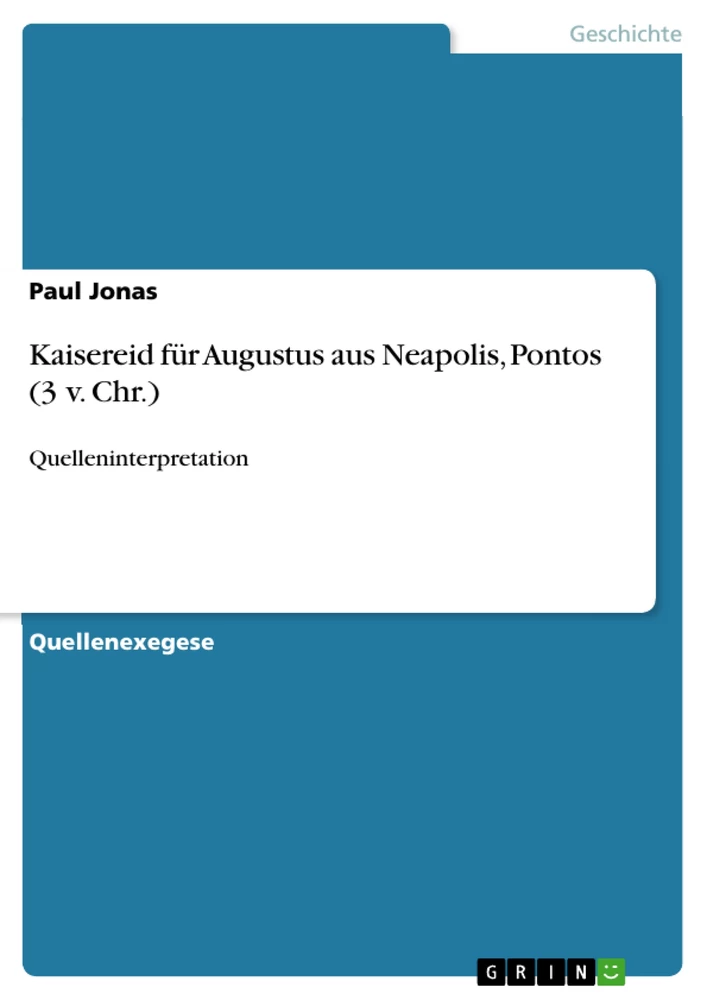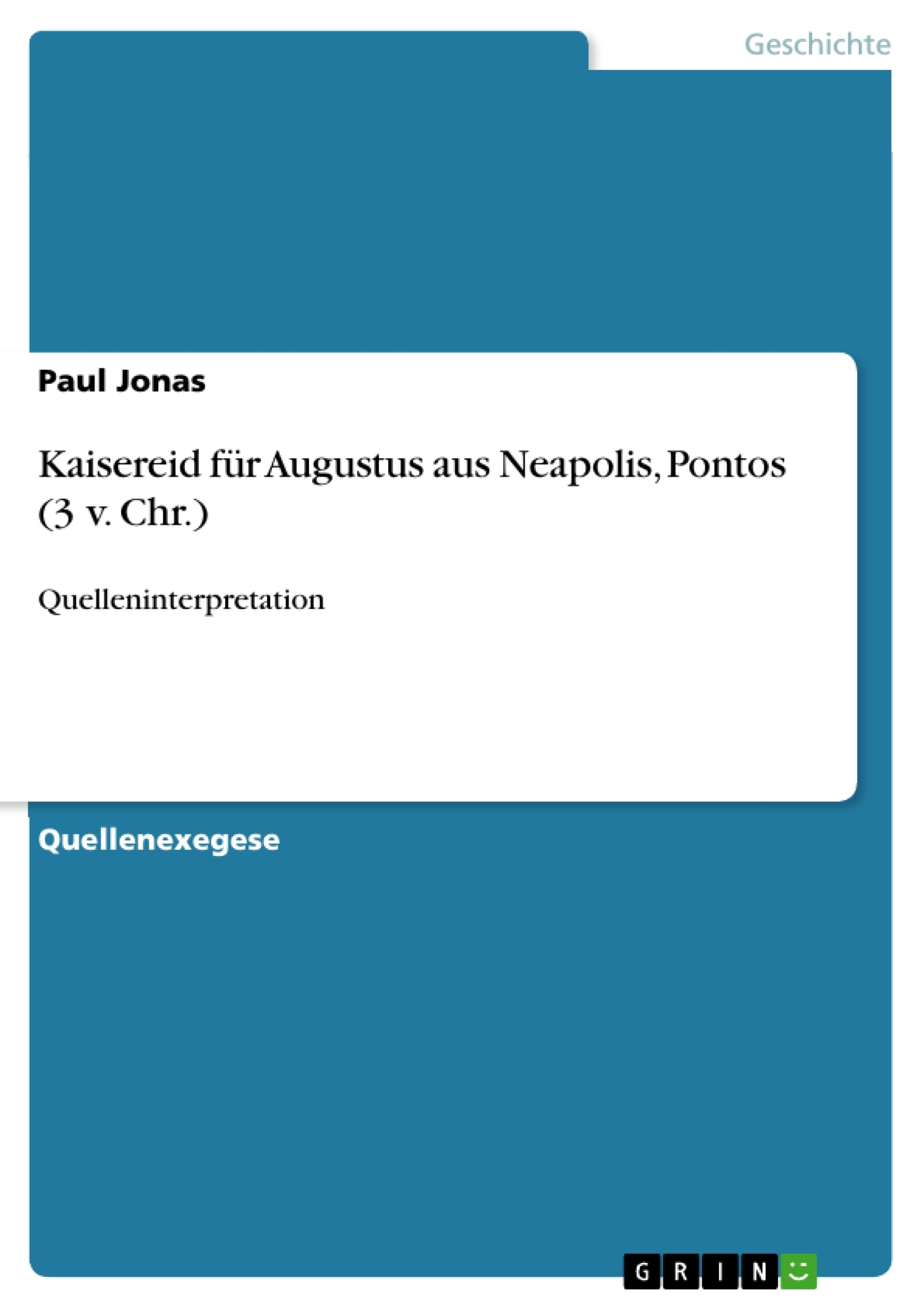In dieser Quelleninterpretation soll es um den Kaisereid im römischen Osten gehen. Als exemplarische Quelle dafür soll der Kaisereid aus der antiken Stadt Neapolis, in der ehemaligen römischen Provinz Paphlagonien, untersucht werden. Der Quellentext dafür stammt aus der vierten Sitzung des Seminars, der sich nur auf den Eid als solches konzentriert, während die weiteren Informationen zu dieser Quelle, vor allem die zur physischen Beschaffenheit, aus den Untersuchung von Aitor Blanco Pérez stammen.
Dieser Eid befände sich auf einer Stele aus Sandstein. Der Text dieses Eides wurde in ebendiese Stele gemeißelt und stände ursprünglich in der orthodoxen Kirche in der heutigen Stadt Vezirköprü,dieauchdieRuinenderehemaligenStadtNeapoliseinschließt. Die Steleseizwar beschädigt doch liegt der Text des Eides, der auf Griechisch geschrieben ist, rekonstruiert vollständig vor. Datierungsversuche beschreiben das Jahr 3 v. Chr. als den Zeitraum, in dem dieser Eid entstand und wirkte. Da dieser Eid, wie später zu sehen sein wird, sich auf Augustus bezieht, ist es zudem wichtig Augustus in den chronologischen Kontext miteinzubinden. Zu diesem Zeitpunkt war Augustus zum zwölften Mal Konsul und bereits mehrere Jahre Kaiser des römischen Imperiums.
Inhaltsverzeichnis
- Kaisereid für Augustus aus Neapolis, Pontos (3 v. Chr.)
- Der Inhalt des Eides
- Die Schwurgötter
- Die Treue für „[...] Caesar Augustus and his children and descendants all the time [...].“
- Der Fluch
- Der Kaisereid im Kontext der Reichsreligion
- Die Positionierung des Eides
- Die Bedeutung des Eides
- Die Schwurgötter und ihre Bedeutung
- Die Verehrung Augustus' als Gottheit
- Der Kaisereid und die Integration in die Reichsreligion
- Die Sprache des Eides
- Der Personenkult
- Die Auswirkungen des Fluches
- Augustus' allumfassende Macht
- Kritische Bewertung der Quelle
- Der Begriff „Religion“ in der Antike
- Nachweise zum Ritual
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Quelleninterpretation analysiert den Kaisereid für Augustus aus der antiken Stadt Neapolis in der römischen Provinz Paphlagonien, um die Rolle des Eides im römischen Osten im Kontext der Reichsreligion zu untersuchen.
- Der Inhalt und die Struktur des Kaisereides
- Die Integration des Eides in die Reichsreligion und seine Verbindung zu Augustus' Personenkult
- Die Auswirkungen des Eides auf die lokale Bevölkerung und seine Bedeutung als Instrument der Kontrolle und Integration
- Die kritische Bewertung der Quelle und die Herausforderungen bei der Interpretation antiker religiöser Praktiken
- Die Rolle des Eides im Kontext des römischen Herrscherkults und seiner kulturellen Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text stellt zunächst den Inhalt des Eides dar, der in drei Teile gegliedert ist: die Schwurgötter, die Treueerklärung für Augustus und seine Nachkommen sowie der Fluch für diejenigen, die den Eid brechen. Anschließend wird der Kaisereid im Kontext der Reichsreligion betrachtet. Dabei wird die Positionierung des Eides, seine Bedeutung als Mittel der Kontrolle und Integration sowie die Bedeutung der Schwurgötter und Augustus' Verehrung als Gottheit untersucht. Schließlich wird der Kaisereid im Hinblick auf seine kulturelle Bedeutung als Mittel der Integration einer heterogenen Peripherie in das Imperium betrachtet.
Schlüsselwörter
Kaisereid, Augustus, Reichsreligion, Personenkult, Integration, Kontrolle, Provinz, Paphlagonien, Neapolis, Schwurgötter, Fluch, Polytheismus, interpretatio, Hellenismus, Herrscherkult, Ritual.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es beim Kaisereid aus Neapolis?
Es handelt sich um einen Treueeid für Kaiser Augustus und seine Nachkommen, der im Jahr 3 v. Chr. in der Stadt Neapolis (Paphlagonien) geleistet wurde.
Welchen Inhalt hat dieser Eid?
Der Eid umfasst die Anrufung von Schwurgöttern, das Versprechen absoluter Treue gegenüber Augustus und seinen Nachkommen sowie einen Fluch für den Fall des Eidbruchs.
Welche Rolle spielt der Personenkult in diesem Eid?
Der Eid zeigt die Integration des Kaisers in die lokale religiöse Vorstellungswelt und die Verehrung Augustus' als gottgleiche Instanz.
Auf welcher Sprache wurde der Eid verfasst?
Der Text ist auf Griechisch verfasst, was typisch für den römischen Osten war.
Was war der Zweck dieses Eides für das Römische Reich?
Er diente als Instrument der Kontrolle und zur Integration der heterogenen Bevölkerung in den Peripherien des Imperiums.
Wer untersuchte die physische Beschaffenheit der Stele?
Die Untersuchungen zur Sandsteinstele stammen von dem Forscher Aitor Blanco Pérez.
- Arbeit zitieren
- Paul Jonas (Autor:in), 2018, Kaisereid für Augustus aus Neapolis, Pontos (3 v. Chr.), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442731