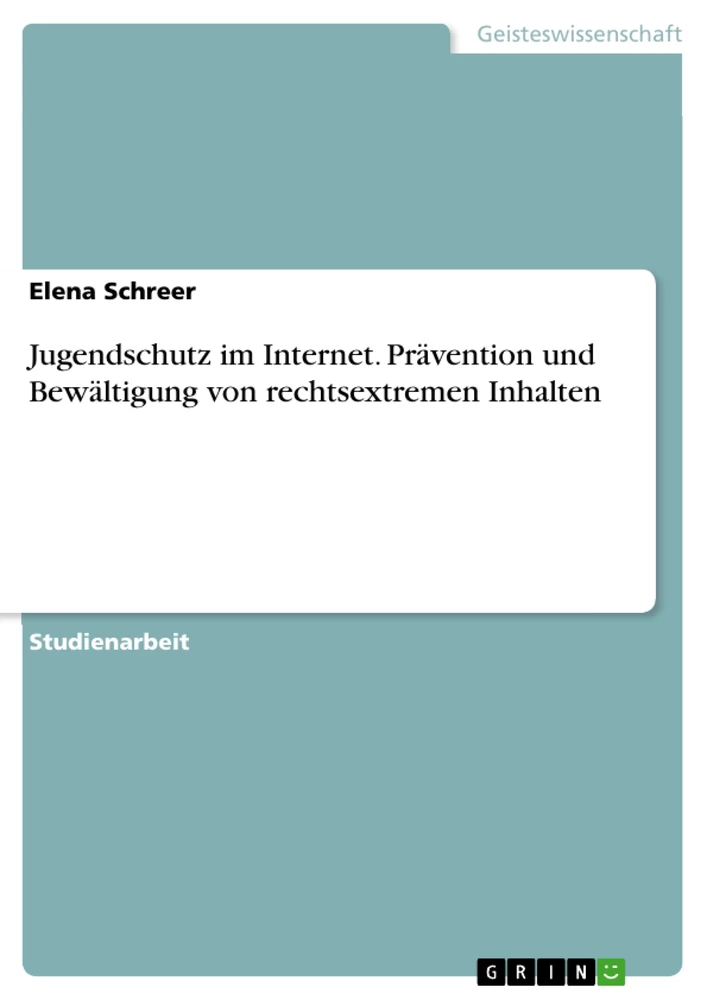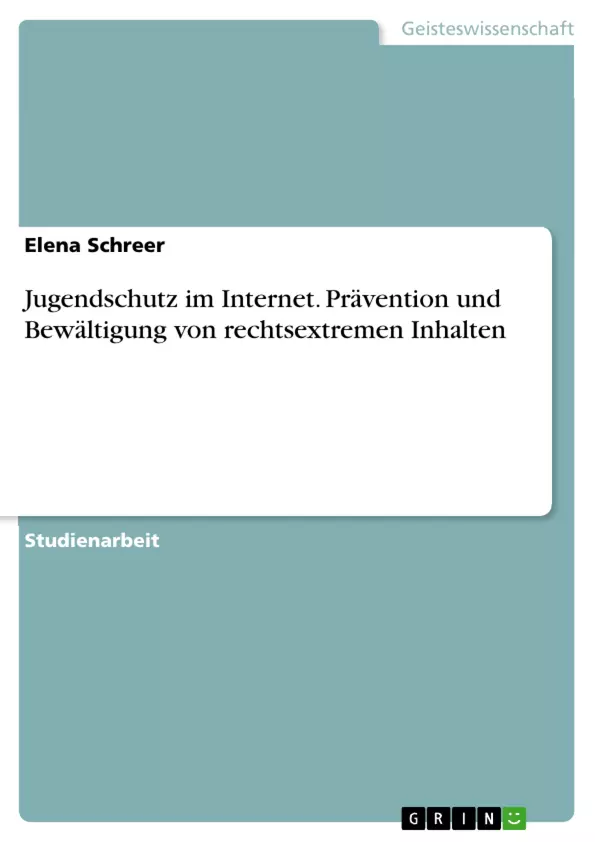Kinder und Jugendliche geraten heute schon früh in Kontakt mit dem Internet und tragen Verantwortung im Umgang mit neuen Medien. Sie haben durch das Internet Zugriff auf eine virtuelle Welt, in der viele Gefahren drohen. Weil sie unter dem Jugendschutz stehen, gelten Kinder und Jugendliche im Internet daher als besonders Schutzbedürftig. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich folgender Frage nachgehen: Wo liegt die Verantwortung für den Jugendschutz und wie kann Jugendschutz im Internet gewährleistet werden? Als Beispiel einer Gefährdung für Kinder und Jugendliche im Internet möchte ich den Rechtsextremismus thematisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzgebung zum Jugendschutz
- Jugendschutzgesetze (JSchG)
- Jugendmedienschutz – Staatsvertrag (JMStV)
- Rechtsextremismus
- Annäherung einer begrifflichen Definition
- Ideologien und Propaganda
- Das Internet als Propagandainstrument – Strategie und Zielsetzung
- Prävention
- Problematik der Strafverfolgung im Internet
- Lösungsansätze und Maßnahmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik des Jugendschutzes im Internet und beleuchtet dabei insbesondere die Gefahren durch rechtsextremistische Inhalte. Im Fokus steht die Frage nach der Verantwortung für den Jugendschutz und der Gewährleistung desselben im digitalen Raum.
- Gesetzliche Grundlagen des Jugendschutzes
- Rechtsextremismus als Gefährdungsfaktor im Internet
- Strategien und Ziele rechtsextremer Propaganda im Internet
- Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung rechtsextremer Inhalte
- Rollen und Verantwortlichkeiten im Jugendschutz
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Jugendschutz im Internet ein, thematisiert die Herausforderungen der digitalen Welt für Kinder und Jugendliche und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar.
- Das Kapitel "Gesetzgebung zum Jugendschutz" erläutert die rechtlichen Grundlagen des Jugendschutzes in Deutschland, wobei die Jugendschutzgesetze (JSchG) und der Jugendmedienschutz Staatsvertrag (JMStV) im Detail betrachtet werden.
- Das Kapitel "Rechtsextremismus" befasst sich mit der Definition und den Ideologien des Rechtsextremismus und untersucht dessen Nutzung des Internets als Propagandainstrument.
- Das Kapitel "Prävention" beleuchtet die Herausforderungen der Strafverfolgung rechtsextremer Inhalte im Internet und präsentiert Lösungsansätze und Maßnahmen zur Bekämpfung von rechtsextremistischer Propaganda.
Schlüsselwörter
Jugendschutz, Internet, Rechtsextremismus, Propaganda, Prävention, Gesetzgebung, Jugendmedienschutz, Strafverfolgung, Schutzmaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Gesetze regeln den Jugendschutz im Internet?
Die zentralen Regelungen sind das Jugendschutzgesetz (JSchG) und der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV).
Wie nutzt der Rechtsextremismus das Internet?
Das Internet dient als Propagandainstrument, um Ideologien zu verbreiten, Anhänger zu rekrutieren und Kinder sowie Jugendliche gezielt anzusprechen.
Warum sind Kinder im Internet besonders schutzbedürftig?
Da sie oft früh Zugriff auf eine virtuelle Welt mit vielfältigen Gefahren haben, aber die Risiken von Inhalten wie rechtsextremer Propaganda noch nicht voll einschätzen können.
Was sind die Herausforderungen bei der Strafverfolgung im Netz?
Die Anonymität, grenzüberschreitende Serverstandorte und die schiere Masse an Daten erschweren die effektive Bekämpfung illegaler rechtsextremer Inhalte.
Wer trägt die Verantwortung für den Jugendschutz?
Die Verantwortung ist geteilt zwischen dem Gesetzgeber, den Plattformbetreibern, Erziehungsberechtigten und pädagogischen Einrichtungen.
- Quote paper
- Elena Schreer (Author), 2017, Jugendschutz im Internet. Prävention und Bewältigung von rechtsextremen Inhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443076