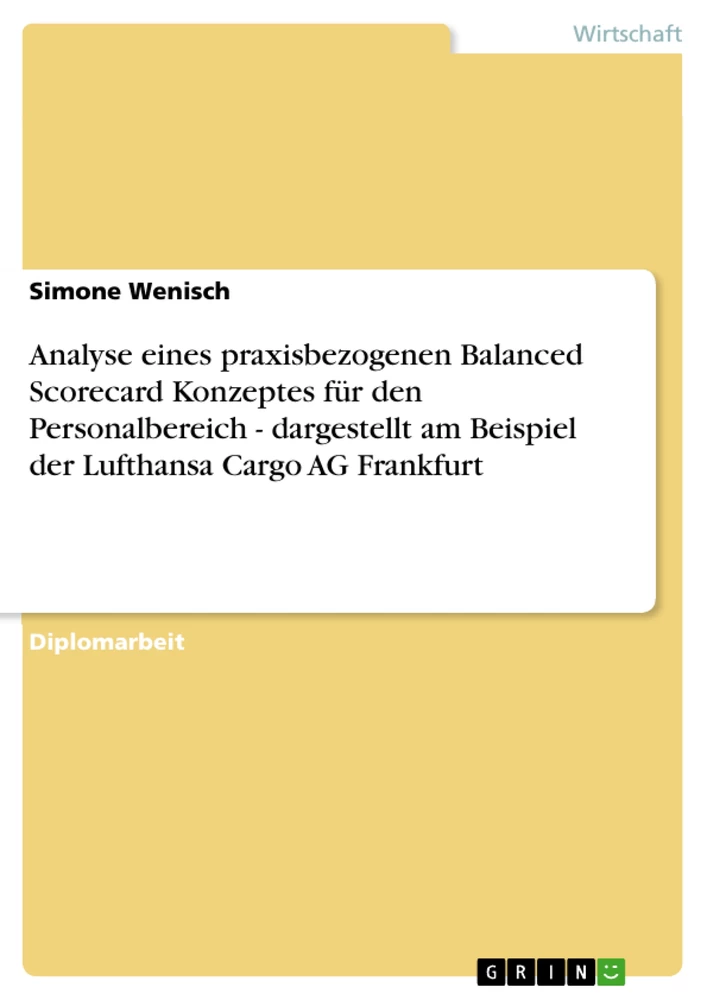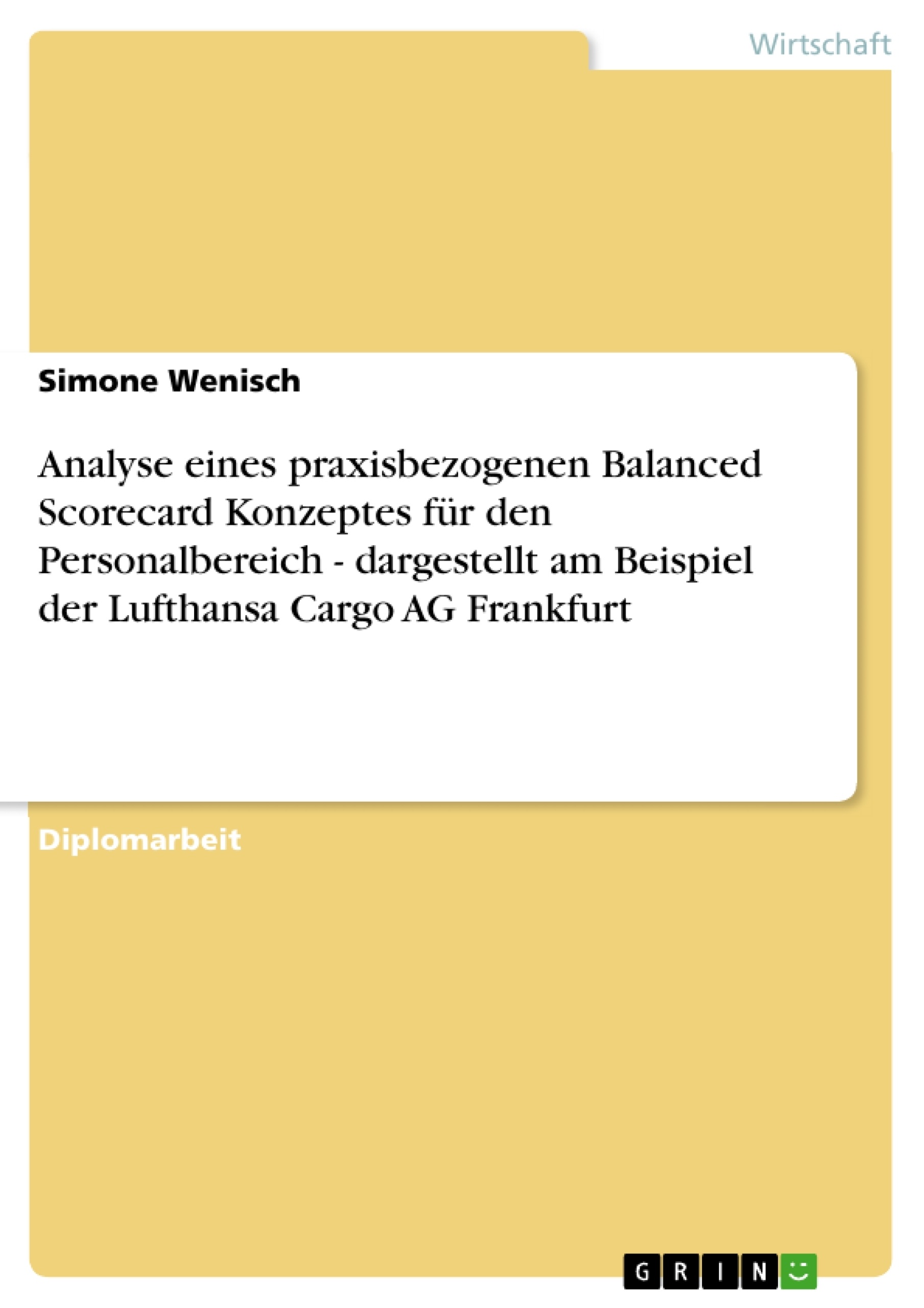In den letzten Jahren hat sich im unternehmerischen Umfeld weltweit ein tiefgreifender Wandel vollzogen. Die fortschreitende Globalisierung, der rasche technologische Wandel und die zunehmende Bedeutung des Wissens stellen traditionelle Auffassungen über Organisation, Planung und Management in Frage. Im Informationszeitalter reicht es nicht mehr aus, qualitativ hochwertige Produkte zu niedrigen Kosten in Massenproduktion zu fertigen – der Kunde möchte auf seine spezifischen Bedürfnisse maßgeschneiderte Produkte, die zudem noch innovativ und ihren Preis wert sein sollen. Um die hohen Investitionssummen für immer neue Produkte und Dienstleistungen decken zu können, gehen mehr und mehr nationale Anbieter auch auf internationale Märkte, auf denen es gilt, die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit globaler Aktivitäten mit der erforderlichen marktbezogenen Sensibilität für lokale Kunden zu kombinieren.
Was die internen Unternehmensstrukturen betrifft, so können diese Anforderungen durch prozeßorientierte Organisationsformen und funktionsübergreifendes Arbeiten bewältigt werden. Hierarchieverkürzungen, Entscheidungsdezentralisierung und Empowerment sind hierbei nur einige Schlagworte, die auf die gestiegene Bedeutung der Mitarbeiter und deren Potentiale für die Wettbewerbsfähigkeit hinweisen.
Um den Anforderungen in diesem neuen Unternehmensumfeld gerecht zu werden, wurden seit Anfang der neunziger Jahre neue qualitätsorientierte Management Techniken wie Total Quality Management (TQM), Lean Production, Business Reengineering u.ä. eingeführt. Qualitätspreise wie der Malcolm Baldrige National Quality Award wurden an diejenigen Unternehmen vergeben, die nachweisen konnten, daß sie Meßgrößen für die Gesamtheit ihrer Tätigkeiten festgelegt hatten und diese auch verwenden. Zudem vollzog sich ein Wandel von der traditionellen Unternehmenszielsetzung der Gewinnmaximierung hin zur Steigerung des Unternehmenswertes, dem sogenannten Shareholder Value. Im Shareholder Value Ansatz bestimmt sich der ökonomische Wert einer Investition dadurch, daß die zukünftig erwarteten Cash-flows mit Hilfe eines Kapitalkostensatzes diskontiert werden. Bei der Beurteilung möglicher Strategien steht demnach die Frage im Vordergrund, welche Alternative die in diesem Sinne höchste ökonomische Rendite für die Anteilseigner verspricht.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Hintergrund und Problemstellung
- Zielsetzung der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- BALANCED SCORECARD
- Balanced Scorecard - Ein Instrument des Performance Measurement
- Mit vier Perspektiven zu einem integrierten System der Leistungsmessung
- Ausgewogenheit der Balanced Scorecard
- Balanced Scorecard – Ein Instrument der strategischen Unternehmensführung
- Balanced Scorecard in der Praxis
- Vorgehensweise beim Aufbau einer Balanced Scorecard
- Möglichkeiten der Balanced Scorecard Anwendung
- Diskussion: Eignung der Balanced Scorecard für den Personalbereich
- BALANCED SCORECARD IM PERSONALBEREICH
- Rahmenbedingungen der Personalarbeit und die neue Rolle des Personalwesens
- Mögliche Ausgestaltung von Perspektiven einer Balanced Scorecard im Personalbereich
- Ausgestaltung einer Personalbereichs-Scorecard nach Ulrich
- Ausgestaltung einer Personalbereichs-Scorecard nach Kaplan/Norton
- Diskussion: Barrieren der bisherigen Anwendung der Balanced Scorecard im Personalbereich
- DIE BALANCED SCORECARD IM PERSONALBEREICH DER LUFTTHANSA CARGO AG, FRANKFURT
- Unternehmensprofil Lufthansa Cargo AG
- Allgemeine Informationen
- Unternehmensphilosophie
- Unternehmensstrategie
- Personalbereich Personal & Recht
- Ausgangslage und Vorgehen der Analyse
- Beweggründe zur Einführung der Balanced Scorecard aus Sicht des Personalbereichs Personal & Recht
- Vorhandene Daten
- Vorgehensweise der Analyse
- Ausgestaltung der Balanced Scorecard für den Personalbereich Personal & Recht
- Zentrale Elemente
- Perspektiven und Kennzahlen der Balanced Scorecard für den Personalbereich Personal & Recht
- Problemfelder bei der Entwicklung der Balanced Scorecard bei Personal & Recht
- Kommunikation und Engagement der Mitarbeiter
- Formulierung der Bereichsvision Personal & Recht
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit analysiert die Eignung und Anwendung eines Balanced Scorecard Konzeptes im Personalbereich, dargestellt am Beispiel der Lufthansa Cargo AG Frankfurt. Sie untersucht die Relevanz des Balanced Scorecard Ansatzes für die strategische Unternehmensführung und die Steuerung des Personalwesens.
- Entwicklung eines praxisbezogenen Balanced Scorecard Konzeptes für den Personalbereich
- Analyse der Möglichkeiten und Herausforderungen der Balanced Scorecard Implementierung im Personalbereich
- Bewertung der Eignung des Balanced Scorecard Ansatzes zur Steuerung des Personalwesens
- Untersuchung der Anwendung der Balanced Scorecard im Personalbereich der Lufthansa Cargo AG
- Identifizierung von Best-Practice-Beispielen und Erfolgsfaktoren für die Implementierung von Balanced Scorecards im Personalbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Balanced Scorecard und deren Bedeutung im Kontext des Performance Measurement. Die Kapitel zwei und drei untersuchen die Anwendungsmöglichkeiten des Balanced Scorecard Ansatzes im Personalbereich. Kapitel drei fokussiert auf die Rahmenbedingungen der Personalarbeit und die Rolle des Personalwesens im Unternehmen. Es werden verschiedene Ausgestaltungen von Perspektiven einer Balanced Scorecard im Personalbereich vorgestellt, wie zum Beispiel nach Ulrich und Kaplan/Norton. Kapitel vier beleuchtet die Anwendung der Balanced Scorecard im Personalbereich der Lufthansa Cargo AG und analysiert die Herausforderungen bei der Implementierung.
Schlüsselwörter
Balanced Scorecard, Performance Measurement, Personalbereich, Strategische Unternehmensführung, Human Resources, Lufthansa Cargo AG, Kennzahlensystem, Personalmanagement, Dienstleistungsprozesse, Wissensmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Balanced Scorecard (BSC) im Personalbereich?
Es ist ein Instrument zur Leistungsmessung und strategischen Steuerung, das finanzielle Kennzahlen um Perspektiven wie Kunden, Prozesse und Mitarbeiter erweitert.
Welche Vorteile bietet die BSC für Human Resources?
Sie hilft, die Personalarbeit an der Unternehmensstrategie auszurichten und den Wertbeitrag der Mitarbeiter (Human Capital) messbar zu machen.
Wie setzte Lufthansa Cargo die BSC im Bereich Personal & Recht ein?
Die Arbeit analysiert die spezifische Ausgestaltung von Kennzahlen und Perspektiven, um die Effizienz der Dienstleistungsprozesse bei Lufthansa zu steuern.
Was sind die Barrieren bei der Einführung einer HR-Scorecard?
Herausforderungen liegen oft in der Formulierung einer klaren Bereichsvision, dem Engagement der Mitarbeiter und der Auswahl geeigneter Kennzahlen.
Was ist der Unterschied zwischen den Ansätzen von Ulrich und Kaplan/Norton?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Modelle der Perspektivgestaltung, wobei Ulrich stärker auf Rollen im Personalwesen fokussiert, während Kaplan/Norton die klassische BSC-Struktur nutzen.
- Citar trabajo
- Simone Wenisch (Autor), 2000, Analyse eines praxisbezogenen Balanced Scorecard Konzeptes für den Personalbereich - dargestellt am Beispiel der Lufthansa Cargo AG Frankfurt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4432