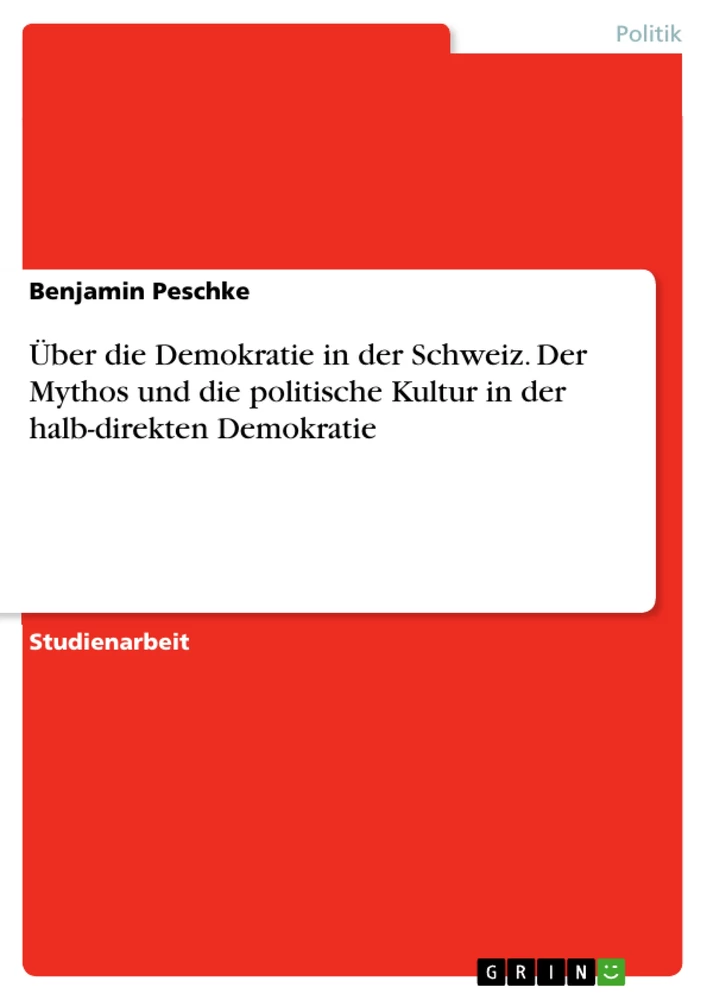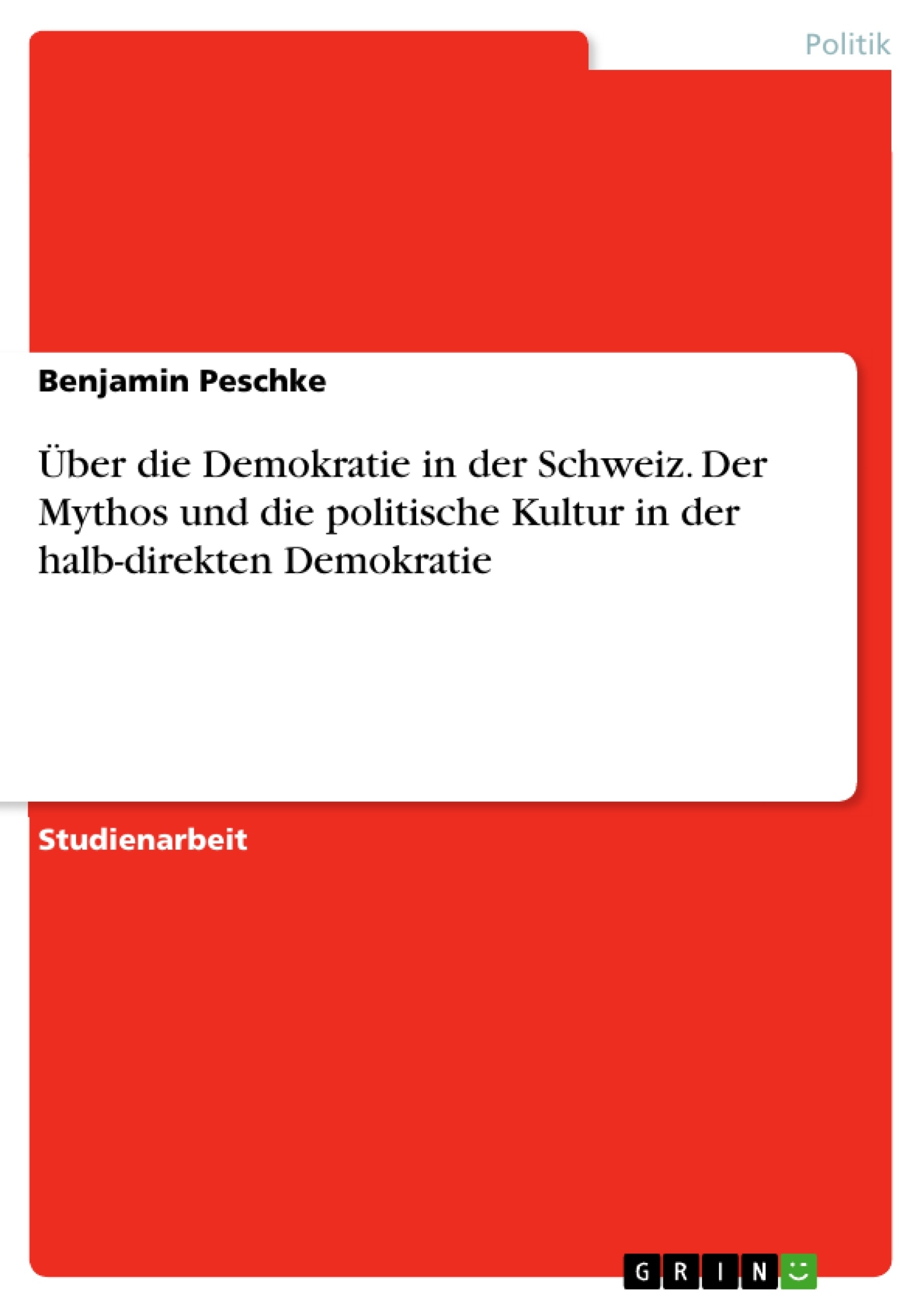Der Titel dieser Hausarbeit an Anlehnung zu Alexis de Tocquevilles Vortrag „Bericht über die Demokratie in der Schweiz“ und seinem Hauptwerk „Über die Demokratie in Amerika“ ist nicht nur zufällig gewählt. Da diese Arbeit im Rahmen eines Blockseminars verfasst wurde und unser Seminar die Möglichkeit hatte die Schweiz zu besuchen, um vor Ort Wissen zu erarbeiten und in einem begrenzten Rahmen auch Erfahrungen zu sammeln, sollen diese durchaus in die Hausarbeit einfließen. Natürlich ist unser Kurzaufenthalt in der Schweiz nicht mit Tocquevilles Reisen durch Amerika, bei der seine umfassenden Analysen des politischen Systems entstanden sind, zu vergleichen. Deshalb kann natürlich auf die übliche Arbeit mit wissenschaftlicher Lektüre nicht verzichtet werden. Die Arbeit soll einen Überblick über das politische System der Schweiz, dem Demokratieverständnis der Schweizer und dem Mythos der Entstehung der Schweiz verschaffen. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf der politischen Kultur in der Schweiz liegen. Wie ist diese Kultur, die stark mit der Möglichkeit, der direkten Einflussnahme der Stimmbürger zusammenhängt entstanden? Eine politische Kultur und Tradition die einen einzigartigen Sonderweg der halb-direkten Demokratie für die Schweiz ermöglichte. Wie haben die weit reichenden Mitbestimmungsrechte die politische Kultur und das Demokratieverständnis beeinflusst? Der Ursprung des Titels liegt jedoch nicht nur in unserer „Bildungsreise“, sondern auch im Vorhaben, in dieser Seminararbeit Vergleiche zwischen Tocquevilles Analyse von Mehrheitsentscheidungen im Amerika des 19. Jahrhunderts und den üblichen Mehrheitsentscheidungen in der heutigen Schweiz zu ziehen. Befördern direkte Demokratie, Volksreferenden und das Beharren auf einem statischen Konkordanzsystem nicht eine „Tyrannei der Mehrheit“ in Tocqevilles Sinne? Wie steht es um den Minderheitenschutz in der Schweiz? Wie weit reicht der Einfluss von Interessenverbänden und Medien? Das sind Fragen die diese Hausarbeit beantworten will, immer im Bezug auf Tocquevilles Hinweise auf Gefahren der Mehrheitsdemokratie und seinen Analysen, zur Beeinflussung der Mehrheit von einer herrschenden öffentlichen Meinung. Was die direkte Entscheidungsmöglichkeit angeht, haben gerade die Schweiz und die USA einen Sonderstatus. Obwohl in den USA diese Möglichkeiten sehr begrenzt und meist auf kommunaler Ebene ihre Wirkung entfalten. Trotzdem sind die direkten Volksrechte in diesen beiden Ländern traditionell verankert:
Inhalt
Einleitung
Der Mythos Schweiz
Die Gründung der Eidgenossenschaft
Die demokratische Tradition
Freiheit aus Frankreich?
Der Mythenkult
Föderalismus und direkte Demokratie
Bundesstaatlichkeit
Gefühlter Föderalismus
Föderalismus in der Praxis
Direkte Demokratie
Direkte Demokratie auf Bundesebene
Direkte Demokratie auf Kantonsebene
Bewertung der direktdemokratischen Elemente
Direkte Demokratie: „Tyrannei der Mehrheit“ oder starke Demokratie?
Einfluss der Interessenverbände und Medien
Die Interessenverbände
Die Medien
„Tyrannei der Mehrheit“
Schluss - Demokratie als Grundhaltung?
Literaturverzeichnis
Einleitung
Der Titel dieser Hausarbeit an Anlehnung zu Alexis de Tocquevilles Vortrag „Bericht über die Demokratie in der Schweiz“ und seinem Hauptwerk „Über die Demokratie in Amerika“ ist nicht nur zufällig gewählt. Da diese Arbeit im Rahmen eines Blockseminars verfasst wurde und unser Seminar die Möglichkeit hatte die Schweiz zu besuchen, um vor Ort Wissen zu erarbeiten und in einem begrenzten Rahmen auch Erfahrungen zu sammeln, sollen diese durchaus in die Hausarbeit einfließen. Natürlich ist unser Kurzaufenthalt in der Schweiz nicht mit Tocquevilles Reisen durch Amerika, bei der seine umfassenden Analysen des politischen Systems entstanden sind, zu vergleichen. Deshalb kann natürlich auf die übliche Arbeit mit wissenschaftlicher Lektüre nicht verzichtet werden. Die Arbeit soll einen Überblick über das politische System der Schweiz, dem Demokratieverständnis der Schweizer und dem Mythos der Entstehung der Schweiz verschaffen. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf der politischen Kultur in der Schweiz liegen. Wie ist diese Kultur, die stark mit der Möglichkeit, der direkten Einflussnahme der Stimmbürger zusammenhängt entstanden? Eine politische Kultur und Tradition die einen einzigartigen Sonderweg der halb-direkten Demokratie für die Schweiz ermöglichte. Wie haben die weit reichenden Mitbestimmungsrechte die politische Kultur und das Demokratieverständnis beeinflusst? Der Ursprung des Titels liegt jedoch nicht nur in unserer „Bildungsreise“, sondern auch im Vorhaben, in dieser Seminararbeit Vergleiche zwischen Tocquevilles Analyse von Mehrheitsentscheidungen im Amerika des 19. Jahrhunderts und den üblichen Mehrheitsentscheidungen in der heutigen Schweiz zu ziehen. Befördern direkte Demokratie, Volksreferenden und das Beharren auf einem statischen Konkordanzsystem nicht eine „Tyrannei der Mehrheit“ in Tocqevilles Sinne? Wie steht es um den Minderheitenschutz in der Schweiz? Wie weit reicht der Einfluss von Interessenverbänden und Medien? Das sind Fragen die diese Hausarbeit beantworten will, immer im Bezug auf Tocquevilles Hinweise auf Gefahren der Mehrheitsdemokratie und seinen Analysen, zur Beeinflussung der Mehrheit von einer herrschenden öffentlichen Meinung. Was die direkte Entscheidungsmöglichkeit angeht, haben gerade die Schweiz und die USA einen Sonderstatus. Obwohl in den USA diese Möglichkeiten sehr begrenzt und meist auf kommunaler Ebene ihre Wirkung entfalten. Trotzdem sind die direkten Volksrechte in diesen beiden Ländern traditionell verankert:
„Dies ist beispielsweise in der Schweiz, aber auch auf den Ebenen der nachgeordneten Gebietskörperschaften in den USA in besonders starkem Ausmaßder Fall. Die Bürger haben in diesen beiden Ländern in stärkerem Maße die Möglichkeit, Sachfragen direkt zu entscheiden.“ (Schiller/Mittendorf 2002, S.88)
Im vierten Kapitel sollen eventuelle Gefahren der direkten Entscheidungsmöglichkeit mit besonderem Augenmerk auf die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch Medien und Interessengruppen analysiert, bestätigt oder entkräftet werden. Das folgende Kapitel soll den Leser darüber aufklären in wie weit die Schweiz und die Schweizer, deren nationale Identität und Demokratieverständnis von Mythen und historischen Entwicklungen geprägt ist, wie diese entstanden sind und warum sie immer noch in der Schweiz eine große Rolle spielen.
Der Mythos Schweiz
„Unter Mythos verstehen wir die Vorstellung, die sich die Schweizer seit jeher von ihrem Land, von seiner Staats- und Gesellschaftsform, von seiner Rolle in der Welt gemacht haben; eine Vorstellung, die stets – bei aller Konstanz – dem Wandel der Zeitläufe unterworfen war“ (Im Hof 1991, S. 11).
Die Schweiz ist seit ihrer mythologischen „Entstehung“ im 13. Jahrhundert bis heute geprägt von Mythen und Sagen. Schon die Gründungsgeschichte des eidgenössischen Bundes, samt Bundesbrief und Rütlischwur ist umwoben von historischen Unwahrheiten, Mythen und Erzählungen. Das sich diese Sagen entwickelt und auch solange im Volksbewusstsein gehalten haben, hat natürlich mit Schwierigkeiten in der geschichtlichen Überlieferung aus dem 13. Jahrhundert zu tun, aber auch, und das ist die eigentliche Besonderheit an den schweizerischen Mythen, mit der Angewohnheit der Schweizer, diese Mythen zu pflegen. In der Geschichte der Schweiz wird immer wieder auf die alten Sagen zurückgegriffen. Sie werden nach vorherrschender politischer Situation funktionalisiert, ausgeweitet, ab und zu teilweise wieder revidiert und dazu gezielt benutzt, um Nationalgefühl und gemeinsame Identität, vor allem in Krisenzeiten zu stärken:
„Während des Zweiten Weltkrieges erlebte die „glorreiche“ nationale Geschichte eine Renaissance. Man belebte den eidgenössischen Mythos, um damit den Widerstandswillen zu stärken.“ (Wittmann 1998, S. 93)
Das Beispiel zweiter Weltkrieg macht klar, dass es die nationale Identität der Schweizer in der Geschichte immer wieder neu zu bestärken galt. Der Rückgriff auf gemeinsame Mythen, die auch immer gemeinsame Wertvorstellungen beinhalten war brauchbar, um den Zusammenhalt der ethnisch, konfessionell und sprachlich differenten Volksgruppen in der Schweiz zu gewährleisten. In unserem Seminar kam häufig die Frage auf, ob ein solcher Gründungsmythos auch in unserer „entzauberten“ Welt, für die Schweiz heute noch nötig ist, um dem Bundesstaat ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen. Dabei muss man feststellen, dass die Schweiz zwar mit der historischen Aufklärung und „Entzauberung“ der Sagen, vor allem der Tell-Sage immer wieder gehadert hat, und dies wohl in gewissem Maße heute noch tut (Vgl. Im Hof 1991, S. 273). Der Zusammenhalt und die nationale Identität, haben sich trotz der Unterschiede über die Jahrhunderte jedoch so verfestigt hat, dass der „eidgenössische Bund“ wohl kaum in Gefahr gerät auseinander zu brechen. Fraglich ist hierbei, ob es zum Beispiel für die Europäische Union als föderaler Staatenbund betrachtet, einen solchen Zusammengehörigkeitsmythos geben muss, um ein supranationales Bewusstsein mit der Zeit zu entwickeln. Dafür könnte die Schweiz ein Beweis sein. Die historischen, politischen und gesellschaftlichen Umstände der Gründung und Entstehung der EU sind allerdings völlig andere, als die der „Gründung“ der Schweiz. Bei dem folgenden Überblick der für diese Arbeit wichtigen Mythen halte ich mich zwar an die Kapitelüberschriften von Wittmann (Vgl. Wittmann 1998), weil seine historische Zusammenfassung brauchbar ist, der wirtschaftliche Schwerpunkt seines Buches ist für diese Arbeit unerheblich.
Die Gründung der Eidgenossenschaft
„Der Mythos will wissen, dass die schweizerische Existenz mit dem Bundesbrief von 1291 begonnen habe. Wir sind uns dabei jedoch wohl bewusst, dass die schweizerische Eidgenossenschaft sich erst im Laufe des 15. Jahrhunderts als „Nation“ unter die anderen europäischen „Nationen“ begeben hat“ (Im Hof 1991, S.11).
Der eigentliche Kern des Gründungsmythos ist die Annahme, die teilweise von konservativen Kräften in der Schweiz immer noch verteidigt wird, dass es sich bei der Gründung um einen einmaligen Akt handelte, dem der Bundesbrief von 1291 als Gründungsurkunde diente. Weder gab es einen solchen Gründungsakt, noch ist der Bundesbrief als Staatsgründungsurkunde oder Verfassung anzuerkennen. Die Eidgenossenschaft und das schweizerische föderale System entstanden nach und nach über Jahrhunderte hinweg. Die Bundesbriefe von 1291 oder von 1315 enthalten keine staatskonstituierenden Elemente, sondern stellen eher Verteidigungsbündnisse dar. Sie regeln hauptsächlich das Verhalten der teilnehmenden Parteien bei Verteidigungsfall und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung und Verurteilung von Straftätern:
„Und auf jeden Fall hat jede Gemeinde der andern Beistand auf eigene Kosten zur Abwehr und Vergeltung von böswilligem Angriff und Unrecht eidlich gelobt in Erneuerung des alten, eidlich bekräftigten Bundes, — jedoch in der Weise, dass jeder nach seinem Stand seinem Herren geziemend dienen soll.“ (Der Bundesbrief von 1291)
Der Rückgriff auf einen „alten Bund“, stellt außerdem einen Hinweis im Bundesbrief dar, dass es sich wohl bei dem Vertrag von 1291 nicht um die Erste und auch nicht um eine einmalige Vereinbarung handelte, sondern es wohl durchaus üblich war solche Übereinkommen zwischen den Ländern und Gebieten zu treffen. Die Bundesbriefe sind natürlich wichtige Dokumente, die das langsame Entstehen eines föderalen Systems historisch belegen. Ihre symbolische und mythologische Aufladung als Gründungsdokumente der Schweiz erfuhren sie erst sehr viel später. Trotz dieser Tatsachen über den Charakter der Bundesbriefe oder der Entstehung der Eidgenossenschaft hält die symbolische Bedeutung der Gründungssage und der Bundesbriefe kontinuierlich an und wird auch heute noch in der Schweiz immer wieder zum Politikum. Die Bedeutung dieser historischen Dokumente wird zum Beispiel im Jahr 2006 an einer nebensächlichen Diskussion, in der Schweiz sichtbar. Anhänger der rechts-konservativen Schweizer Volkspartei (SVP) forderten, dass der original Bundesbrief das Land nicht für eine geplante Ausstellung in Amerika verlassen darf, da sie befürchten, er könnte einem Flugzeugabsturz oder einem Raub zum Opfer fallen:
„Die Schwyzer Regierung hat das Ansinnen umgehend abgelehnt. Beim Bundesbrief handle es sich um einen Grundpfeiler der Nation, sagte Mörgeli am Dienstag vor den Medien. Und ausgerechnet dieses Dokument soll auf Betreiben des Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) im Juni ans Amerikanische Museum für Verfassungsgeschichte in Philadelphia ausgeliehen werden. Dafür erhielt das EDA bereits die Erlaubnis des Kantons Schwyz, der Eigentümer des Bundesbriefes ist“ (SF - Schweizer Fernsehen 2006).
Der Streit um den Bundesbrief und dessen Behandlung als „normales“ Museumsstück zeigt, dass der Brief für viele Schweizer eben mehr ist als ein Dokument aus dem 13. Jahrhundert. Trotz des eher weniger bedeutenden Inhalts wurde das Papier durch den Mythos, symbolisch und ideell aufgeladen. Er steht für gesellschaftliche Werte, die in Wirklichkeit erst später entstanden sind. Allerdings muss man auch alle Dimensionen einer solchen Diskussion erkennen. Sie zeigt zum einen das schwierige Spannungsverhältnis zwischen den Kantonen und dem Bund, wobei die SVP-Regierung des Kantons Schwyz sich natürlich vom Bund nicht vorschreiben lassen will, wie sie mit „ihrem“ Bundesbrief zu verfahren habe. Zum anderen wird natürlich das konservative Weltbild und Aversionen gegen die USA der SVP deutlich, die hier versucht den „Werteverfall“ in der Schweiz anhand des Umgangs mit einem nationalen „Heiligtum“ aufzuzeigen. Der Bundesbrief wurde trotz der Aufregung nach Philadelphia verschickt, ausgestellt und ist heil wieder im Bundesbriefmuseum in Schwyz angekommen. Auch die Initiative des SVP-Abgeordneten Mörgeli den Bundesbrief zu seinem eigenen Schutz für 1.000.000 Franken zu kaufen hatte keinen Erfolg.
Die demokratische Tradition
Wittmann hat zwar recht, dass im „dreizehnten/vierzehnten Jahrhundert keine kollektive Meinungsbildung, die zu demokratischen Entscheidungen geführt hätten“, gab und „das Volk nicht involviert war.“ (Wittmann 1998, S.77f) Natürlich kann man die Schweiz vor 1798 nicht als Demokratie in heutigem Sinne bezeichnen. Auch jegliche freiheitliche Tradition fehlte. Dennoch muss man anerkennen, dass es in der Schweiz schon seit dem 15. Jahrhundert demokratische Elemente in den Ländern gibt. Diese Entwicklung begann im 13. Jahrhundert und prägte damit das kommunale Bewusstsein und das Selbstverständnis der Landsleute als Bewohner von freien, selbst verwalteten Ländern. Die Landsgemeinden bestimmten den politischen Alltag. Dort wurde demokratisch über die Entscheidungen in den Ländern abgestimmt. Ein Mythos ist, (1.), dass die Schweiz die älteste Demokratie der Welt sei, weil der Begriff zur mittelalterlich, feudalistischen Schweiz einfach nicht passen will, und (2.) die Möglichkeit echter Einflussnahme auf die Zusammensetzung der politischen Führung:
„Selbstverständlich liegt die Führung stets bei den Eliten, der „Obrigkeit“, der „erberkeit“. Die Eliten sind in die kommunale Welt eingebettet. Möglicherweise wäre für die Welt der Landleute der Begriff „Patriarchaldemokratie“ zutreffend“ (Im Hof 1991, S.21)
Es gibt also keinen Zweifel daran, dass die Schweiz, oder besser die schweizerischen Gebiete und Länder auf eine lange demokratische Tradition zurückschauen können. Die Ideen von individueller Freiheit, nationaler Einheit und Gleichheit im heutigen Sinne, auch in der Schweiz erst nach der französischen Revolution aufkamen. Mit der Besetzung der Schweiz durch die Revolutionsarmee Napoleons 1798 hielten sie Einzug. Bis dahin wurden die häufigen Revolten und Aufstände von Untertanen in den durch „interne Kolonialisierung“ von anderen Volksstämmen besetzten Gebieten genauso blutig niedergeschlagen wie andernorts auch. (Vgl. Wittmann 1998, S. 82f)
Freiheit aus Frankreich?
„Frei wären die Schweizer? frei diese wohlhabenden Bürger in den verschlossenen Städten? frei diese armen Teufel an ihren Klippen und Felsen? Was man den Menschen nicht alles weis machen kann, besonders wenn man so ein altes Märchen in Spiritus aufbewahrt! Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frei denken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Märchen immer fort, man hört bis zum Überdruss, sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sitzen sie hinter ihren Mauern, eingefangen von ihren Gewohnheiten und Gesetzen, ihren Fraubasereien und Philistereien, und da draussen auf den Felsen ist’s auch wohl der Mühe wert, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Murmeltier gefangen gehalten wird.“ (Johann Wolfgang von Goethe, zitiert in: Im Hof 1991, S.124f)
Das Goethe Zitat zeigt anschaulich das Spannungsverhältnis zwischen Mythos, dessen Freiheitsanspruch, und der vom Dichter wahrgenommenen Realität in der Schweiz. Der Mythos beginnt mit der Aufklärung auch im europäischen Ausland, wo die Schweiz lange Zeit bewundert wurde, zu bröckeln. Der dritte Satz vom „Märchen in Spiritus“ belegt auch, dass Intellektuelle im 18. Jhdt. das freie Bergvolk ohne Herrscher, bereits als Mythos identifiziert haben. Über die Frage, ob nun die Franzosen und ihre Revolutionsarmee 1798 die Freiheit mit sich brachten, lässt sich streiten. Man muss hierbei wohl zwischen politischer Freiheit und Unabhängigkeit der Schweiz als Nation und der individuellen, naturrechtlich begründeten Freiheit des Einzelnen, in dem komplizierten Verbund aus Ländern und Gebieten unterscheiden. Die alte Eidgenossenschaft, also das alte quasi-föderale System mit seinen Herrschaftsverhältnissen wurde durch die Besatzung aufgelöst. (Vgl. Im Hof 1991, S.113) Somit war die Schweiz als Nation oder Staat, soweit man zu dieser Zeit davon Sprechen konnte besetztes Gebiet und politisch abhängig, also unfrei. Dennoch machte die neue helvetische Republik unter französischer Besatzung andere Angebote an die Schweizer ihre Herrschaftsverhältnisse zu organisieren. In diesen Jahren änderte sich die nationale Identität der Schweizer: „L’universalité des citoyens est le souverain…“(Im Hof 1991, S.114) kann man in der neuen Verfassung lesen. „Das war das Selbstverständnis der „Revolutionäre“. […] So manifestierte sich ein befreites ehemaliges Untertanenland.“ (Im Hof 1991, S.114f) Die Besatzung befreit die Individuen in ihrem Denken und bringt anstatt der Ständegesellschaft mit geringem Mitspracherecht der Bürger das Prinzip der naturrechtlichen Gleichheit der Individuen, welches auch in der Schweiz tief greifende gesellschaftliche Folgen hatte. Die Analyse der gesellschaftlichen Folgen von Gleichheit ist eines der Hauptthemen in Alexis de Tocquevilles Buch „Über die Demokratie in Amerika“. Er hat am Beispiel der Vereinigten Staaten die Auswirkungen der Gleichheit auf die Individuen und die Zusammenhänge von Gleichheit und Freiheit eingehend untersucht. Nach Tocqeville weckt die „Gleichheit im Menschen ganz natürlich den Sinn für freiheitliche Institutionen“ (Tocqueville 2004, S. 306). Man kann durchaus behaupten, dass die französische Revolutionsarmee die politische Freiheit wohl nur scheinbar brachte, jedoch die revolutionäre Idee der Freiheit, auch durch das Prinzip der Gleichheit - welches durch die Franzosen konstitutionell festgeschrieben wurde und damit auch die künftigen Verfassungen der Schweiz und ihrer Kantone prägen sollte - erst durch die Besatzung den Weg in die Köpfe der Schweizer fand. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem über Mythen transportierten Freiheitsgedanken und dem der französischen Revolution. Die Vorstellung vom „freien Schweizer“ der alten Eidgenossenschaft war zwar die Grundlage der demokratischen, freien Schweiz und ermöglichte durchaus in den Menschen ein grundlegendes Bewusstsein für politische Partizipation, scheiterte aber oft an der Realität und den aristokratischen Strukturen. Die Idee der individuellen Freiheit und Gleichheit der französischen Revolution, die eben „[…] jene noch undeutliche Vorstellung von Freiheit und jenen instinktiven Freiheitsdrang in Geist und Herz jedes Menschen pflanzt […]“ (Tocqeuville 2004, S.307). Sie konnte sich später auch in der Realität durchsetzen, weil sie die Gesellschaft auf lange Sicht strukturell veränderte. Nach der französischen Besatzung, machte die Schweiz aus demokratischer Sicht erstmal einen Schritt zurück. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die französische Meditationsakte gestürzt und die Strukturen vor 1798 so gut es ging wieder reanimiert. Tocqueville schreibt darüber in seinen Bericht über die Schweiz:
„Überall übernahmen die alten aristokratischen Kreise wieder die Zügel der Regierung und setzten die überalterten Privilegien, die vor der Revolution geherrscht hatten, wieder in Kraft.“ (Tocqueville 2005, S.449f)
Um die Illusion der ältesten „Demokratie der Welt“ in den Köpfen vollends zu zerstören stellt er über die Restauration in der Schweiz ernüchternd fest:
„[…] war diese dort umfassender, blinder und hartnäckiger als im übrigen Europa. Sie zeigte sich nicht tyrannisch, trat aber wohl alternativlos auf. […], das Volk [war] insgesamt vom politischen Leben getrennt: Diesen Anblick bot die Schweiz in fast allen ihren Teilen bis 1830. Da eröffnete sich ihr die neue Ära der Demokratie!“ (Tocqueville 2005, S. 450)
Der Mythenkult
Sagen, Symbole und Mythen wurden zu einem wichtigen Mittel der aristokratischen Restauration. Sie sollten in dem durch Besatzung und ethnisch bzw. konfessionellen Konflikten zerrütteten Land, eine neue nationale Identität stiften. Der Rückgriff auf Altbewertes war also nahe liegend. 1803 entstand die neue „Schweizer Eidgenossenschaft“ mit ihren föderalen Kantonsstrukturen.
„Begierig löschten die wiedererstandenen Kantone jegliche Erinnerung an die Helvetik bzw. französische Herrschaft. 1803 sah auch erneut die alten Hoheitszeichen, Fahnen, Wappen und Farben der Kantone.“ (Im Hof 1991, S.152)
Ein Rückgriff auf die alten Mythen war notwendig, um den Einigungsprozess zu ermöglichen und den teils neu entstandenen Kantonen eine eigene einheitliche Identität zu verleihen. Was aufgrund konfessioneller und historischer Gemeinsamkeiten der neu zusammengefügten Landesteile und der erwähnten straffen aristokratischen Herrschaft, unter Ausschluss der Mehrheit der schweizerischen Bevölkerung, relativ schnell gelang. Zur Einigung eines zersplitterten und mehrsprachigen Gebildes zu einem Nationalstaat, war es hilfreich gemeinsame Geschichte und Werte, auch wenn sie sich in Mythen äußerten und manifestierten, ins nationale Bewusstsein der Eidgenossen zu rufen.
Auch bei der Erfindung und Postulierung der so genannten „Geistigen Landesverteidigung“, zur nationalen Einigung zum Widerstand und zur Verteidigung der Schweiz gegen das nationalsozialistische Deutschland und Italien in den 1930er Jahren, war der Rückgriff auf die Geschichte wieder ein geeignetes Mittel verschiedene politische Strömungen unter diesem Stichwort zu vereinen (Vgl. Im Hof 1991, S. 252f.). Wilhelm Tell als Symbol für Wehrhaftigkeit gegenüber Fremdherrschaft und Tyrannei trat in den Vordergrund des Geschichtsunterrichtes in den Schulen. Bundesbrief und Rütlischwur als Garanten für die ewig bestehende Schweiz stärkten den Verteidigungswillen und nationale Gefühle. Zu dieser Zeit fanden sich nationale Identität in Armeebüchern, Soldatenliedern, national geprägte Filme und politische Zeitschriften in allen vier Sprachen. „Sie alle hielten die wieder gefundene nationale Identität aufrecht, die es immer aufs neue zu stärken galt.“ (Im Hof 1991, S. 251) Der Mythenkult ist also bis heute ein wichtiges stabilisierendes Element der schweizerischen Identität. Mit Hilfe der Mythen konnte sich so, in einem ethnisch, konfessionell und sprachlich sehr heterogenem Gebiet, der Nationalstaat Schweiz herausbilden. Vor allem in Krisenzeiten hielt man sich an den alten Sagen und Mythen fest, um so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Die Verehrung des Bundesbriefes als nationales Heiligtum, welches nach konservativer Meinung das von uns besuchte Bundesbriefmuseum niemals verlassen sollte erscheint uns in gewisser Weise sonderlich, ist aber ein Ausdruck des heute noch praktizierten Mythenkults in der Schweiz. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass der Mehrheit der modernen Schweizer wohl durchaus bewusst ist, dass es weder auf das Papier noch den Inhalt, sondern auf die Werte und die gemeinsame Geschichte, ankommt, die dieses Schriftstück symbolisiert.
Föderalismus und direkte Demokratie
Dieses Kapitel will zuerst kurz auf den Föderalismus in der Schweiz eingehen und sich dann näher mit dem Hauptthema der Arbeit, nämlich der direktdemokratischen Elemente in der Schweiz auseinandersetzen.
Bundesstaatlichkeit
Der Föderalismus, der Schweiz ist mehr als eine bloße Kennzeichnung für die Staatsorganisation in einem verfassungsrechtlich- oder institutionell-funktionalistischen Sinn. Er ist gerade in der Schweiz als institutionalisiertes Form- oder Strukturprinzip anzusehen,
„[…] mit welchem der Mensch die Spannung zwischen der Bewahrung seiner Individualität und der Zuordnung zu einer Gesellschaft überwinden kann“ (Klöti 1999, S. 79).
Die zentralen Funktionen föderaler Ordnung liegen auch in der Schweiz in einer verstärkten Machtkontrolle im demokratischen Regierungssystem, wichtiger sind jedoch die erhöhten Partizipationsmöglichkeiten der kantonalen Bevölkerung an dezentralen Entscheidungsprozessen. Der Föderalismus in der Schweiz hat aber auch identitätsstiftende Funktionen inne. Er verfestigt mit Hilfe der kantonalen Autonomie einerseits eine kantonale Identität, begründet aber auch dadurch das Fundament für die nationale schweizerische Identität.
Gefühlter Föderalismus
„Für Jahrhunderte sah die Schweiz ihren Zusammenhang als Nation nicht in einem starken Gesamtstaat, sondern in der Überhöhung der föderalistischen Struktur durch ein gemeinsames Nationalbewusstsein“ (Im Hof 1991, S.257).
Der Schweizer ist im Kanton zuhause. Hier liegt seine wahre Identität (Vgl. Im Hof 1991, S.260). „Bis heute bezeichnen sich in der Schweiz als „Föderalisten“ oder gar „Erzföderalisten“ jene, welche sich gegen den Ausbau der Zentralgewalt des Bundes wenden.“ (Linder 1999a, S.135) Durch alle Parteien hindurch werden diese Begriffe, die in Deutschland wohl eher eine negative Assoziation hervorrufen und den Begriff „Kleinstaaterei“ in den Sinn kommen lassen, für ihre Zwecke verwandt. Die Begriffe sind in der Schweiz eher positiv besetzt, sie beinhalten den festen Glauben daran, sich vor einer Zentralgewalt immer wieder wehren zu müssen, um das föderative Prinzip und die Kompetenzen und Eigenarten der Kantone schützen und erhalten zu können. Bei unserem Besuch in der Schweiz konnten die Seminarteilnehmer bei der Befragung eines Abgeordneten der rechts-konservativen SVP diesen „gefühlten“ Föderalismus deutlich spüren, als dieser seine nationale Identität zu erklären versuchte und das Fundament seines Nationalbewusstseins in seinem Heimatdorf ansiedelte, zweitrangig die nächst größere Stadt, darauf den Kanton Vallis und erst an vierter Stelle sich zu seiner schweizerischen Nationalität bekannte, die für ihn nur ein Mittel darstellt seine lokale Identität und seinen regionalen Patriotismus zu verwirklichen. Der Bericht des SVP-Abgeordneten mag natürlich nicht für die schweizerische bzw. valliser Bevölkerung als repräsentativ gelten, zeigt aber dennoch die Rückführung der nationalen Identität auf die kantonale bzw. lokale Identität und das damit verbundene föderale Denken.
Föderalismus in der Praxis
„Der schweizerische Föderalismus hat ideell und institutionell sehr vieles mit dem amerikanischen gemeinsam“ (Linder 1999a, S.137). Institutionell liegt das Kernstück des schweizerischen Föderalismus vor allem im streng getrennten Zwei- Kammern -System, bei dem die Vertretung der Kantone auf Bundesebene im Ständerat stattfindet. Die Vertreter der Kantone sind wie in den Vereinigten Staaten direkt von der Kantonsbevölkerung gewählt und sind somit nicht, wie in Deutschland der Fall, an Weisungen der Kantonsregierungen gebunden. Die ideellen Grundprinzipien sind eine ausgedehnte Autonomie und Gleichberechtigung der Kantone, aber auch die Pflicht zur Zusammenarbeit in Belangen des Bundes (Vgl. Klöti 1999, S.82). Wie in der Bundesrepublik liegt die Kompetenzvermutung zuerst immer bei den Kantonen. Der Unterschied bei den Gesetzgebungskompetenzen liegt darin, dass sich der schweizerische Föderalismus zwar im Laufe der Zeit gewandelt hat, das Moment des Dezentralen allerdings mehr beibehalten und nicht wie in der BRD durch viele Kompromisse in Kompetenzstreitigkeiten und zunehmender Zentralisierung aufgeweicht wurde. Sowie das genannte Subsidiaritätsprinzip, bei der Klärung von Zuständigkeiten sind die wichtigsten Grundpfeiler des schweizerischen Bundesstaates die Organisationshoheit der Kantone, die bis zur Bestimmung politischer Rechte der Bürger reicht, ausgedehnte Steuererhebungskompetenzen auf kantonaler und kommunaler Ebene, sowie die gleichberechtigte (Ausnahmen bilden die Regelungen für die sog. Halbkantone) Beteiligung am Willensbildungsprozess auf Bundesebene. (Vgl. Klöti 1999, S.83) Der Ständerat, der die Hauptinstitution zur Artikulation kantonaler Interessen auf Bundesebene sein sollte, ist in den 90ern allerdings immer mehr der Kritik ausgesetzt worden, da die Interessen
„[…] kaum anders artikuliert werden als im Nationalrat, und der Ständerat deshalb seine Funktion als Gliedstaatenvertretung nur in beschränktem Masse erfüllt“. (Klöti 1999, S.85)
Die stark bürgerliche Zusammensetzung des Ständerates trägt also zu einer Stärkung und Verfestigung der schweizerischen Konsenspolitik bei, was nicht unbedingt negativ bewertet werden muss. Das Problem besteht eher im einseitigen Minderheitenschutz. Weniger problematisch im Sinne von Schutz von politisch orientierten Minderheiten, wie in links-rechts oder konservativ-progressiv Schemata. Sondern vielmehr die gleichmäßige Interessenverteilung von bevölkerungsarmen ländlichen Gebieten, gegenüber urbanen Regionen und Kernstädte, die im Ständerat zunehmend untervertreten sind. (Vgl. Klöti 1999, S.86) Trotz des institutionellen Reformbedarfs, der immer wieder durch neue Strukturveränderungen entsteht, darf nicht vermutet werden, dass der schweizerische Föderalismus nicht bereits seit 1848 starken Veränderungen und Reformen ausgesetzt war. Die seit dem Zweiten Weltkrieg auch „zu einem kontinuierlichen Ausbau des Interventions- und Leistungsstaates“ (Klöti 1999, S.100) führten. Dennoch bildet der Föderalismus nach wie vor eines der Kernelemente der politischen Kultur und des politischen Systems der Schweiz. Von einer generellen Zentralisierung kann in der Schweiz nicht gesprochen werden. Während verschiedene Aufgabenbereiche, wie Sozial- und Wohlfahrtsstaat immer weiter zentralisiert werden, neigt man in anderen, zum Beispiel ordnungspolitischen Bereichen zur konsequenten Dezentralisierung. Auch wenn die Kompetenzen in der Schweiz klarer zwischen Bund und Kantonen verteilt scheinen, zeigt der Föderalismus der Schweiz auch weiterhin Reformbedarf. Vatter umschreibt die zukünftigen Herausforderungen so:
„Die Vitalisierung des Föderalismus durch die Anpassung föderalistischer Strukturen an neue Lebensräume wie Agglomerationen und Regionen und die Verstärkung pluralistischer Entscheidungs- und demokratischer Legitimationsverfahren, die dem Bedeutungszuwachs nichtterritorialer Minderheiten besser Rechnung tragen, werden deshalb die längerfristigen und grundsätzlichen Herausforderungen für den schweizerischen Föderalismus bilden.“ (Klöti 1999, S.104)
Direkte Demokratie
„Anzumerken ist zunächst, dass das Volk selbst in den repräsentativen Demokratien der Schweiz die unmittelbare Ausübung eines Teils seiner Macht in den eigenen Händen behalten hat. In einigen Kantonen müssen die wichtigsten Gesetze, nachdem sie von der gesetzgebenden Versammlung gebilligt wurden, noch einer Volksabstimmung unterzogen werden. Damit entartet die repräsentative Demokratie in diesen besonderen Fällen zur reinen Demokratie.“ (Tocqueville 2005, S. 451)
Das Zitat aus dem Text „Bericht über die Demokratie in der Schweiz“ vom Januar 1848 macht den demokratischen Zeitgeist Mitte des 19en Jahrhunderts deutlich. Die reine, also direkte Form der Demokratie erscheint als ein Überbleibsel des Mittelalters. Ganz dem Zeitgeist der repräsentativen Demokratie entsprechend tritt im September nach Tocquevilles Bericht mit der Bundesverfassung von 1848 eine Verfassung in Kraft, die das repräsentative System auf Bundesebene stärkt und direkt demokratische Elemente nur in der rudimentären Form, eines obligatorischen Verfassungsreferendums und der Volksinitiative auf Totalrevision zulässt. (Vgl. Linder 1999a, S.111) Doch TOCQUEVILLE sollte Recht behalten, in der Annahme, dass der Weg zur Demokratie in der Schweiz und deren institutionelle Ausgestaltung in den 30er Jahren des 19en Jahrhunderts erst beginnt und bei weitem nicht mit der Verfassung von 1848 abgeschlossen ist. Die Schweiz geht ab 1874 ihren eigenen Weg. Den der „halbdirekten Demokratie“. Anders als TOQUEVILLE vermuten oder empfehlen würde setzt sich eben nicht die repräsentative Demokratie auf allen Entscheidungsebenen durch, sondern was in manchen Kantonen schon Mitte des 19en Jahrhunderts Realität ist, nämlich weit reichende Mitentscheidungsrechte auch bei der Gesetzgebung, wird auf den Bund übertragen. Ein in Europa, bzw. auf der Welt einzigartiger Weg der Ausgestaltung eines demokratischen Systems. In den nächsten beiden Kapiteln wird diese Ausgestaltung der Volksrechte auf Bundes- und Kantonsebene beschrieben, so wie sie sich seit Ende des 19en Jahrhunderts und fast unverändert noch in der heutigen Schweiz darstellt.
Direkte Demokratie auf Bundesebene
In der Schweiz hat das Volk auf Bundesebene die Möglichkeit auf den zwei wichtigsten Entscheidungsebenen, der Verfassungsstufe und der Stufe der Bundesgesetze mit direktdemokratischen Mitteln mit zu entscheiden.
Das obligatorische Referendum
Artikel 140 der schweizerischen Bundesverfassung regelt in welchen Fällen ein Referendum durchgeführt werden muss. Darunter fallen alle Änderungen der Bundesverfassung (Art. 140 I (a)), Staatsverträge, die den Beitritt zu Organisationen kollektiver Sicherheit oder supranationalen Gemeinschaften regeln (Art. 140 I (b)), sowie Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage haben und durch die sog. Dringlichkeitsklausel vom Referendum ausgenommen wurden und bereits ein Jahr lang in Kraft getreten sind. (Art. 140 I (c)) Das als letztes genannte Dringlichkeitsrecht wurde 1874 eingeführt, um in Notfällen das Gesetzgebungsverfahren abzukürzen und erlaubte es, Volksabstimmungen zu den als dringlich eingestuften Beschlüssen auf unbestimmte Zeit aufzuschieben und unterhöhlte damit de facto die garantierten Volksrechte bis zu seiner Neuordnung 1939 und 49. Die Neuordnung schränkte das Dringlichkeitsrecht weitgehend ein und forderte wie es in Art. 140 I (c) ausgestaltet ist, dass Bundesgesetze bei denen das Referendum aufgeschoben wurde nach einer Frist von einem Jahr obligatorisch zur Abstimmung vorgelegt werden müssen. Abstimmungen über Staatsverträge zu Beitritten in internationale Organisationen sind zwar äußerst selten, zeigen allerdings in ihren weit reichenden Konsequenzen wie dem späten Beitritt der Schweiz zu den Vereinten Nationen, oder die Entscheidung gegen den Beitritt zum EWR, welchen enormen Einfluss die schweizerische Bevölkerung, oder vielmehr die Mehrheit der Bevölkerung der Schweiz auch auf die außenpolitischen Maximen ihres Landes hat.
Das fakultative Referendum
Bei unserem Besuch in der Schweiz stand gerade die Entscheidung zum Beitritt des Schengen-Dublin-Vertrages an. Da es sich hierbei um einen völkerrechtlichen Vertrags im Sinne des Art. 141 I (d) handelt, fällt der Beschluss zum Beitritt des Schengen-Raums unter die Kategorie des fakultativen Referendums und kann damit auf Verlangen von 50000 Stimmberechtigten Bürgern oder acht Kantonen innerhalb einer Frist von 100 Tagen zur Abstimmung vorgelegt werden. Bei einer solch wichtigen und umstrittenen Entscheidung war es auch nicht verwunderlich, dass dieses auch geschehen ist. Außer völkerrechtliche Verträge unterstehen alle Bundesgesetze, dringlich erklärte Bundesgesetze mit Verfassungsgrundlage nach der Jahresfrist und Bundesbeschlüsse, bei welchen Verfassung oder Gesetz dieses vorsieht, dem fakultativen Referendum nach Art. 141 I der Bundesverfassung.
Direkte Demokratie auf Kantonsebene
Die Regelungen in den Kantonen sind denen des Bundes zwar ähnlich, gehen aber an manchen Punkten weiter bei der Einbindung des Volkes. (Vgl. Linder 1999a, S. 114) Hier sollen nun allgemein die Hauptunterschiede auf kantonaler Ebene aufgezeigt werden, wobei nicht auf jeden einzelnen Kanton eingegangen werden kann. Die traditionelle Versammlungsdemokratie, die Landsgemeinde, ist aus der politischen Realität der schweizerischen Kantone nahezu komplett verschwunden und durch Urnenabstimmungen - bis auf zwei Ausnahmen, den Kantonen Glarus und Appenzell-Innerrhoden - ersetzt worden.
In den Kantonen hat die Bevölkerung meist noch weiter reichende Einflussmöglichkeiten. Im Gegensatz zum Bund ist in allen Kantonen die Gesetzesinitiative möglich und in einem Drittel der Kantone ist ein Referendum bei jeder Gesetzesänderung obligatorisch. Weitergehend sind auch die Entscheidungsbereiche die durch Referenden beeinflusst werden können. So können auch Einzelakte oder Verwaltungsbeschlüsse der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt werden. Vor allem das Finanzreferendum ist hier zu erwähnen, in manchen Kantonen obligatorisch in manchen fakultativ, gehört es vor allem bei großen Entscheidungen über die Finanzierung von Bauten und Anlagen zu den wichtigeren Volksentscheiden, deren Auswirkungen auf die kantonale Finanzpolitik enorm sind. Die Ausgestaltung der Regelungen zur Volksbeteiligung ist von Kanton zu Kanton äußerst unterschiedlich. Abgesehen von diesen Unterschieden wird in Kantonen, vor allem in städtischen Zentren, die Möglichkeit der fakultativen Referenden um einiges öfter genutzt, als in homogeneren ländlichen Kantonen.
Bewertung der direktdemokratischen Elemente
„Political scientists in general have not been strong advocates of citizen law making“(zitiert nach: Möckli 1994, S.83), zitiert Möckli. Tatsächlich überwog bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts eine eher skeptische Haltung der politischen Wissenschaft gegenüber direktdemokratischen Volksentscheiden. In Deutschland stehen Politik und Wissenschaft auch heute noch zurückhaltend der Frage gegenüber, in welchem Rahmen und auf welchen Ebenen dem durchschnittlich informierten Stimmbürger, Sachentscheidungen vorgelegt werden könnten oder ob er damit nicht überfordert wäre. Nun sind die Argumente für und wider direktdemokratischer Elemente in parlamentarischen Systemen eigentlich seit Jahren dieselben. Diese Argumente sollen aufgeteilt in einer Schematik nun aufgezeigt und kurz diskutiert werden. Das Argument, dass in einer kommerzialisierten Medien- und Informationsgesellschaft Entscheidungen von Interessengruppen zu stark beeinflusst werden können und so die herrschende öffentliche Meinung, Minderheitenmeinungen, wie Tocqueville es sieht, von vorn herein unterdrücken soll im nächsten Kapitel noch näher betrachtet werden.
Historisch-normative Argumente
In Ländern, die direktdemokratischen Entscheidungen eher kritisch gegenüber stehen, wie Frankreich oder Deutschland wird oftmals damit argumentiert, dass die Schweiz ein Sonderfall und wegen der speziellen demokratischen Tradition nicht auf andere Länder anwendbar sei. Außerdem helfe die kleinräumigkeit der Kantone und der tief verwurzelte Föderalismus, negative Auswirkungen der direkten Demokratie zu begrenzen. Mit der historischen Argumentation schwingt vor allem in Ländern die in ihrer Geschichte Erfahrungen mit faschistischen Massenbewegungen hatten ein Menschenbild mit, dass von Philosophen wie Ortega y Gasset („Der Aufstand der Massen“) oder dem Soziologen Joseph Schumpeter („Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“) geprägt wurden und ein tiefes Misstrauen gegen Entscheidungen, des als unmündig und schlecht informiert empfundenen Großteil der Menschen ausdrückt. Gerade bei Massendemokratien sei die Gefahr großdurch Volksabstimmungen entweder das politische System zu lähmen, oder schlimmer den Einfluss von Populisten bei der Bevölkerung zu stärken. Bei der historischen Argumentation wird oftmals vergessen, dass auch in der Schweiz die halb-direkte Demokratie so wie sie sich heute darstellt, erst mit der Bundesverfassung von 1848 eingeführt und mit ihrer Reform 1874 ausgeweitet wurde. Dieser Weg war keinesfalls für die Schweiz vorgezeichnet, sondern wurde absichtlich bei der Gründung des Bundesstaats eingeschlagen. Die Menschen mussten damals genauso lernen, mit den neuen institutionellen Möglichkeiten umzugehen. Dieser Prozess dauerte auch in der Schweiz seine Zeit und liegt eben nicht „im Blut“ der Schweizer. Auf Bundesebene wurde das Instrument der Volksinitiative von 1981 bis 2006 öfters genutzt als in den gesamten Jahren von 1848 bis 1980. Die Intensität der aktiven Mitgestaltung von Gesetzesinitiativen, abgesehen von den obligatorisch von der Verfassung vorgeschriebene Entscheidungen, hat also im letzten viertel des 20. Jahrhundert stark zugenommen. Was zeigt, dass sich eine Beteiligungsmentalität entwickeln musste. Außerdem sollte gerade die historische Analyse aufzeigen, dass auch gewählte Parlamente von fatalen Fehlentscheidungen nicht gefeit sind und vielleicht eine Korrekturinstanz per Referendum oftmals vernünftig gewesen wäre. Der normative Gegenpol zu Theorien wie von Schumpeter bieten kommunitaristische Ansätze wie der von Benjamin Barber, hier steht politische Partizipation als Grundvoraussetzung für eine „starke Demokratie“, wie sie Barber nennt. Zu diesem positiven Menschenbild passen direktdemokratische Elemente besser. Es setzt allerdings voraus, dass zumindest die meisten Menschen eine Mündigkeit in politischen Fragen erlangen können und dieses auch, um der Gemeinschaft willen wollen (Vgl. Barber 1994, S. 150f.).
Institutionell-prozessuale Argumente
„Direktdemokratische Entscheidungsprozesse sind komplex und dauern zu lange. Innovationen werden erschwert. Es ist nur ein Ja oder ein Nein ohne Nuancen möglich, und es besteht die Gefahr einer Tyrannei der Mehrheit. Konflikte werden dadurch nicht gelöst, sondern verschärft. Es fehlt die parlamentarische Reflexion, Konfrontation, Kompromissfindung und das Fachwissen. Schlechte Gesetze sind die Folge“ (Möckli 1994, S. 86).
Eines der Hauptargumente meistens von Seiten der schweizerischen Wirtschaft oder Wissenschaftlern wie Walter Wittmann ist die lange Dauer des direktdemokratischen Prozess, von einer Gesetzesinitiative bis zum fertigen Gesetz. Die Schweiz sei dadurch sehr Reformresistent, könne sich nicht der schnelllebigen Wirtschaftsentwicklung in einer globalisierten Welt anpassen und werde früher oder später ins Hintertreffen geraten. Tatsächlich kann, wenn alle direktdemokratischen Elemente auf Bundesebene ausgeschöpft werden, ein solcher Prozess im extremsten Fall bis zu sieben Jahre dauern. Trotzdem ist die Schweiz reformierbar geblieben. Nicht jedes Gesetz muss zur Abstimung vorgelegt werden, doch allein die Möglichkeit, dass es durch ein fakultatives Referendum zur Abstimmung gebracht werden könnte erleichtert und beschleunigt eher die Kompromissfindung im Parlament, als das sie erschwert wird. Manche Wissenschaftler legen die lange Dauer des Gesetzgebungsprozesses sogar positiv aus. Die Bevölkerung müsse sich mit Reformen näher beschäftigen, die Akzeptanz der fertigen Reform ist höher und die Anpassung der Lebensumstände erfolgt vorbereiteter und sanfter, als in einem vom Volk entfremdeten Paralmentarismus (Vgl. Gloe 2005, S. 118f.). Jedes politische System hat außerdem seine „Bremsen“ eingebaut. Man darf nicht vergessen, dass sich Reformen auch in einem parlamentarischen System wie in der BRD durch schwierige Kompromissfindungsprozesse innerhalb von Regierungskoalitionen oder durch Kräfteverhältnisse im Zweikammernsystem recht lange hinziehen können, oder wie z.B. das Thema Steuerreform auf unbestimmte Zeit vertagt wird, weil die Koalition auf diesem Gebiet nicht Konsensfähig ist.
Institutionell steht und fällt die Entscheidung des Bürgers nach Sachargumenten zu entscheiden, mit der Möglichkeit sich unparteiisch über das Für und Wider einer Gesetzesvorlage ausreichend zu informieren. Die staatlichen Institutionen der Schweiz versuchen dies mithilfe von sachlichen Erläuterungen, die den Abstimmungsvorlagen beiliegen müssen. Diese Erläuterungen sollen auch „Auffassungen wesentlicher Minderheiten Rechnung“ tragen und somit verschiedene Argumente aus unterschiedlichen Perspektiven beinhalten. Ob dies ausreicht und wie weit der Einfluss von Interessengruppen und Medien bei den Abstimmungskämpfen geht soll im nächsten Kapitel näher betrachtet werden.
Direkte Demokratie: „Tyrannei der Mehrheit“ oder starke Demokratie?
„Sie legen dem Volk Referenda vor, ohne dafür zu sorgen, daßes hinreichend informiert ist, eine ausführliche Debatte stattfindet bzw. der Einflußdes Geldes und Manipulation durch die Medien klug ausgeschaltet werden, und werfen ihm dann vor, keine Urteilskraft zu besitzen. Erst wird das Volk mit allen besonders hartnäckigen Problemen der Massengesellschaft konfrontiert – wie Inflation, Besteuerung, atomare Bedrohung, Vollbeschäftigung, Beseitigung von Industrieabfällen, Umweltschutz (also mit Problemen, vor deren Lösung die Regierungseliten selbst kapituliert haben) -, und dann wird die Unsicherheit, Unentschiedenheit oder Einfältigkeit bekrittelt, mit der es recht und schlecht zu einer Entscheidung kommt“ (Barber 1994, S. 151).
Wie weit geht nun der Einfluss des Geldes und der Medien in der Schweiz? Eines ist klar, der Bundesrat und die kantonalen Parlamente sind durch die ständige Gefahr eines drohenden Referendums gezwungen, ihre Gesetzesvorhaben mehrheitsfähig zu gestalten. Wenn sie dies nicht sein sollten, es sich also um schmerzhafte Reformen, die z.B. die soziale Sicherheit betreffen handelt, tut die Politik in der Schweiz gut daran diese wenigstens gut zu vermitteln und zu begründen. Das dies der Fall ist, ist eindeutig ein Vorteil der direkten Demokratie, die den Staat zu einer gewissen Volksnähe zwingt. Der Nachteil liegt aber auch auf der Hand. Mit gezielten Kampagnen von Interessengruppen, Parteien und Medien können Mehrheiten beeinflusst werden. Über Ängste der Bevölkerung können Stimmungen erzeugt werden, die auch zu irrationalen Entscheidungen führen können. Z.B. wurde auf Plakaten der SVP zum Beitritt des Schengen-Dublin-Abkommens offensiv Ängste gegen kriminelle Ausländer geschürt und vor den prekären Situationen in anderen Schengen-Ländern wie Deutschland gewarnt. Dennoch wurde das Gesetz zum Beitritt mit 54,6 Prozent deutlicher als erwartet angenommen. Wieviel Einfluss haben Parteien, Interessengruppen und Medien nun wirklich auf die Entscheidungsfindung der Schweizer? Schaffen die Mehrheitsentscheidungen einen „drohenden Kreis um das Denken“(Tocqueville 2004, S. 151), wie Tocqueville es in Amerika erkannt haben will, wobei er allerdings alle Mehrheitsentscheide, also auch die Wahlen der Repräsentanten, Richter und Beamten in den USA miteinbezieht. Es stellt sich auch die Frage, ob Entscheidungen des einzelnen Stimmbürgers nicht viel mehr durch zufällige gesellschaftliche Stimmungslagen beeinflusst und gezielte Kampagnen oftmals auch gegenteilige Effekte hervorrufen können. Vielleicht ist die Masse, vor allem in einer hoch differenzierten Medienlandschaft, gar nicht so berechenbar, wie es uns Meinungsforscher manchmal weißmachen wollen.
Einfluss der Interessenverbände und Medien
Die Interessenverbände
„In der Schweiz können sich die Interessenverbände auch der Mittel der direkten Demokratie bedienen, also Referenden ergreifen oder Volksinitiativen lancieren. Die «Referendumsdrohung» im Lauf der Ausarbeitung eines Gesetzes ist denn auch ein erprobtes Druckmittel, um bei einem Gesetz eigene Duftmarken zu hinterlassen. Falsch ist indessen die Auffassung, die Interessenverbände in der Schweiz seien wegen der Möglichkeit des Referendums so stark. Vielmehr sind die grossen Wirtschaftsverbände auch in rein repräsentativen Demokratien sehr einflussreich. Das Referendum ist also ein Mittel der Einflussnahme und nicht deren Ursache“ (Möckli 2007, S. 85).
Die Annahme, dass die Verbände durch die direkte Demokratie mehr Einfluss auf die Politik in der Schweiz hat, ist auch deswegen falsch, weil der Anteil der direkt durchgesetzten Volksinitiativen relativ gering ist. Die Erfolgschance liegt auf Bundesebene bei ca. 10 Prozent. So zeigt sich die „Referendumsdrohung“ als effektiveres Mittel beim Gesetzgebungsprozess mitzuwirken als der direkte Meinungskampf zur Abstimmung selbst. Natürlich beeinflussen Interessenverbände wie Gewerkschaften eine große Anzahl, vor allem ihrer Mitglieder mit Stellungnahmen zu anstehenden Entscheidungen. Zum einen können so aber auch Interessen von Minderheiten und neue Argumente in den Prozess einfließen lassen. Weiterhin gibt es keinen Verband, der eine solche Monopolstellung geniest, dass er damit rechnen kann Mehrheiten für seine Interessen zu finden. Ein pluralistisches Verbändesystem ist also eher ein Hindernis einer „Tyrannei der Mehrheit“, da verschiedene Interessen gebündelt werden können. Alles in allem zeigt sich das Elektorat in der Schweiz resistenter gegen direkten Lobbyismus als Politiker der Parteien in den Parlamenten. Nach Möckli profitieren aber dennoch „vornehmlich finanz- und organisationsstarke Interessenverbände, weil sie am ehesten in der Lage sind, die notwendigen Ressourcen für den direktdemokratischen Entscheidungsprozess zu mobilisieren“ (Möckli 1994, S. 373).
Die gut organisierten großen Verbände haben natürlich mehr Einfluss. In diesen sind meist die Mittelschichten organisiert und so weist Möckli mit Recht darauf hin, was die direkte Demokratie leistet und was nicht. Sie schafft eine weitere Einflussmöglichkeit, die vor allem von einer gebildeten Mittelschicht genutzt wird, als ein Kontrollinstrument gegenüber den Eliten, die sich beispielsweise in Wirtschaftsverbänden organisieren. Deren Einfluss ist weder kleiner noch größer, als in rein representativen Systemen, findet in der direkten Demokratie aber eher einen Ausgleich mit Interessen der Mittelschichten. Woran direktdemokratische Elemente eindeutig nichts ändern, ist die Tatsache, dass mit sinkenden Bildungsstand und tieferer sozialer Schicht die Teilnahme am demokratischen Prozess, sei es organisiert in Verbänden, in Abstimmungen oder Wahlen, insgesamt und bei schwer verständlichen Vorlagen im speziellen, abnimmt. (Vgl. Möckli 1994, S. 374)
Die Medien
Während bis jetzt vom direkten Einfluss von Interessenverbänden die Rede war, zeigt sich der wahre Einfluss auf Information und Propaganda erst im Zusammenspiel mit den Massenmedien. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen starker Medienaufmerksamkeit, Polarisierung, Emotionalisierung und dem Beteiligungsgrad an Urnengängen. Schwieriger wird die Sache, wenn man einen Zusammenhang zwischen einseitiger Propaganda und die dafür aufgewandten Kosten und dem tatsächlichen Abstimmungsergebnis nachweisen möchte. Hierbei besteht immer die Gefahr, den Stimmbürger, seine Informationsquellen, Werte und Einstellungen zu eindimensional zu betrachten (Vgl. Trechsel 1999, S. 571f). Ein überzeugter Atomkraftgegner wird also nicht, über Nacht mit genügend Abstimmungspropaganda versorgt, zum Atomkraftbefürworter und andersherum. Trotzdem darf der Einfluss von Medienkampagnen nicht unterschätzt werden. Studien zeigen, dass die meisten Stimmbürger sich in der Zeit der Kampagnen, kurz vor der Abstimmung ihre abschließende Meinung bilden und in dieser Zeit Informationsangebote zur Abstimmung intensiver nutzen (Vgl. Trechsel 1999, S. 572). Das heißt, dass Gegner, bzw. Befürworter einer Vorlage durchaus bemüht sind und auch sein sollten, ihre Argumente möglichst breit gestreut unter das Volk zu bringen. Zynische Tatsache in der Schweiz ist hierbei, dass zu plumpe Medienkampagnen durch das hohe Bildungsniveau der Teilnehmenden und deren Bereitschaft, sich breit gefächert zu informieren leichter durchschaut werden. Sich also viele, für die die Vorlage zu kompliziert ist sowieso raus halten. Die mit der Vorlage verschickten Informationen des Bundesrates nehmen in der Schweiz eine wichtige Rolle ein, um Argumentationen zu ordnen und so die Abstimmung auf eine sachbezogene Ebene zu bringen. Dies gelingt bei emotional hoch aufgeladenen Themen, die schweizerische politische Traditionen wie die Neutralität angreifen oftmals nicht und so ist es nicht verwunderlich, dass sich Gesetze zum Beitritt supranationaler Organisationen wie der UNO, trotz teils irrationaler Argumentation in der Schweiz sehr schwer taten und es immer noch tun.
„Tyrannei der Mehrheit“
Interessant im Kontext der Tyrannei der Mehrheit scheint ein Beitrag von Papadopoulos zu sein, der von einer Wichtigkeit der „dominanten Ideologie“ in der Schweiz spricht und Propaganda und Werbung erst dann effizienten Einfluss auszuüben sieht, wenn sie sich auf eine kulturelle Grundlage, also einer gewachsenen Mehrheitsideologie stützen kann (Vgl. Trechsel 1999, S. 572). Die direkte Demokratie birgt also „für soziale, regionale oder ethnische Minderheiten die Gefahr der «Tyrannei der Mehrheit»“. So lässt sich zum Beispiel die späte Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz erklären. Andererseits wird mit Mitteln der direkten Demokratie auch immer wieder auf Anliegen von Minderheiten hingewiesen und so gesellschaftliche Diskussionen in Gang gesetzt, die beim „Agenda-Setting“ in repräsentativen Systemen leicht übergangen werden und so erst gar nicht auf der Tagesordnung der öffentlichen Willensbildung auftauchen. Es darf außerdem nicht vergessen werden, dass die direkten Elemente nur ein Teil des demokratischen Prozesses ausmachen und es auch in der Schweiz keine Selbstherrschaft des Volkes geben kann. Außerdem ist die Schweiz ein Musterbeispiel dafür, wie die Mehrheitsmacht nach Tocqueville begrenzt werden kann: Mithilfe des kleingliedrigen Bundesstaats mit starken regionalen und lokalen Entscheidungsträgern wird der bundesstaatlichen Mehrheit einiges an Einfluss entzogen. Diese regionale Gliederung spiegelt sich auch in der Medienlandschaft wieder und mindert so den Einfluss von bundesweiter Meinungsmache.
Schluss - Demokratie als Grundhaltung?
„Die Schweiz hat über sieben Jahrhunderte jenes politische System herausgebildet, das ihren Verhältnissen angemessen ist. In der Kombination der Einzelteile ist es einzigartig und unterscheidet sich von allen anderen politischen Systemen. Es ist deswegen aber nicht besser als alle anderen politischen Systeme. Jedes politische System ist ein Sonderfall“ (Möckli 2007, S. 39).
Ist nun die Schweiz das Paradies für Kommunitaristen? Ist Demokratie eine Grundhaltung der Schweizer? Und kann diese Europa von ihnen lernen? Gleich vorweg: Wie jedes politische System hat auch das schweizerische System Vor- und Nachteile, Unzulänglichkeiten und Macken. Es gibt auch in der Schweiz Probleme genug und auf manche Probleme passt die Konsensorientiertheit des schweizerischen Systems nur bedingt. Der von vielen Kritikern des halb-direktdemokratischen Systems vorhergesagte wirtschaftliche Niedergang, im Zuge der Globalisierung ist dennoch nicht eingetreten. Es gibt keinen Anlass die Schweiz als Wiege der heutigen demokratischen Kultur zu feiern. Die Menschen dort sind keine schlechteren oder besseren Demokraten als in anderen westlichen Ländern. Doch kann man eine Grundhaltung kritischer Partizipation und Mitsprache bei Entscheidungen nicht leugnen. Die Schweizer haben mit ihrer halb-direkten Demokratie ein einzigartiges System geschaffen, dass sich auf die politische Kultur auswirkt, und dass, meiner Meinung nach überwiegend im positiven Sinne. Die schweizerische Bevölkerung ist - mit Ausnahme der angesprochenen Exklusionsproblematik – durch den weiteren Weg der Einflussnahme, der ihr offen steht, mehr in das politische System und die politische Entscheidungsfindung eingebunden. Das Volk regiert sich nicht selbst, regiert aber mehr mit. Die psychologische Nebenwirkung der direkten Demokratie nach dem Motto: „Ich kann mit entscheiden, also kann ich mich eher mit der Entscheidung identifizieren“, wird von Kritikern unterschätzt. Menschen wollen bei den politischen Prozessen mit genommen werden. Das ist es auch woran die Europäische Union derzeit krankt. Das Entstehen dieses Modells kann nicht losgelöst von der historischen Entwicklung gesehen werden, war aber keineswegs durch die Geschichte oder durch die politische Kultur früherer Epochen so vorgezeichnet. Die historischen Mythen von Eidgenossenschaft bis Tell-Saga halfen in Krisen die schweizerische Willensnation zusammen zu halten. Mythen können nicht einfach erzeugt werden, was nicht heißen soll, dass kein europäischer Mythos in Zukunft entstehen könnte. Diese Diskussion bringt uns aber im Augenblick nicht weiter. Lehren aus dem politischen System der Schweiz und dessen Entstehung könnten uns aber sehr wohl im europäischen Integrationsprozess weiterbringen.
Literaturverzeichnis
Der Bundesbrief von 1291. Online verfügbar unter http://www.schweizerseiten.ch/bundesbrief.htm, zuletzt geprüft am 20.02.2008, 12:46.
Barber, Benjamin R. (1994): Starke Demokratie. Über die Teilhabe am Politischen. Hamburg: Rotbuch-Verl. (Rotbuch-Rationen).
Gloe, Markus (2005): Direkte Demokratie - das Beispiel Schweiz. In: Massing, Peter (Hg.): Direkte Demokratie. Eine Einführung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl. (Reihe Uni-Studien Politik), S. 107–122.
Im Hof, Ulrich (1991): Mythos Schweiz. Identität Nation Geschichte 1291 - 1991. Zürich: Verl. Neue Zürcher Zeitung.
Klöti, Ulrich (Hg.) (1999): Handbuch der Schweizer Politik. Zürich: NZZ-Verl.
Klöti, Ulrich (2006): Handbuch der Schweizer Politik. 4., vollst. überarb. Aufl. Zürich: Verl. Neue Zürcher Zeitung.
Linder, Wolf (1999a): Direkte Demokratie. In: Klöti, Ulrich (Hg.): Handbuch der Schweizer Politik. Zürich: NZZ-Verl., S. 110–126.
Linder, Wolf (1999): Schweizerische Demokratie. Institutionen - Prozesse - Perspektiven. Bern [u.a.]: Haupt.
Massing, Peter (Hg.) (2005): Direkte Demokratie. Eine Einführung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl. (Reihe Uni-Studien Politik).
Möckli, Silvano (1994): Direkte Demokratie. Ein Vergleich der Einrichtungen und Verfahren in der Schweiz und Kalifornien unter Berücksichtigung von Frankreich Italien Dänemark Irland Österreich Liechtenstein und Australien. Bern u.a.: Haupt (St. Galler Studien zur Politikwissenschaft, 16).
Möckli, Silvano (2007): Das politische System der Schweiz verstehen. Wie es funktioniert wer partizipiert was resultiert. 1. Aufl. Altstätten: Tobler.
Ja zu Schengen-Dublin. Schweizer Stimmberechtigte nehmen bilaterales Abkommen an (2005). NZZ Online. Online verfügbar unter http://www.nzz.ch/2005/06/03/il/newzzE9IGBB9J-12.html.
Schiller, Theo (2002): Direkte Demokratie. Forschung und Perspektiven. 1. Aufl. Wiesbaden: Westdt.-Verl.
SF - Schweizer Fernsehen (Hg.) (2006): Angst um 700-jährigen Bundesbrief. Christoph Mörgeli will «Amerikareise» von Dokument verhindern. Online verfügbar unter http://tagesschau.sf.tv/sf_tagesschau/nachrichten/archiv/2006/03/14/vermischtes/angst_um_700_jaehrigen_bundesbrief, zuletzt geprüft am 14. März 2006, 16:38.
Tocqeville, Alexis de (2005): Bericht über die Demokratie in der Schweiz. In: Berliner Journal für Soziologie, H. 4, S. 447–458.
Tocqueville, Alexis ¬de (2004): Über die Demokratie in Amerika. Stuttgart: Reclam.
Trechsel, Alexander (1999): Volksabstimmungen. In: Klöti, Ulrich (Hg.): Handbuch der Schweizer Politik. Zürich: NZZ-Verl., S. 558–585.
Vatter, Adrian (1999): Föderalismus. In: Klöti, Ulrich (Hg.): Handbuch der Schweizer Politik. Zürich: NZZ-Verl., S. 78–104.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Mythos Schweiz, wie in diesem Text beschrieben?
Der Mythos Schweiz bezieht sich auf die Vorstellungen, die Schweizer über ihr Land, ihre Staats- und Gesellschaftsform und ihre Rolle in der Welt haben. Diese Vorstellungen sind historisch gewachsen und wurden immer wieder angepasst, um Nationalgefühl und gemeinsame Identität zu stärken.
Wie entstand die Eidgenossenschaft laut diesem Dokument?
Die Eidgenossenschaft entstand nicht durch einen einzelnen Gründungsakt wie den Bundesbrief von 1291, sondern schrittweise über Jahrhunderte hinweg. Der Bundesbrief war eher ein Verteidigungsbündnis als eine Staatsgründungsurkunde.
Welche Rolle spielte die demokratische Tradition in der Schweiz?
Obwohl die Schweiz vor 1798 nicht als Demokratie im heutigen Sinne bezeichnet werden konnte, gab es seit dem 15. Jahrhundert demokratische Elemente, insbesondere in den Landsgemeinden, die das kommunale Bewusstsein prägten.
Wie beeinflusste Frankreich die Freiheit der Schweiz?
Die französische Revolution und die anschließende Besetzung der Schweiz brachten die revolutionäre Idee der Freiheit und Gleichheit in das Land, was tiefgreifende gesellschaftliche Folgen hatte und die künftigen Verfassungen prägte.
Was versteht man unter dem Mythenkult in der Schweiz?
Der Mythenkult bezeichnet die Pflege und Verehrung von Sagen, Symbolen und Mythen, die zur Stiftung einer nationalen Identität und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Schweiz beitragen, besonders in Krisenzeiten.
Was bedeutet Föderalismus in der Schweiz?
Der Föderalismus in der Schweiz ist mehr als nur eine Staatsorganisation. Er ist ein institutionalisiertes Prinzip, das die Spannung zwischen Individualität und gesellschaftlicher Zugehörigkeit überwinden soll und identitätsstiftende Funktionen hat.
Wie funktioniert die direkte Demokratie auf Bundesebene?
Auf Bundesebene gibt es das obligatorische Referendum für Verfassungsänderungen und bestimmte Staatsverträge sowie das fakultative Referendum, das durch 50.000 Bürger oder acht Kantone initiiert werden kann, um über Bundesgesetze abzustimmen.
Wie funktioniert die direkte Demokratie auf Kantonsebene?
Auf Kantonsebene gibt es ähnliche Regelungen wie auf Bundesebene, aber oft mit weiterreichenden Einflussmöglichkeiten für die Bevölkerung, wie z.B. die Gesetzesinitiative und obligatorische Referenden bei Gesetzesänderungen.
Welche Argumente gibt es für und gegen direkte Demokratie?
Argumente für direkte Demokratie sind die Stärkung der politischen Partizipation und die höhere Akzeptanz von Reformen. Argumente gegen direkte Demokratie sind die lange Dauer der Entscheidungsprozesse, die Gefahr einer "Tyrannei der Mehrheit" und der Einfluss von Interessengruppen.
Wie stark ist der Einfluss von Interessenverbänden und Medien auf die Entscheidungsfindung in der Schweiz?
Interessenverbände können durch Referenden und Initiativen Einfluss nehmen, aber ihr Einfluss ist nicht größer als in rein repräsentativen Systemen. Medienkampagnen können die Meinungsbildung beeinflussen, aber die Bevölkerung ist oft resistent gegen zu plumpe Propaganda.
Was bedeutet "Tyrannei der Mehrheit" im Kontext der direkten Demokratie in der Schweiz?
Die "Tyrannei der Mehrheit" bezieht sich auf die Gefahr, dass die Mehrheit die Interessen von Minderheiten unterdrückt. Dies kann in der Schweiz durch die dominante Ideologie und den Einfluss von Propaganda verstärkt werden, wird aber durch den Föderalismus und die vielfältige Medienlandschaft begrenzt.
Ist die Schweiz ein Vorbild für Demokratie in Europa?
Die Schweiz hat ein einzigartiges politisches System entwickelt, das auf ihre spezifischen Verhältnisse zugeschnitten ist. Es gibt keine perfekte Demokratie, aber die Schweiz kann Europa in Bezug auf Partizipation und Mitsprache bei Entscheidungen wertvolle Lehren erteilen.
- Quote paper
- Benjamin Peschke (Author), 2007, Über die Demokratie in der Schweiz. Der Mythos und die politische Kultur in der halb-direkten Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443757