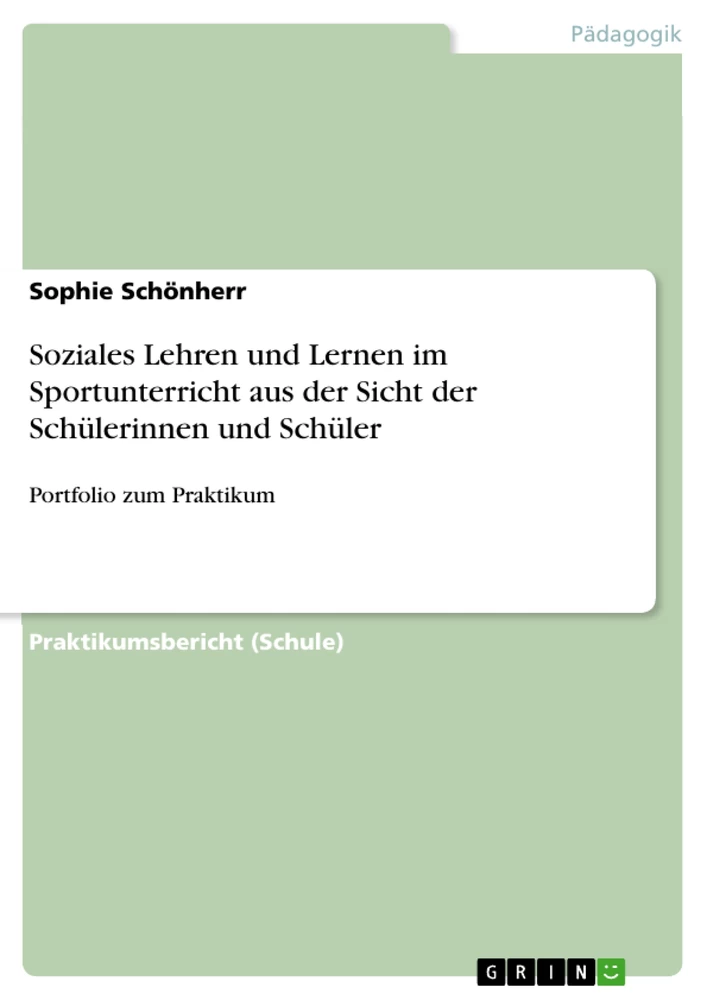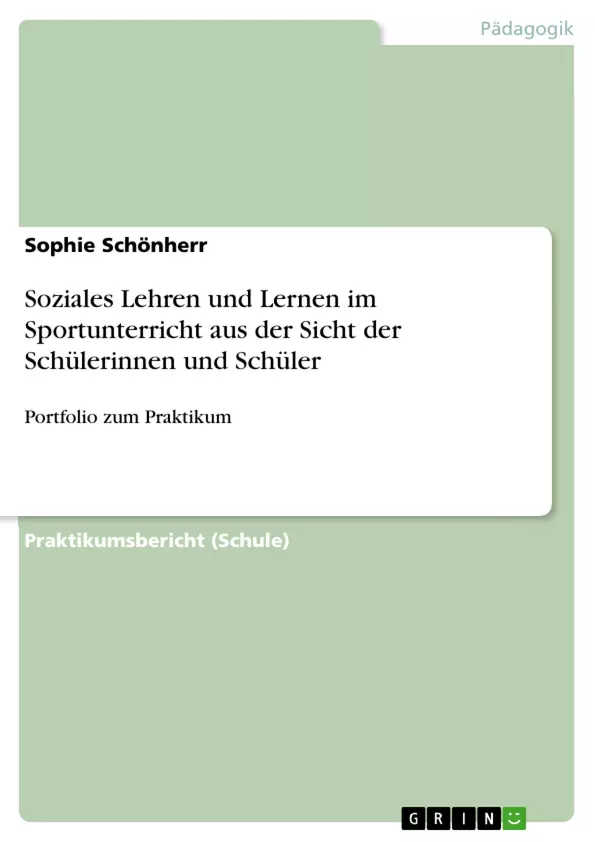Dieses Portfolio ist in zwei Teile gegliedert. Der erste beinhaltet den Weg, die Ausführung und die Interpretation des Forschungsprojektes zum Thema soziales Lehren und Lernen im Sportunterricht. Der andere Teil handelt von der professionellen Lehrkompetenz am Beispiel des Coactiv Modells von Baumert und Kunter aus dem Jahr 2011, welches in dieser Arbeit anhand des Vor- und Nachbereitungsseminar analysiert und interpretiert wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretische Hintergründe
- Methodik
- Design
- Operationalisierung
- Auswertung
- Ergebnisse
- Die Ergebnisse der einzelnen Klassenstufen
- Korrelation zwischen dem Geschlecht und der Bedeutsamkeit des sozialen Lernens
- Diskussion und Schlussfolgerung
- Abschließende Reflexion zum Modul mit dem Schwerpunkt „Professionelle Kompetenz von Lehrkräften“
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieses Forschungsprojekt untersucht die Bedeutsamkeit des sozialen Lernens im Sportunterricht aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler. Es zielt darauf ab, die Relevanz des sozialen Lernens für die SuS im Kontext des Sportunterrichts zu beleuchten und zu analysieren, inwieweit sie dieses als Lernziel sehen.
- Die Relevanz des sozialen Lernens im Sportunterricht
- Die Perspektive der Schülerinnen und Schüler auf das soziale Lernen im Sportunterricht
- Die Übereinstimmung der Lernziele des Rahmenlehrplans mit den Vorstellungen der SuS
- Die Bedeutung des sozialen Lernens für die Entwicklung sozialer Kompetenzen
- Die Förderung der Handlungsfähigkeit im Sport durch soziales Lernen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des sozialen Lernens im Sportunterricht und stellt die Forschungsfrage vor. Die theoretischen Hintergründe setzen sich mit dem Konzept des sozialen Lernens im Sportunterricht auseinander und beschreiben die Methodik der Untersuchung. Die Ergebnisse präsentieren die Analyse der Daten und beleuchten die Bedeutsamkeit des sozialen Lernens aus Sicht der SuS. Die Diskussion und Schlussfolgerung reflektieren die Ergebnisse und erörtern die Implikationen für die Praxis des Sportunterrichts. Abschließend wird eine Reflexion zum Modul mit dem Schwerpunkt „Professionelle Kompetenz von Lehrkräften“ gegeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Soziales Lernen, Sportunterricht, Schülerinnen und Schüler, Lernziele, Handlungsfähigkeit, Kooperation, Fairness, Verständigung, Rahmenlehrplan, Motivation, Forschungsfrage, Hypothese, Empirie, Studie, Fragebogen.
- Citation du texte
- Sophie Schönherr (Auteur), 2018, Soziales Lehren und Lernen im Sportunterricht aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443884