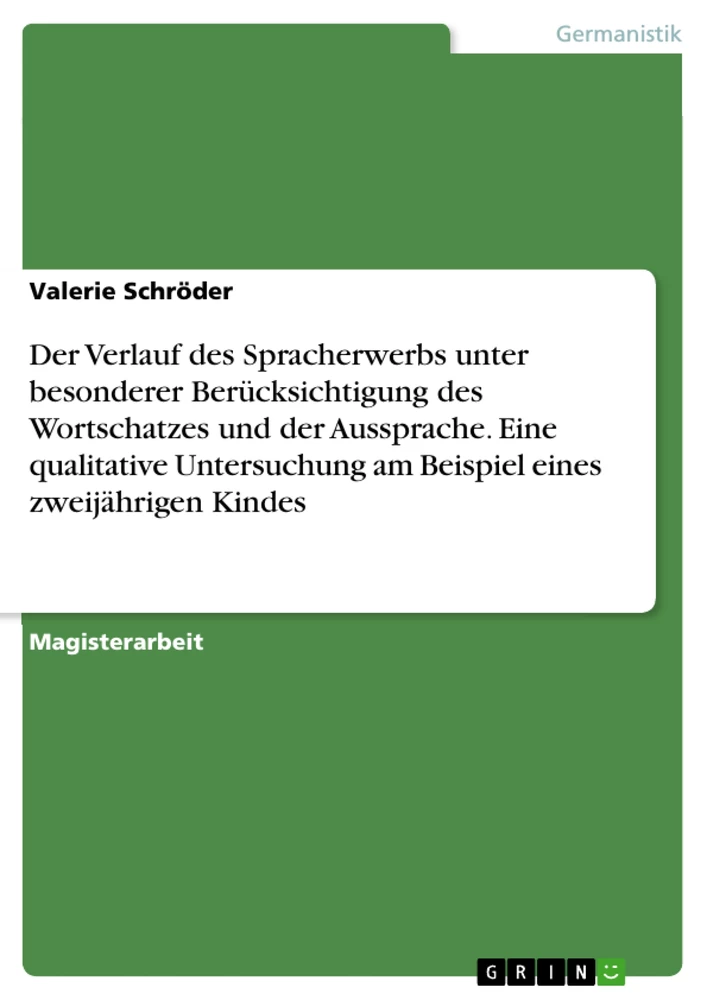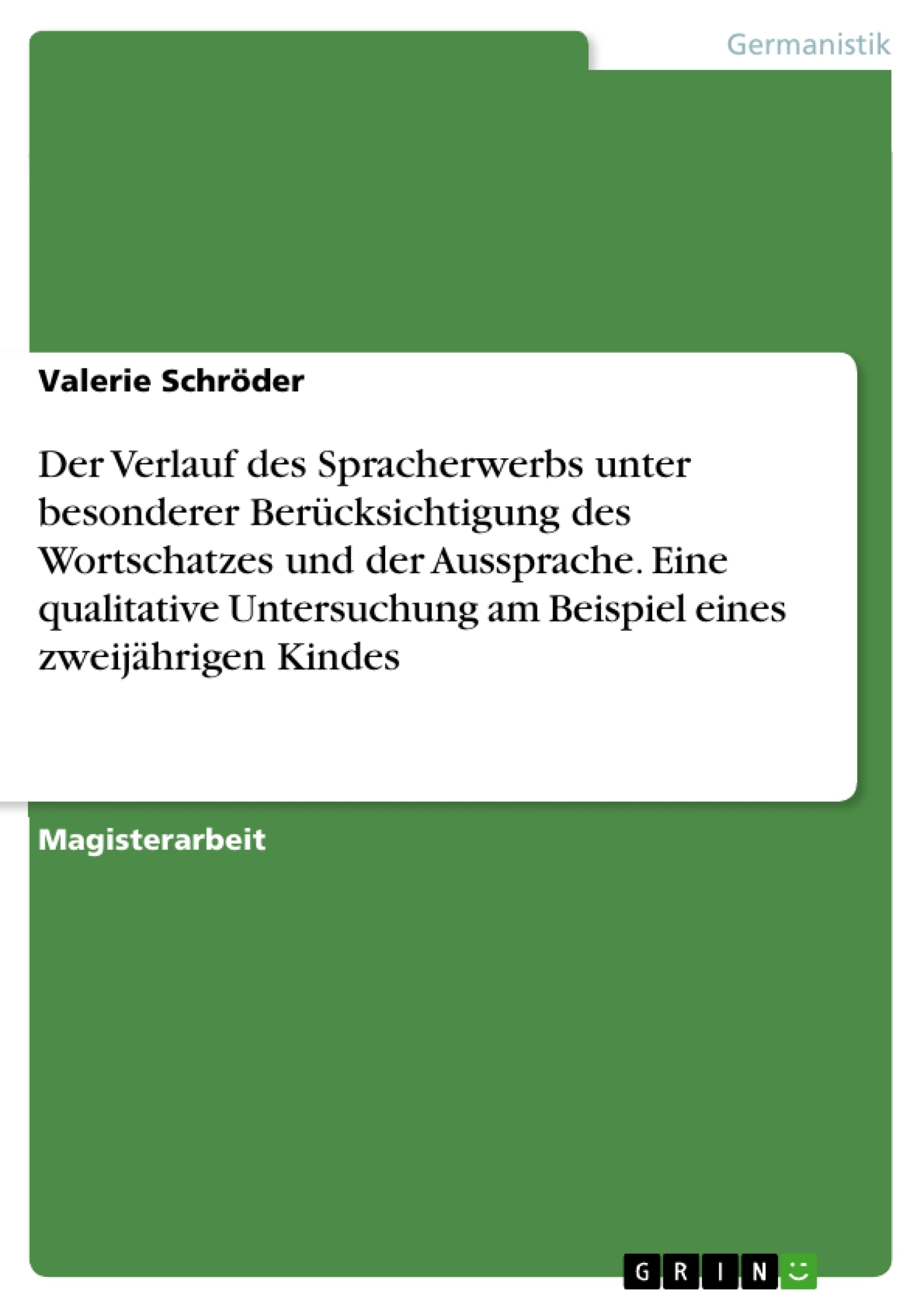Die Sprache ist der Mittelpunkt des menschlichen Lebens und verleiht diesem Sinn und Ziel. Durch die Sprache ist der Mensch dazu in der Lage zu kommunizieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und somit eine Verbindung zur Welt aufzubauen. Demnach ist Sprache ein Kommunikationssystem, das von Menschen genutzt wird, um sich etwas mitteilen zu können. Diese übergeordnete Bedeutung von Sprache und deren Erwerb ist Teil der Spracherwerbsforschung, deren Fokus auf der Frage liegt, wie es Kindern gelingt, den komplexen Erwerb von Sprache zu bewältigen. Hierbei ist besonders der Spracherwerb von Kindern im Fokus der Forschung, der sich in verschiedene Themenbereiche unterteilt. Die unterschiedlichen Gesichtspunkte sollen in dieser Arbeit genauer untersucht werden. Dabei spielen die einzelnen Entwicklungsschritte im Verlauf des Spracherwerbs eine entscheidende Rolle, die sich charakteristisch einordnen lassen und in unterschiedliche zeitliche Abschnitte gliedern lassen. Diese Abschnitte sind individuell auf jedes Kind anzupassen, da der Spracherwerb von jedem Kind unterschiedlich bewältigt wird. Jedoch lassen sich in der Literatur viele zeitliche Angaben finden, die einen zeitlichen Rahmen spannen, um eine Kategorisierung vorzunehmen. Diese zeitlich variierenden Angaben werden durch unterschiedliche Studien und Forschungen präzisiert, wodurch es möglich geworden ist, Aussagen zu treffen und Altersangaben zu machen. Die Altersangaben sind besonders wichtig für praktische Untersuchungen, da dadurch eine allgemeine Kategorisierung vorgenommen werden kann, welche jedoch nicht in jedem Fall als allgemein gültig zu betrachten ist. Der individuelle Hintergrund des Kindes muss in jedem Fall mit einbezogen werden. Auch im Rahmen dieser Arbeit liegt ein Fokus auf der bereits vorhandenen Literatur, um einen Vergleich mit den vorliegenden Ergebnissen vorzunehmen. Die Arbeit setzt sich demnach zum Ziel, zunächst einen theoretischen Überblick über den Verlauf des Spracherwerbs zu geben, um darauf abbauend einen praktischen Forschungsteil mit einem zweijährigen Kind durchzuführen. Der Fokus liegt hierbei auf der Erläuterung des theoretischen Teils anhand der Einzelfallforschung. Daraus resultierend sollen Aussagen über den Sprachstand des Probanden getroffen werden, die wissenschaftlich fundiert sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Phasen des Spracherwerbs
- 2.1 Lauterwerb
- 2.1.1 Der kompetente Säugling
- 2.1.2 Die Entwicklung des Sprechapparats
- 2.1.3 Vorsprachliche Phase
- 2.2 Entwicklung des phonologischen Systems
- 2.3 Wortschatzerwerb
- 2.3.1 Nichtsprachliche Mittel der Referenz und Vorformen des Benennens
- 2.3.2 Erwerb der ersten 50 Wörter
- 2.3.3 Vokabularspurt
- 2.3.4 Der frühe produktive Wortschatz
- 2.3.5 Bevorzugte Wortklassen im Verlauf
- 2.4 Syntaxerwerb
- 2.4.1 Einwortäußerungen
- 2.4.2 Zweiwortäußerungen
- 2.4.3 Drei- und Mehrwortäußerungen
- 2.4.4 Komplexe Syntax
- 3. Praxisbezug: Empirische Forschung mithilfe einer Fallstudie
- 3.1 Fragestellungen
- 3.2 Rahmenbedingungen
- 3.3 Beschreibung und Einschätzung des Probanden
- 3.4 Materialien
- 3.5 Methoden zur Datenerhebung
- 3.5.1 Beobachtungsverfahren Off-line: Videoaufnahmen
- 3.5.2 Beobachtungsverfahren Off-line: Tagebuchstudien
- 3.5.3 Befragungsverfahren: FRAKIS – Elternfragebogen
- 4. Darstellung der Ergebnisse
- 4.1 Tagebuchaufzeichnungen
- 4.2 Wortschatzzuwachs und Wortarten (Videoaufnahmen und FRAKIS)
- 4.3 Bevorzugte Inhalte im Lexikon
- 4.4 Wortschatzspurt
- 4.5 Phonologische Entwicklung
- 5. Auswertung der Ergebnisse
- 5.1 Wortschatzzuwachs und Wortarten
- 5.2 Bevorzugte Inhalte im Lexikon
- 5.3 Wortschatzspurt
- 5.4 Tagebuchaufzeichnungen
- 5.5 Phonologische Entwicklung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Verlauf des Spracherwerbs bei einem zweijährigen Kind, mit besonderem Fokus auf Wortschatz und Aussprache. Ziel ist es, einen theoretischen Überblick über den Spracherwerb zu geben und diesen mit einer empirischen Fallstudie zu verknüpfen. Die Ergebnisse sollen den Sprachstand des Kindes wissenschaftlich fundiert beschreiben und Übereinstimmungen bzw. Abweichungen von der bestehenden Literatur aufzeigen.
- Theoretische Grundlagen des Spracherwerbs
- Entwicklung von Wortschatz und Aussprache
- Qualitative Untersuchung anhand einer Fallstudie
- Vergleich empirischer Daten mit theoretischen Modellen
- Analyse des individuellen Spracherwerbsverlaufs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Spracherwerbs ein und betont die zentrale Rolle der Sprache im menschlichen Leben. Sie hebt die Bedeutung der Spracherwerbsforschung hervor und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit: einen theoretischen Überblick über den Spracherwerb gefolgt von einer empirischen Untersuchung an einem zweijährigen Kind. Die Einleitung verdeutlicht den Fokus auf Wortschatz und Aussprache und kündigt die Methode der Fallstudie an, die den Vergleich zwischen theoretischen Modellen und empirischen Daten ermöglichen soll.
2. Phasen des Spracherwerbs: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Phasen des Spracherwerbs. Es beschreibt detailliert den Lauterwerb, beginnend mit den Fähigkeiten des Säuglings, über die Entwicklung des Sprechapparates bis hin zur vorsprachlichen Phase. Weiterhin werden die Entwicklung des phonologischen Systems, der Wortschatzerwerb (einschließlich des Vokabularspurts und der bevorzugten Wortklassen) und der Syntaxerwerb (von Einwort- bis hin zu komplexen Äußerungen) ausführlich behandelt. Das Kapitel stellt die verschiedenen Entwicklungsstufen dar und betont die individuelle Variabilität im Spracherwerbsprozess.
3. Praxisbezug: Empirische Forschung mithilfe einer Fallstudie: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es präsentiert die Forschungsfragen, die Rahmenbedingungen der Studie (den Probanden, die Materialien und Methoden). Die Datenerhebung basiert auf Videoaufnahmen, Tagebuchstudien und einem Elternfragebogen (FRAKIS). Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung der gewählten Methoden und ihrer Eignung zur Erfassung von Wortschatz und Ausspracheentwicklung.
4. Darstellung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es analysiert die Tagebuchaufzeichnungen, den Wortschatzzuwachs und die Wortarten (basierend auf Videoaufnahmen und FRAKIS), die bevorzugten Inhalte im Lexikon des Kindes, den Wortschatzspurt und die phonologische Entwicklung. Die Daten werden übersichtlich dargestellt, um den Lesern einen klaren Einblick in die Sprachentwicklung des Probanden zu geben.
5. Auswertung der Ergebnisse: Dieses Kapitel wertet die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse aus. Es analysiert den Wortschatzzuwachs und die Wortarten, die bevorzugten Inhalte im Lexikon des Kindes, den Wortschatzspurt und die phonologische Entwicklung im Detail. Die Auswertung stellt Bezüge zu den theoretischen Grundlagen des Kapitels 2 her und diskutiert Übereinstimmungen und Abweichungen. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Daten und deren Bedeutung im Kontext des individuellen Spracherwerbs.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Wortschatzerwerb, Phonologische Entwicklung, Syntaxerwerb, Qualitative Forschung, Fallstudie, Zweijähriges Kind, Aussprache, Vokabularspurt, Tagebuchstudie, Videoaufzeichnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Spracherwerbsstudie bei einem zweijährigen Kind
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Spracherwerb eines zweijährigen Kindes, konzentriert sich dabei besonders auf die Entwicklung des Wortschatzes und der Aussprache. Sie kombiniert einen theoretischen Überblick über den Spracherwerbsverlauf mit einer empirischen Fallstudie.
Welche Phasen des Spracherwerbs werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert verschiedene Phasen des Spracherwerbs: Lauterwerb (inklusive der Fähigkeiten von Säuglingen und der Entwicklung des Sprechapparats), die Entwicklung des phonologischen Systems, den Wortschatzerwerb (mit Vokabularspurt und bevorzugten Wortklassen) und den Syntaxerwerb (von Einwortäußerungen bis zu komplexen Sätzen).
Welche Methoden wurden in der empirischen Studie verwendet?
Die empirische Untersuchung nutzt verschiedene Methoden zur Datenerhebung: Videoaufnahmen, Tagebuchstudien und den Elternfragebogen FRAKIS. Diese Methoden ermöglichen eine umfassende Erfassung der Wortschatz- und Ausspracheentwicklung des Kindes.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie umfassen Analysen der Tagebuchaufzeichnungen, des Wortschatzzuwachses und der Wortarten, der bevorzugten Inhalte im Lexikon des Kindes, des Wortschatzspurts und der phonologischen Entwicklung. Diese Daten werden sowohl deskriptiv dargestellt als auch im Hinblick auf theoretische Modelle ausgewertet.
Wie werden die Ergebnisse ausgewertet?
Die Auswertung der Ergebnisse stellt einen Bezug zu den theoretischen Grundlagen her und diskutiert Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen den empirischen Daten und den theoretischen Modellen des Spracherwerbs. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Daten im Kontext des individuellen Spracherwerbsverlaufs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spracherwerb, Wortschatzerwerb, Phonologische Entwicklung, Syntaxerwerb, Qualitative Forschung, Fallstudie, Zweijähriges Kind, Aussprache, Vokabularspurt, Tagebuchstudie, Videoaufzeichnung.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, den Sprachstand des Kindes wissenschaftlich fundiert zu beschreiben und Übereinstimmungen bzw. Abweichungen von der bestehenden Literatur aufzuzeigen, indem ein theoretischer Überblick über den Spracherwerb mit einer empirischen Fallstudie verknüpft wird.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Phasen des Spracherwerbs, Praxisbezug: Empirische Forschung mithilfe einer Fallstudie, Darstellung der Ergebnisse, Auswertung der Ergebnisse und Fazit.
- Quote paper
- Valerie Schröder (Author), 2017, Der Verlauf des Spracherwerbs unter besonderer Berücksichtigung des Wortschatzes und der Aussprache. Eine qualitative Untersuchung am Beispiel eines zweijährigen Kindes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443947