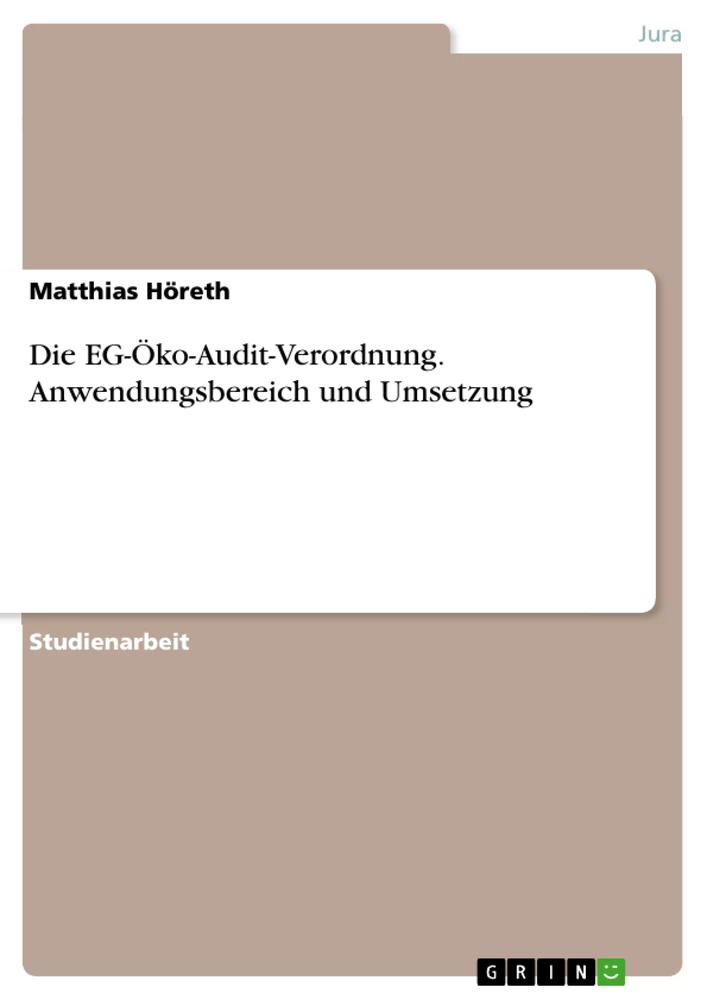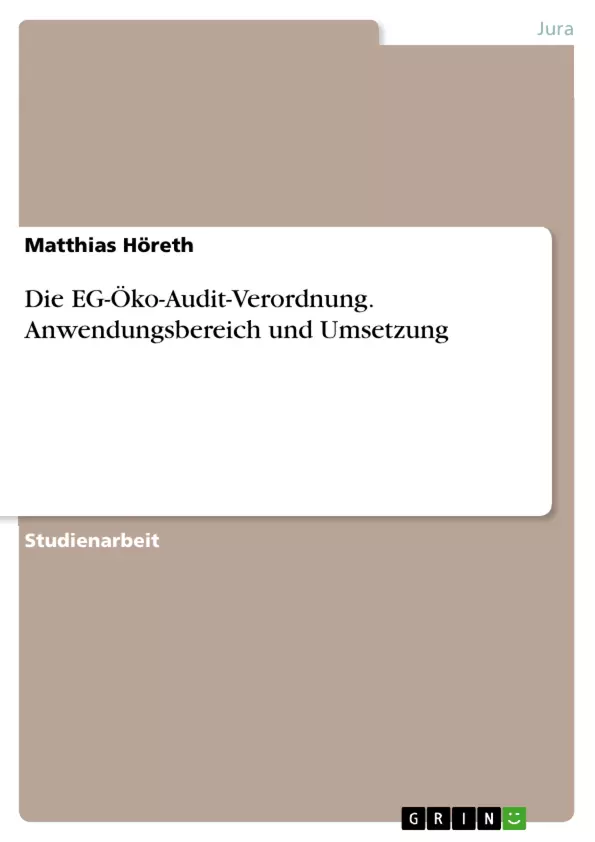In der umweltrechtlichen Diskussion nimmt derzeit die Debatte um das Öko-Audit breiten Raum ein1. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, daß diese Systeme einerseits relativ neu sind und andererseit süber den Rahmen des bislang in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Umweltrechts hinausgehen.
In der Bundesrepublik Deutschland wurde das Umweltrecht bisher überwiegend als reines Ordnungsrecht verstanden. Hauptziel war die Verhinderung bestimmter Emissionen bzw. die Einhaltung bestimmter Grenzwerte. Ein Handeln, welches über die Einhaltung der Grenzwerte hinausging, im Ergebnis also zu geringeren Emissionen als gesetzlich vorgeschrieben führte, wurde auf diesem Wege nicht erreicht.
Angesichts der Vielfalt umweltrelevanter Tätigkeiten erwies sich die Vorstellung, diese seien alle durch materielle Vorgaben (z.B. Grenzwerte für Emissionen in Luft, Abwasser, Abfall) "in den Griff zu bekommen" zunehmend als unrealistisch.
Die Verursacher, insbesondere die Betriebe, können in diesem ordnungsrechtlichen System als "black boxes" bezeichnet werden, die umweltrechtlicherseits nicht geöffnet werden. Das System des Öko-Auditssoll gerade dies erreichen. Diese "black box" soll geöffnet werden, indemdie Betriebe Anreize zur Verbesserung ihres umweltrelevanten Handelns erhalten.
In der hier vorliegenden Arbeit soll insbesondere die EG-Öko-Audit Verordnung beleuchtet werden, deren Instrumentarium in den Nationalstaaten bis April 1995 bereitstehen sollte. Aufgrund der kurzen Zeitspanne seit der tatsächlichen Wirksamkeit der Verordnung sowie der zögerlichen Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland kann eine Bewertung der Öko-Audit Verordnung bislang nicht anhand praktischer Erfahrungen in der Umsetzung erfolgen, sondern lediglich aufgrund einer Einschätzung der im Verordnungstext bestimmten Vorschriften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff des Öko-Audits
- Öko-Audits in den USA
- Weitere internationale Audit-Aktivitäten
- Die Öko-Audit-VO der europäischen Gemeinschaft
- Grundlage der VO
- Anwendungsbereich
- Freiwilligkeit
- Unternehmenssparten
- Standortbezogenheit
- Ablauf des EG-Öko-Audits
- Umweltpolitik
- erste Umweltprüfung
- Umweltschutzinstrumentarium
- Umweltziele
- Umweltprogramm
- Umweltmanagementsystem
- Umweltbetriebsprüfung Audit
- Gültigkeitserklärung
- Anforderungen
- Umweltgutachter
- Umwelterklärung
- Rechtsfolgen
- Weitere wesentliche Normen der Öko-Audit-VO
- Umsetzung der Öko-Audit-VO im deutschen Rechtssystem
- Anforderungen an ein Umsetzungsgesetz
- Diskussionsstand
- Behördenmodell
- Wirtschaftsnahe Lösung
- Derzeit favorisierter Ansatz
- Einschätzungen und Kritik
- Freiwilligkeit der Teilnahme und Anreizfunktion
- Anforderungen der Öko-Audit-VO
- Publizität der Ergebnisse
- Deregulierungsdebatte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die EG-Öko-Audit-Verordnung und analysiert die Relevanz des Öko-Audits im Kontext des Umweltrechts. Sie beleuchtet die Entstehung, die Inhalte und die Umsetzung der Verordnung sowie die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen.
- Die Entwicklung und Bedeutung des Öko-Audits im Kontext des Umweltrechts
- Die Inhalte und Vorgaben der EG-Öko-Audit-Verordnung
- Die Umsetzung der Verordnung im deutschen Rechtssystem
- Die kritische Bewertung des Öko-Audits als Instrument des Umweltschutzes
- Die Rolle des Öko-Audits in der Deregulierungsdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Öko-Audit ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext des Umweltrechts heraus. Dabei wird die Entwicklung des Umweltrechts in Deutschland und die Bedeutung des Öko-Audits als Instrument zur Verbesserung des Umweltschutzes dargestellt.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff des Öko-Audits und beleuchtet die verschiedenen Ansätze und Konzepte, die in der internationalen Diskussion zum Öko-Audit existieren.
Im dritten Kapitel werden die Erfahrungen mit Öko-Audits in den USA vorgestellt und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum europäischen Ansatz des Öko-Audits beleuchtet.
Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über weitere internationale Audit-Aktivitäten, die im Bereich des Umweltschutzes stattfinden und wichtige Impulse für die Entwicklung des europäischen Öko-Audits liefern.
Das fünfte Kapitel stellt die EG-Öko-Audit-Verordnung im Detail vor. Es werden die rechtlichen Grundlagen, der Anwendungsbereich, die zentralen Elemente des Auditprozesses sowie die Rechtsfolgen der Teilnahme am Öko-Audit erläutert.
Das sechste Kapitel behandelt die Umsetzung der EG-Öko-Audit-Verordnung im deutschen Rechtssystem. Es werden die Anforderungen an ein Umsetzungsgesetz sowie die verschiedenen Modelle zur Implementierung des Öko-Audits in Deutschland diskutiert.
Das siebte Kapitel bietet eine kritische Einschätzung und Bewertung des Öko-Audits. Es werden die Vor- und Nachteile des Systems, die Anforderungen der Verordnung und die Relevanz des Öko-Audits im Kontext der Deregulierungsdebatte diskutiert.
Schlüsselwörter
Öko-Audit, Umweltrecht, Umweltmanagement, Umweltbetriebsprüfung, EG-Öko-Audit-Verordnung, Freiwilligkeit, Anreizfunktion, Deregulierung, Emissionen, Grenzwerte, Unternehmen, Nachhaltigkeit
Häufig gestellte Fragen
Was ist die EG-Öko-Audit-Verordnung (EMAS)?
Es ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen Gemeinschaft, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern und über die gesetzlichen Grenzwerte hinaus aktiv zu werden.
Wie läuft ein Öko-Audit ab?
Der Prozess umfasst die Festlegung einer Umweltpolitik, eine erste Umweltprüfung, die Einrichtung eines Umweltmanagementsystems, eine interne Betriebsprüfung und schließlich eine externe Validierung durch einen Umweltgutachter.
Was ist das Ziel der Umwelterklärung?
Unternehmen müssen ihre Umweltdaten und -ziele veröffentlichen (Publizität), um Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und Behörden zu schaffen und ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.
Was bedeutet 'Deregulierungsdebatte' im Kontext des Öko-Audits?
Es wird diskutiert, ob Unternehmen, die erfolgreich am Öko-Audit teilnehmen, im Gegenzug Erleichterungen bei staatlichen Kontrollen oder Genehmigungsverfahren erhalten sollten.
Wie unterscheidet sich das Öko-Audit vom klassischen Ordnungsrecht?
Das Ordnungsrecht setzt starre Grenzwerte (Black Box). Das Öko-Audit hingegen öffnet den Betrieb durch Anreize zur Eigenverantwortung und kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes.
- Quote paper
- ass. jur. Matthias Höreth (Author), 1995, Die EG-Öko-Audit-Verordnung. Anwendungsbereich und Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4440