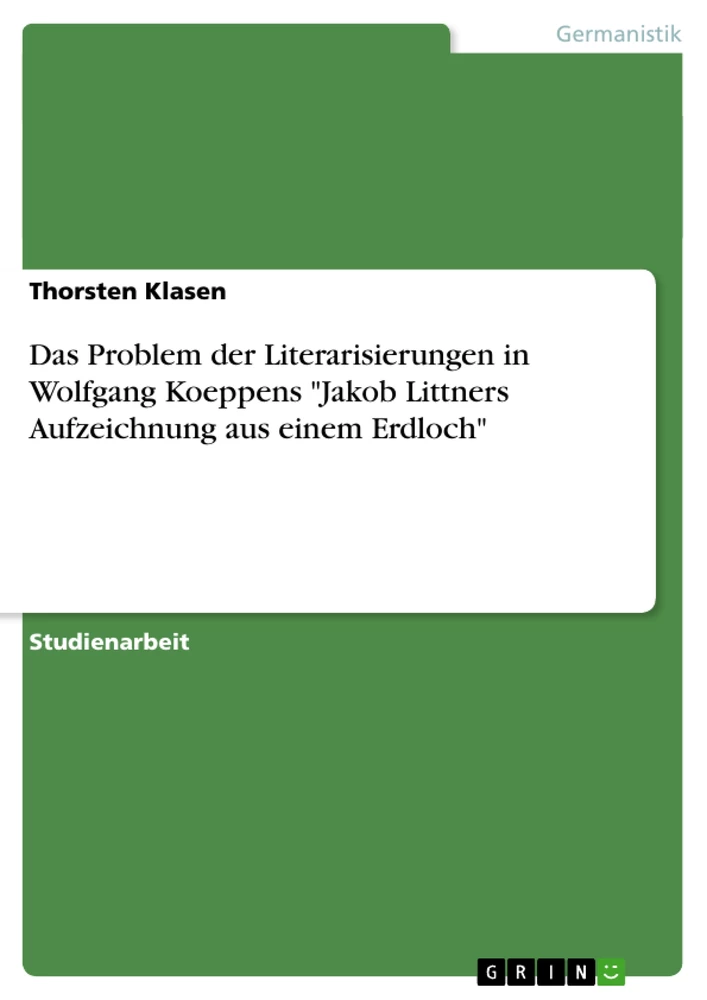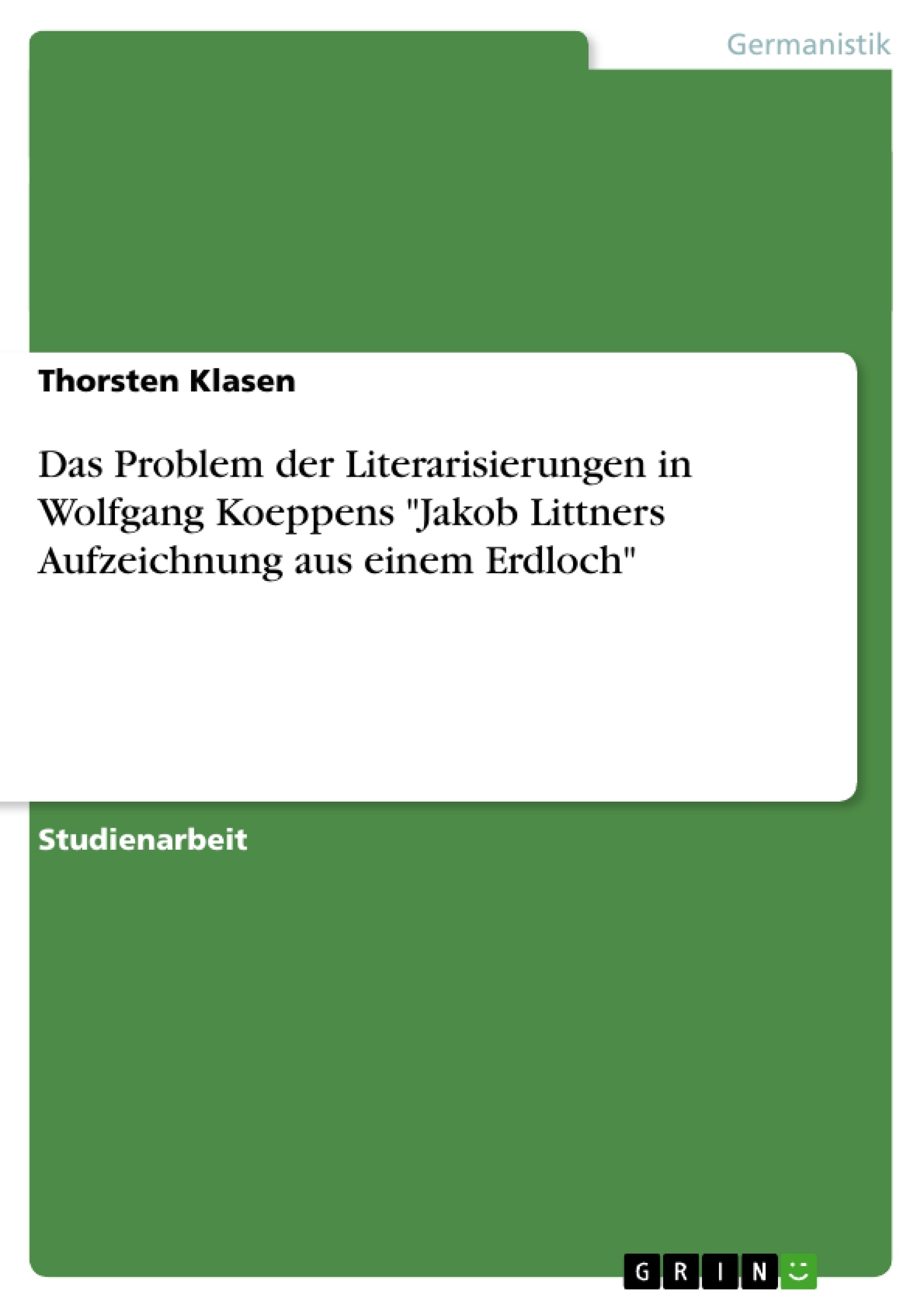In der frühen Literatur überlebender Opfer der Shoah nach 1945 stechen bestimmte Besonderheiten ihrer Texte hervor. Es handelt sich um authentische Erlebnisberichte der ›Kronzeugen‹ des Holocausts. Sie zeichnen sich aus durch einen oftmals nüchternen, dokumentarisch-sachlichen, darstellenden Stil. Es wird berichtet über das Leiden in Konzentrationslagern und Ghettos. Diese frühen Dokumente sind geprägt von der Idee, das Andenken an die Opfer des Holocausts aufrecht zu erhalten und – wichtiger noch – die verantwortlichen Täter zu nennen und sie somit individuell verantwortbar für ihre Verbrechen zu machen.
Wie man heute weiß, sind die Aufzeichnungen in Hinblick auf Authentizität des Erlebten in dem Bewusstsein zu lesen, dass ein Erlebnisbericht des realen Littner im Hintergrund in Form eine 183-seitigen Typoskripts existierte Dieses wurde aber literarisch von Wolfgang Koeppen überarbeitet und zu einer neuen Geschichte – Koeppens Geschichte, wie er selbst sagt, zu seinem ›Roman‹.1
Ziel dieser Arbeit ist, diese Transformation darzulegen, die Unterschiede zwischen
Koeppens ›Roman‹ und Littners Originalmanuskript herauszuarbeiten und die Fragen zu beantworten: Ist es für die historische Beurteilung der Shoah problematisch, ein literarisch bearbeitetes Zeitzeugnis 1948 als authentischen Erlebnisbericht auszuweisen? Und warum bekennt sich Koeppen damals nicht namentlich zu seiner Autorschaft, wie es beispielsweise bei Hilde Huppert / Arnold Zweig2 der Fall war? Methodisch sollen beide Texte exemplarisch auf literarisierende Eingriffe Koeppens verglichen und analysiert werden, nach allgemeinen und detaillierten sowie formalen und inhaltlichen Aspekten.
1 Koeppen (1992, 1994, 2002) ›Vorwort‹.
2 Huppert (1990)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung...
- Chronologische Übersicht der verschiedenen Ausgaben…...
- Entstehungsphase beider Texte………...
- Transformation: vom Erlebnisbericht Bericht zum >Roman<.
- Textvergleich und Analyse ……..\li>
- Erste Texpassage: Littners Verhaftung..\li>
- Zweite Textpassage: Zugfahrt zur polnischen Grenze..\li>
- Dritte Textpassage: Littner in Prag.....
- Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse..\li>
- Fazit....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der literarischen Transformation eines authentischen Erlebnisberichts von Jakob Littner, einem deutsch-jüdischen Briefmarkenhändler, der die Schrecken des NS-Terrors erlebte. Die Arbeit analysiert die Unterschiede zwischen Littners Originalmanuskript und Wolfgang Koeppens literarischer Bearbeitung desselben, die 1948 unter dem Titel „Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch" erschien.
- Die Frage nach der Authentizität eines literarisch bearbeiteten Zeitzeugnisses im Kontext der historischen Beurteilung der Shoah
- Der Einfluss von Koeppens literarischem Eingriff auf die Darstellung von Littners Geschichte
- Die Rolle von Koeppens literarischem Eingriff bei der Entstehung eines „Romans" aus einem Erlebnisbericht
- Die gesellschaftlichen und politischen Faktoren der frühen Nachkriegszeit, die die Entstehung beider Texte beeinflusst haben
- Der Vergleich beider Texte hinsichtlich ihrer formalen und inhaltlichen Aspekte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die besondere Bedeutung der frühen Literatur überlebender Opfer der Shoah nach 1945 vor und geht auf die typischen Merkmale dieser Texte ein, wie den dokumentarischen Stil und die Betonung der individuellen Verantwortung der Täter. Es werden wichtige Dokumente aus dieser Zeit erwähnt, darunter Walter Pollers Arbeit über die Notwendigkeit, die Verbrechen des Nationalsozialismus aufzudecken und aufzuzeigen.
- Chronologische Übersicht der verschiedenen Ausgaben: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Ausgaben von „Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch", beginnend mit der Erstausgabe von 1948. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ausgaben werden hervorgehoben, insbesondere die Hinzufügung von Vorworten und die Kennzeichnung des Werks als „Roman" in späteren Ausgaben.
- Entstehungsphase beider Texte: Dieses Kapitel beleuchtet den gesellschaftlichen und politischen Kontext der frühen Nachkriegsjahre, die die Entstehung von Littners und Koeppens Texten beeinflusst haben könnten. Die Entstehung von Littners Manuskript „Mein Weg durch die Nacht" wird in Verbindung mit der sozialer Lage und der inneren Spaltung Deutschlands im Jahr 1945 dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit umfassen die Authentizität von Zeitzeugnissen im Kontext der Shoah, die literarische Bearbeitung von Erlebnisberichten, die Transformation von Texten, die Rolle von Autoren und die historischen, sozialen und politischen Faktoren, die die Entstehung beider Texte beeinflusst haben. Die Arbeit untersucht die literarischen Mittel, die Koeppen verwendet, um aus Littners Originalmanuskript einen Roman zu schaffen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Jakob Littner?
Jakob Littner war ein deutsch-jüdischer Briefmarkenhändler und Überlebender der Shoah, dessen authentisches Manuskript die Basis für Wolfgang Koeppens Werk bildete.
Was ist das Problem der Literarisierung in Koeppens Werk?
Wolfgang Koeppen überarbeitete Littners sachlichen Erlebnisbericht literarisch und machte daraus einen „Roman“. Dies wirft Fragen zur Authentizität historischer Zeitzeugnisse auf.
Warum bekannte sich Koeppen 1948 nicht namentlich zur Autorschaft?
Die Arbeit untersucht die gesellschaftlichen und politischen Faktoren der Nachkriegszeit, die Koeppen dazu veranlassten, das Werk zunächst als authentischen Bericht Littners auszuweisen.
Wie unterscheiden sich Littners Original und Koeppens Bearbeitung?
Während Littners Typoskript dokumentarisch-nüchtern ist, nutzt Koeppen literarische Mittel, um die Geschichte zu dramatisieren und in eine romanhafte Form zu transformieren.
Ist die literarische Bearbeitung für die historische Beurteilung problematisch?
Die Arbeit analysiert, ob die Vermischung von Fakten und literarischer Fiktion die Glaubwürdigkeit von Shoah-Dokumenten in der frühen Nachkriegsliteratur beeinträchtigt.
- Citar trabajo
- Thorsten Klasen (Autor), 2004, Das Problem der Literarisierungen in Wolfgang Koeppens "Jakob Littners Aufzeichnung aus einem Erdloch", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44401