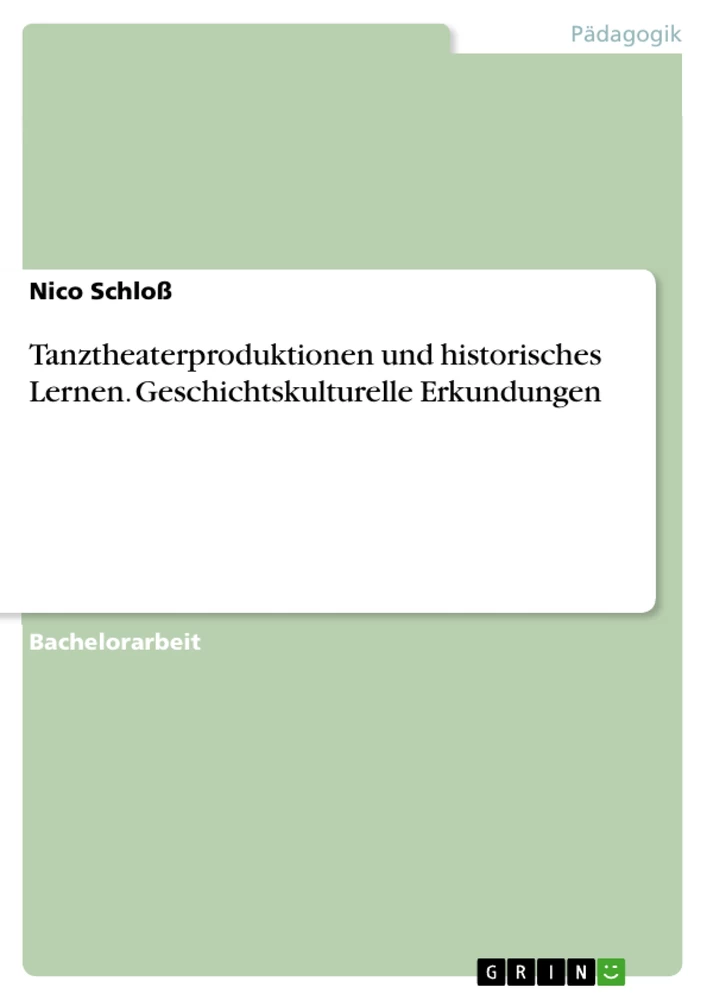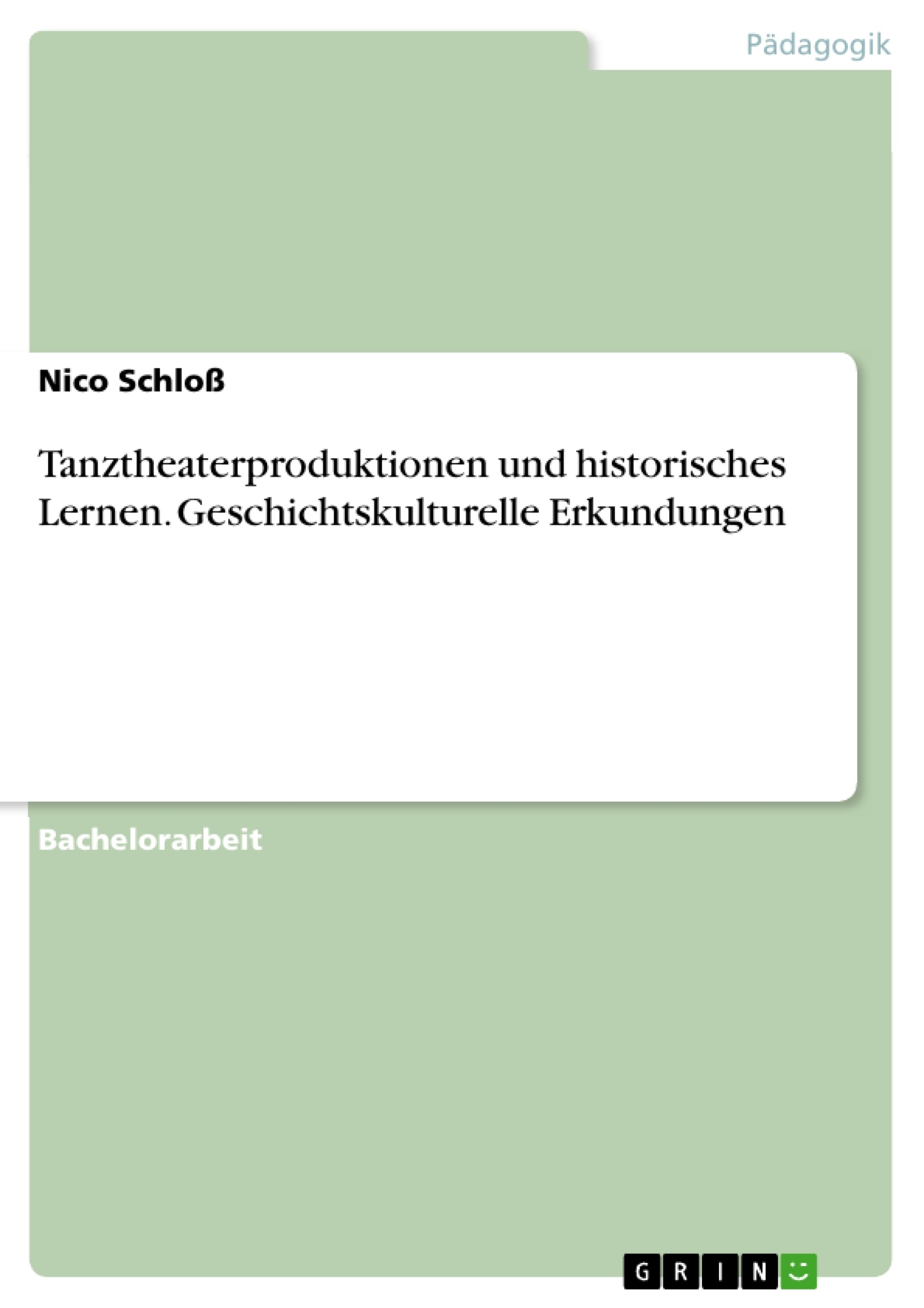Diese Ausarbeitung geht folgender Frage nach: In welcher Weise sind die Kriterien des normativen historischen Lernens, zur Kultivierung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins, in Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen konkret wiederzufinden? Der Beitrag versucht mit dieser analytischen Annäherung Beispiele tanztheatraler Techniken für Bildungseinrichtungen systematisch zu sammeln, die auf jenes historische Lernen zielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangslage und Rahmung
- 1.2 Erkenntnisinteresse
- 1.3 Stand der Forschung bzw. Desiderata
- 1.4 Erhebung und Auswertungsmethodik
- 1.5 Aufbau der Arbeit
- 2. Entwicklung der Definition zum normativen historischen Lernen
- 3. Grundlegende Begriffe: Geschichte, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur
- 4. Historisches Lernen
- 5. Definition zu Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen
- 5.1 Tanztheaterproduktionen im Allgemeinen
- 5.2 Tanztheaterproduktionen konkret bezogen auf historische Kontexte
- 5.3 Bedeutung und Nutzen des Tanztheaters für das historische Lernen: Mehrwert oder Fehlgriff?
- 6. Zuordnung tanztheatraler Verfahrensweisen zu den Kriterien des normativen historischen Lernens
- 6.1 Zugrunde gelegter Kriterienkatalog des historischen Lernens
- 6.2 Tabellarischer Überblick über die Zuordnung der Verfahrensweisen zu den Kriterien
- 6.3 Tanztheatrale Verfahrensweisen in Bezug auf den Konstruktionsprozess
- 7. Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Potenzial von Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen für normatives historisches Lernen. Sie analysiert, inwiefern die Kriterien des normativen historischen Lernens in solchen Produktionen wiederzufinden sind und systematisiert tanztheatrale Techniken, die auf dieses Lernen abzielen. Der Fokus liegt dabei auf den Lernprozessen von Tänzer*innen und Rezipient*innen.
- Analyse des Potenzials von Tanztheater für historisches Lernen
- Systematisierung tanztheatraler Techniken für historisches Lernen
- Anwendung der Kriterien des normativen historischen Lernens auf Tanztheaterproduktionen
- Untersuchung der Rolle von Tänzer*innen und Rezipient*innen im Lernprozess
- Beitrag zur Erweiterung des Forschungsfeldes historisches Lernen im Kontext von Tanztheater
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Boom von Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen auf deutschen und internationalen Bühnen dar und beleuchtet deren Bedeutung im Kontext des sinkenden Interesses an Geschichte bei Jugendlichen. Sie führt das Erkenntnisinteresse ein, welches die Frage nach der konkreten Wiederfindung der Kriterien des normativen historischen Lernens in Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen untersucht. Weiterhin wird der aktuelle Forschungsstand bezüglich des Themas beleuchtet und die Forschungslücke aufgezeigt.
2. Entwicklung der Definition zum normativen historischen Lernen: Dieses Kapitel wird sich voraussichtlich mit der Definition und Entwicklung des normativen historischen Lernens auseinandersetzen. Es wird die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse der Tanztheaterproduktionen liefern und Kriterien für erfolgreiches historisches Lernen definieren.
3. Grundlegende Begriffe: Geschichte, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur: Dieses Kapitel wird voraussichtlich die Schlüsselbegriffe "Geschichte", "Geschichtsbewusstsein" und "Geschichtskultur" definieren und ihren Zusammenhang erläutern. Es dient der Klärung terminologischer Grundlagen und der Einordnung des Forschungsgegenstands in einen breiteren Kontext der Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik.
4. Historisches Lernen: Dieses Kapitel wird voraussichtlich verschiedene Ansätze und Theorien zum historischen Lernen präsentieren. Es wird wahrscheinlich bestehende Konzepte und Modelle diskutieren und den theoretischen Rahmen für die Analyse der Tanztheaterproduktionen liefern. Die Diskussion wird wahrscheinlich den Zusammenhang zwischen historischen Lernen und dem Aufbau eines reflektierten Geschichtsbewusstseins beleuchten.
5. Definition zu Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen: Dieses Kapitel wird sich mit der Definition und den verschiedenen Facetten von Tanztheaterproduktionen befassen, die historische Bezüge aufweisen. Es wird unterschiedliche Arten von Tanztheaterproduktionen untersuchen, deren methodische Ansätze vergleichen und die spezifischen Merkmale solcher Produktionen im Vergleich zu rein theatralischen Aufführungen herausstellen.
6. Zuordnung tanztheatraler Verfahrensweisen zu den Kriterien des normativen historischen Lernens: Dieses Kapitel wird die Kernanalyse der Arbeit darstellen. Es wird die im vorherigen Kapitel definierten Kriterien des normativen historischen Lernens auf konkrete tanztheatrale Verfahrensweisen anwenden, um deren Beitrag zum historischen Lernen zu evaluieren. Eine systematische Zuordnung und Analyse der verschiedenen Verfahrensweisen wird erwartet, um die Effektivität des Tanztheaters als Medium des historischen Lernens zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Tanztheater, historisches Lernen, Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur, normative Lernprozesse, Reenactment, Bildung, Theaterpädagogik, außerschulisches Lernen, reflektiertes Geschichtsverständnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Potenzials von Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen für normatives historisches Lernen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Potenzial von Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen für normatives historisches Lernen. Der Fokus liegt auf der Analyse, inwiefern Kriterien des normativen historischen Lernens in solchen Produktionen wiederzufinden sind und wie tanztheatrale Techniken dieses Lernen unterstützen. Die Lernprozesse von Tänzer*innen und Rezipient*innen stehen im Mittelpunkt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des normativen historischen Lernens, grundlegende Begriffe wie Geschichte, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur, verschiedene Ansätze des historischen Lernens, die Definition von Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen und die Zuordnung tanztheatraler Verfahren zu Kriterien des normativen historischen Lernens. Es wird eine systematische Analyse der Effektivität von Tanztheater als Medium des historischen Lernens durchgeführt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (mit Ausgangslage, Erkenntnisinteresse, Methodik und Aufbau), Entwicklung der Definition zum normativen historischen Lernen, Grundlegende Begriffe (Geschichte, Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur), Historisches Lernen, Definition von Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen, Zuordnung tanztheatraler Verfahren zu Kriterien des normativen historischen Lernens und schließlich ein Resümee mit Ausblick.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit beschreibt die angewandte Erhebungs- und Auswertungsmethodik in der Einleitung. Die Kernmethode besteht in der systematischen Zuordnung tanztheatraler Verfahren zu den Kriterien des normativen historischen Lernens. Dies geschieht wahrscheinlich durch eine vergleichende Analyse verschiedener Tanztheaterproduktionen und deren methodischer Ansätze.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Tanztheater, historisches Lernen, Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur, normative Lernprozesse, Reenactment, Bildung, Theaterpädagogik, außerschulisches Lernen und reflektiertes Geschichtsverständnis.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Potenzial von Tanztheater für historisches Lernen zu analysieren, tanztheatrale Techniken für historisches Lernen zu systematisieren, die Kriterien des normativen historischen Lernens auf Tanztheaterproduktionen anzuwenden und die Rolle von Tänzer*innen und Rezipient*innen im Lernprozess zu untersuchen. Letztendlich soll ein Beitrag zur Erweiterung des Forschungsfeldes historisches Lernen im Kontext von Tanztheater geleistet werden.
Welche Forschungslücke wird geschlossen?
Die Einleitung der Arbeit hebt eine Forschungslücke hervor, die sich auf die konkrete Wiederfindung der Kriterien des normativen historischen Lernens in Tanztheaterproduktionen mit historischen Bezügen bezieht. Die Arbeit möchte diese Lücke schließen, indem sie die Effektivität von Tanztheater als Medium des historischen Lernens systematisch untersucht.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit historischem Lernen, Theaterpädagogik, Tanztheater und Geschichtsdidaktik beschäftigen. Sie ist auch für Praktiker*innen im Bereich des Tanztheaters und der Geschichtsvermittlung von Interesse.
- Quote paper
- Bachelor of Arts, Diplomierter Fachlehrer Nico Schloß (Author), 2017, Tanztheaterproduktionen und historisches Lernen. Geschichtskulturelle Erkundungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444480