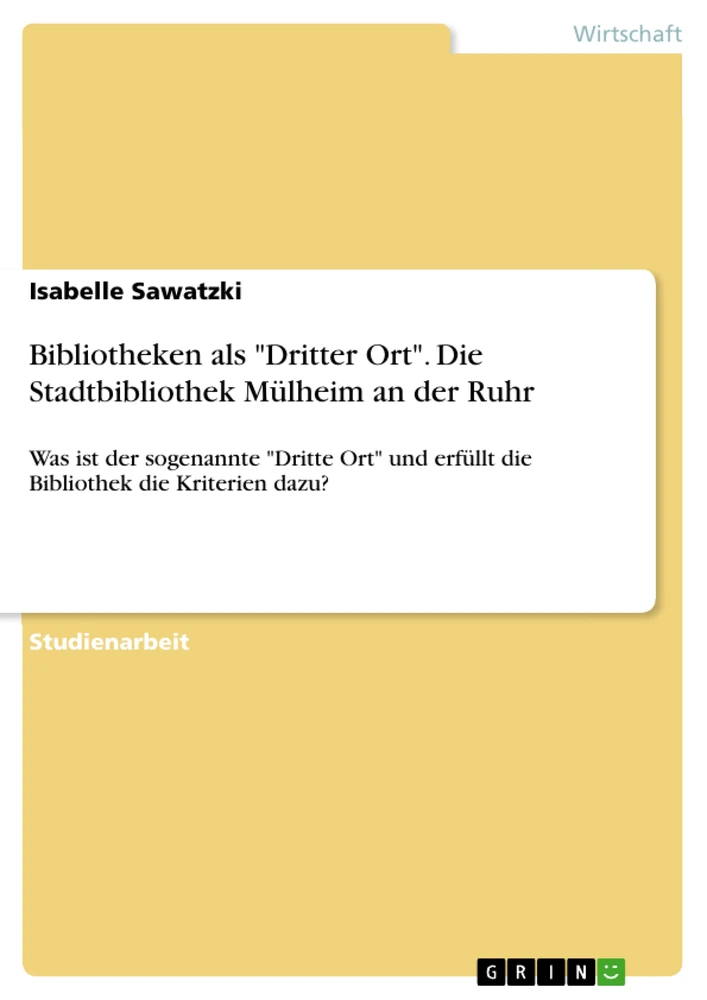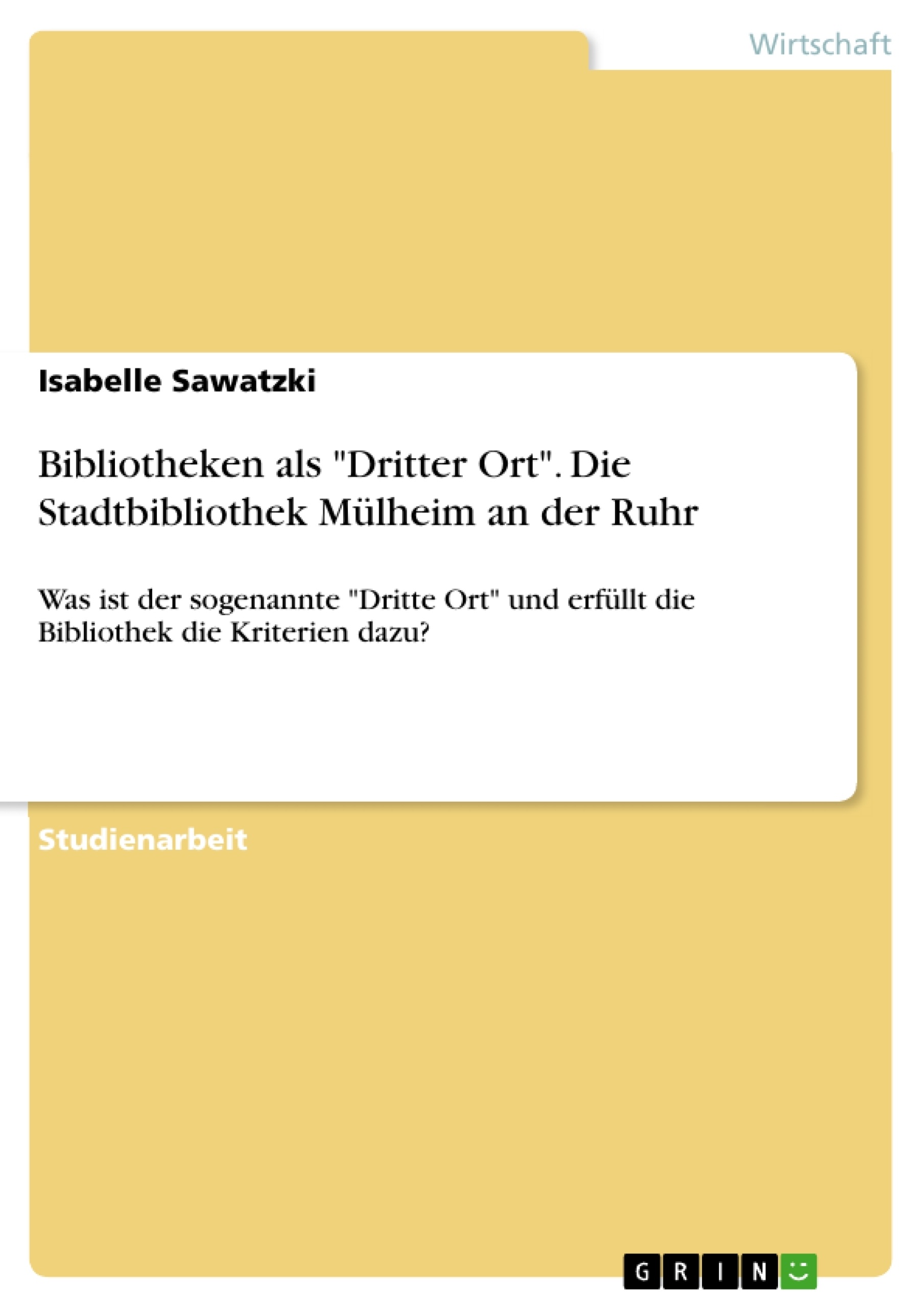Ziel dieser Hausarbeit ist die Klärung der Frage, ob und inwieweit die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr als „Dritter Ort” bezeichnet werden kann oder welche Maßnahmen ergriffen werden müssten, um sie zu einem solchen zu machen. Zu Beginn werde ich mich mit der Definition von „Dritten Orten” im Allgemeinen beschäftigen. Im Folgenden steht die Problematik dieser Definition und ihrer Anwendung im Fokus. Im Anschluss betrachte ich, wie sich Bibliotheken in Australien den Besuchern präsentieren und wie sich ihre Denkweise im Laufe der Zeit verändert hat. Danach beleuchte ich die aktuelle Situation der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr und stelle durch ein Interview mit der Bibliotheksleiterin fest, welche Pläne es für die Weiterentwicklung gibt. Schließlich werde ich alle Aspekte gemeinsam betrachten und ein Resümée ziehen. Für eine bessere Lesbarkeit wird das generische Maskulinum benutzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Dritter Ort“
- Kritik an der Anwendung des Terminus „Dritter Ort“ in Bezug auf Bibliotheken
- Australische Bibliotheken als positives Beispiel für Bibliotheken als dritte Orte
- Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr als „Dritter Ort“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, ob und inwieweit die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr als „Dritter Ort“ im Sinne von Ray Oldenburg betrachtet werden kann. Die Arbeit beleuchtet zunächst die Definition des „Dritten Ortes“ und deren Kritikpunkte im Kontext von Bibliotheken. Anschließend wird ein positives Beispiel aus Australien herangezogen, bevor die Situation der Mülheimer Stadtbibliothek im Fokus steht, analysiert durch ein Interview mit der Bibliotheksleiterin.
- Definition und Kritik des Konzepts „Dritter Ort“
- Positive Beispiele für Bibliotheken als „Dritte Orte“ (Australien)
- Analyse der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr
- Potenzial und Herausforderungen für die Etablierung als „Dritter Ort“
- Zusammenfassende Bewertung der Mülheimer Stadtbibliothek
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Fragestellung der Hausarbeit ein: die Untersuchung des Status der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr als „Dritter Ort“. Sie skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit, der von der Definition des „Dritten Ortes“ über dessen kritische Betrachtung und positive Beispiele bis hin zur Fallstudie der Mülheimer Bibliothek und dem abschließenden Fazit reicht. Die Einleitung betont die Bedeutung der Untersuchung und die Notwendigkeit, den Begriff „Dritter Ort“ im Kontext öffentlicher Bibliotheken zu analysieren.
2. Definition „Dritter Ort“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Dritter Ort“ nach Ray Oldenburg und anderen Wissenschaftlern. Es werden die charakteristischen Merkmale eines „Dritten Ortes“ detailliert beschrieben, u.a. der freie Zugang, die soziale Interaktion und die entspannte Atmosphäre. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung des „Dritten Ortes“ vom „Ersten Ort“ (Zuhause) und „Zweiten Ort“ (Arbeitsplatz/Schule). Die Definition dient als Grundlage für die spätere Analyse der Mülheimer Stadtbibliothek.
3. Kritik an der Anwendung des Terminus „Dritter Ort“ in Bezug auf Bibliotheken: Dieses Kapitel analysiert kritisch die Anwendung des Begriffs „Dritter Ort“ auf Bibliotheken. Es werden potenzielle Schwächen und Einschränkungen des Modells im Kontext von Bibliotheken beleuchtet. Die Kritik dient dazu, die Komplexität des Themas zu verdeutlichen und die Grenzen des Modells aufzuzeigen, bevor in den folgenden Kapiteln positive Beispiele und Fallstudien präsentiert werden. Die Argumentation bereitet den Boden für eine differenzierte Betrachtung des Themas.
4. Australische Bibliotheken als positives Beispiel für Bibliotheken als dritte Orte: Dieses Kapitel präsentiert australische Bibliotheken als erfolgreiche Beispiele für die Etablierung als „Dritte Orte“. Es werden positive Entwicklungen und Strategien vorgestellt, die dazu beitragen, Bibliotheken als Orte der Begegnung und des gesellschaftlichen Lebens zu etablieren. Der Vergleich mit dem deutschen Kontext unterstreicht die Bedeutung von innovativen Ansätzen und strategischem Management.
5. Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr als „Dritter Ort“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Fallstudie der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr. Es analysiert die aktuelle Situation der Bibliothek vor dem Hintergrund der vorherigen Kapitel, unterstützt durch ein Interview mit der Bibliotheksleiterin. Die Analyse beleuchtet die Stärken und Schwächen der Bibliothek in Bezug auf die Kriterien des „Dritten Ortes“ und zeigt Möglichkeiten zur Weiterentwicklung auf.
Schlüsselwörter
Third Place, Dritter Ort, Stadtbibliothek, öffentliche Bibliothek, Bibliotheksentwicklung, soziale Interaktion, gesellschaftliche Teilhabe, Interview, Mülheim an der Ruhr, Australien.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr als „Dritter Ort“
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht, ob und inwieweit die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr als „Dritter Ort“ im Sinne von Ray Oldenburg betrachtet werden kann. Sie analysiert die Bibliothek anhand der Definition des „Dritten Ortes“, berücksichtigt kritische Aspekte und vergleicht sie mit positiven Beispielen aus Australien.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Kritik des Konzepts „Dritter Ort“, positive Beispiele aus Australien, eine detaillierte Analyse der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr (inkl. Interview mit der Bibliotheksleiterin), sowie eine Bewertung des Potenzials und der Herausforderungen für die Etablierung der Bibliothek als „Dritter Ort“.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung und den methodischen Aufbau beschreibt. Es folgen Kapitel zur Definition des „Dritten Ortes“, zur Kritik an dessen Anwendung auf Bibliotheken, zu positiven Beispielen aus Australien und zur Fallstudie der Mülheim an der Ruhr. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Was ist ein „Dritter Ort“ nach Ray Oldenburg?
Das Kapitel „Definition ‚Dritter Ort‘“ beschreibt detailliert die Merkmale eines „Dritten Ortes“ nach Ray Oldenburg und anderen Wissenschaftlern. Es betont den freien Zugang, die soziale Interaktion und die entspannte Atmosphäre, und grenzt den „Dritten Ort“ von Zuhause („Erster Ort“) und Arbeitsplatz/Schule („Zweiter Ort“) ab.
Gibt es Kritik an der Anwendung des Begriffs „Dritter Ort“ auf Bibliotheken?
Ja, die Hausarbeit analysiert kritische Aspekte der Anwendung des Begriffs „Dritter Ort“ auf Bibliotheken. Potenzielle Schwächen und Einschränkungen des Modells im Bibliothekskontext werden beleuchtet, um eine differenzierte Betrachtung zu ermöglichen.
Welche Rolle spielen australische Bibliotheken in der Hausarbeit?
Australische Bibliotheken dienen als positive Beispiele für die erfolgreiche Etablierung als „Dritte Orte“. Die Arbeit präsentiert Entwicklungen und Strategien, die dazu beitragen, Bibliotheken als Orte der Begegnung und des gesellschaftlichen Lebens zu etablieren. Der Vergleich mit dem deutschen Kontext wird gezogen.
Wie wird die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr untersucht?
Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr wird als Fallstudie untersucht. Die Analyse basiert auf den vorherigen Kapiteln und einem Interview mit der Bibliotheksleiterin. Stärken und Schwächen der Bibliothek im Hinblick auf die Kriterien des „Dritten Ortes“ werden beleuchtet, und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Third Place, Dritter Ort, Stadtbibliothek, öffentliche Bibliothek, Bibliotheksentwicklung, soziale Interaktion, gesellschaftliche Teilhabe, Interview, Mülheim an der Ruhr, Australien.
Was ist das Fazit der Hausarbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und bewertet den Status der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr als „Dritter Ort“ auf Basis der durchgeführten Analyse.
- Citar trabajo
- Isabelle Sawatzki (Autor), 2018, Bibliotheken als "Dritter Ort". Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444497