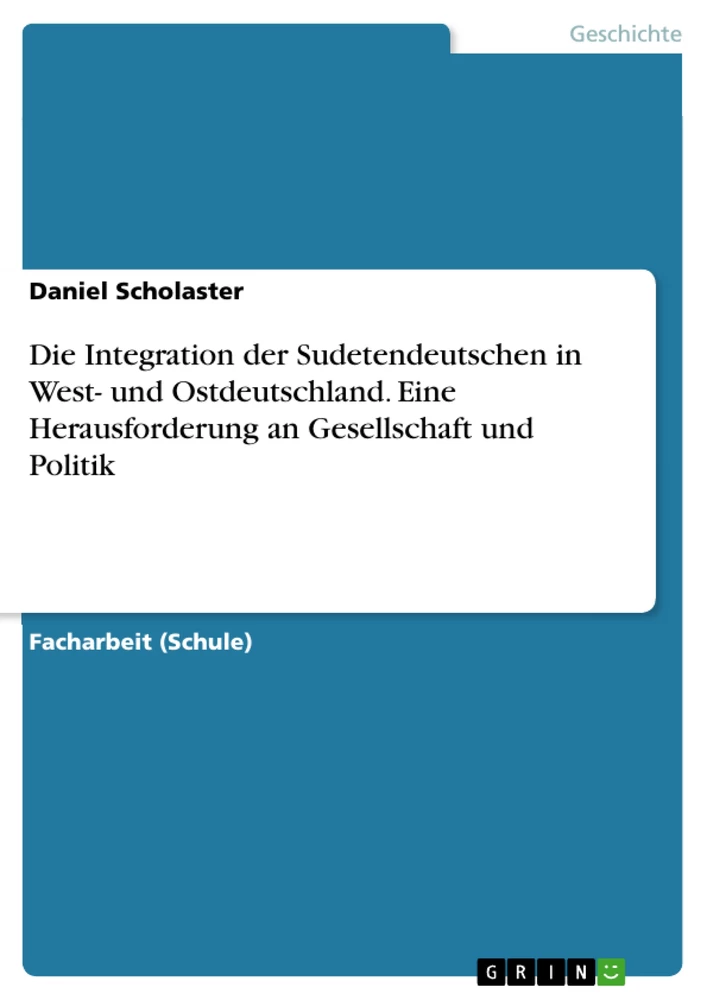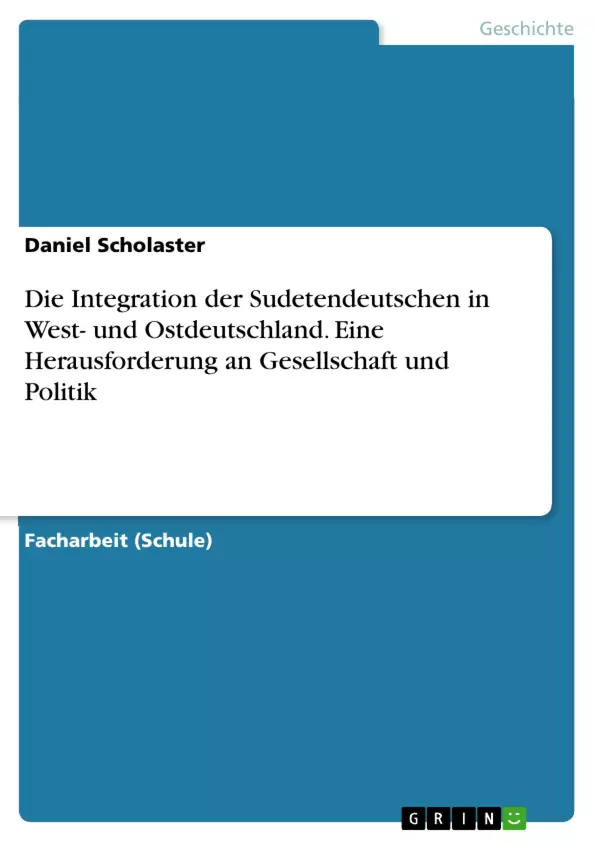Beinahe wäre der für die Verfassungsentwicklung der Europäischen Union so immens wichtige Lissabon-Vertrag nicht zustande gekommen, weil der tschechische Staatspräsident Václav Klaus seine Unterschrift nicht unter das Dokument setzen wollte.
Was mag den Mann bewegt haben, sich derart unnachgiebig zu zeigen?
Er fürchtete, dass bei einer Annahme des Vertrages durch die darin enthaltene Grundrechtecharta Entschädigungsansprüche der vertriebenen Deutschen aus dem Sudetenland an den tschechischen Staat gestellt werden könnten.
Was ist nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen, dass heute noch, nach 65 Jahren, darüber gestritten wird?
Es scheint lohnend, dieser Frage nachzugehen, und darum widme ich mich in dieser Seminararbeit den Sudetendeutschen und ihrer wechselvollen Geschichte mit dem Schwerpunkt auf den Auswirkungen ihrer Integration in die deutsche Nachkriegsgesellschaft nach 1945.
Dabei trieb mich auch das persönliche Interesse an den Menschen und ihren Erlebnissen an, da mein eigener Großvater als Fünfjähriger aus Mähren vertrieben wurde. Außerdem hat meine Kirchengemeinde, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Steinen, einen besonderen Bezug zum Sudetenland, da viele Mitglieder von dort stammen und die Kirche von ihnen gegründet wurde.
Es gilt zu prüfen:
1. Was ist während und direkt nach der Vertreibung aus dem Sudetenland geschehen?
2. Wie haben die Menschen ihren Exodus erlebt?
3. Welche Auswirkungen hatte und hat ihre Vertreibung bis heute auf das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen?
4. Ist die Integration der Sudetendeutschen in die neue Heimat gelungen?
Antworten auf diese Fragen zu finden ist das Ziel dieser Seminararbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Welche persönlichen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Folgen hatte die Vetreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei?
- Der historische Hintergrund
- Wer sind die Sudetendeutschen und wo liegt ihre Heimat?
- Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Anschluss 1938 – Aufstieg der Henlein-Partei
- Während des Zweiten Weltkrieges
- 1945/46: Vertreibung aus dem Sudetenland
- Ethnische Säuberung in den Randgebieten der Tschechoslowakei – „Entgermanisierung“
- Persönliche Erlebnisse von Betroffenen
- Transport, Auffang- und Sammellager und Verteilung
- Der Prozess der Integration 1947-1989
- Die neue Heimat: Kulturelle Aspekte der Integration
- Traditionspflege
- Selbstverständnis der Vertriebenen
- Politik der Alliierten und der beiden Nachkriegsregierungen
- Ein Vergleich
- Wohnungsnot
- Lastenausgleich und Bodenreform
- Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen in Ost und West - Veränderungen der gesellschaftlichen Struktur
- Gettoisierung oder Assimilierung?
- Veränderungen im Zuge der Wiedervereinigung
- Verhältnis der Sudetendeutschen zur deutschen Regierung und besonders zum Freistaat Bayern
- Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen
- Bund der Vertriebenen und Lissabon-Vertrag
- Die Integration der Sudetendeutschen - Ein Fazit
- Ausblick: Das Problem der Sudetendeutschen in der Bundesrepublik und in Europa
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist es, die persönlichen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Folgen der Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Geschichte der Sudetendeutschen, ihre Erfahrungen während und nach der Vertreibung sowie die Integration in die deutsche Nachkriegsgesellschaft.
- Der historische Hintergrund der Sudetendeutschen und die Entwicklung ihrer Beziehungen zum tschechischen Staat
- Die Vertreibung der Sudetendeutschen im Jahr 1945/46 und ihre Folgen
- Der Prozess der Integration der Sudetendeutschen in West- und Ostdeutschland
- Das Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen nach der Vertreibung
- Die Bedeutung der Sudetendeutschen für die deutsche Politik und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Seminararbeit dar, nämlich die Folgen der Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei. Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund der Sudetendeutschen, ihre Herkunft, ihr Verhältnis zum tschechischen Staat sowie den Aufstieg der Henlein-Partei. Das dritte Kapitel thematisiert die Vertreibung der Sudetendeutschen im Jahr 1945/46, die ethnische Säuberung in den Randgebieten der Tschechoslowakei und die persönlichen Erlebnisse der Betroffenen. Das vierte Kapitel analysiert den Prozess der Integration der Sudetendeutschen in West- und Ostdeutschland, die Auswirkungen auf ihre Kultur, das Zusammenleben mit der einheimischen Bevölkerung und die Politik der Alliierten.
Schlüsselwörter
Sudetendeutsche, Vertreibung, Tschechoslowakei, Integration, Nachkriegsgesellschaft, deutsche Politik, Kultur, Tradition, Geschichte, deutsch-tschechisches Verhältnis, Henlein-Partei, Lissabon-Vertrag.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Sudetendeutschen?
Sudetendeutsche sind die deutschsprachige Bevölkerung, die bis zur Vertreibung 1945/46 in den Randgebieten der ehemaligen Tschechoslowakei (Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien) lebte.
Wie verlief die Vertreibung 1945/46?
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zur "Entgermanisierung" der Tschechoslowakei, wobei Millionen Deutsche unter oft gewaltsamen Bedingungen ihre Heimat verlassen mussten.
Gibt es Unterschiede bei der Integration in West- und Ostdeutschland?
Ja, die Arbeit vergleicht die politische und soziale Aufnahme der Vertriebenen in der BRD und der DDR, wobei kulturelle Traditionspflege im Westen offener möglich war.
Was war der Lastenausgleich?
Ein gesetzliches System in der Bundesrepublik, um die wirtschaftlichen Verluste der Vertriebenen durch finanzielle Entschädigungen teilweise auszugleichen.
Warum spielte der Lissabon-Vertrag eine Rolle für die Vertriebenen?
Es gab Befürchtungen, dass die EU-Grundrechtecharta den Weg für Rückgabeforderungen oder Entschädigungsansprüche der Sudetendeutschen gegenüber Tschechien ebnen könnte.
- Quote paper
- Daniel Scholaster (Author), 2010, Die Integration der Sudetendeutschen in West- und Ostdeutschland. Eine Herausforderung an Gesellschaft und Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444809