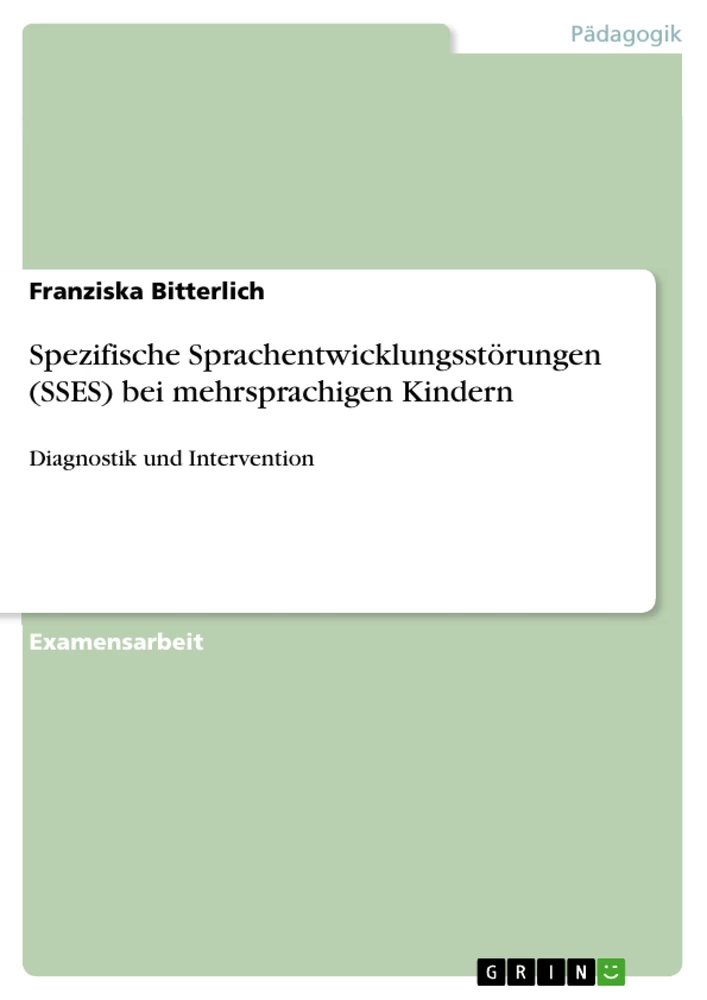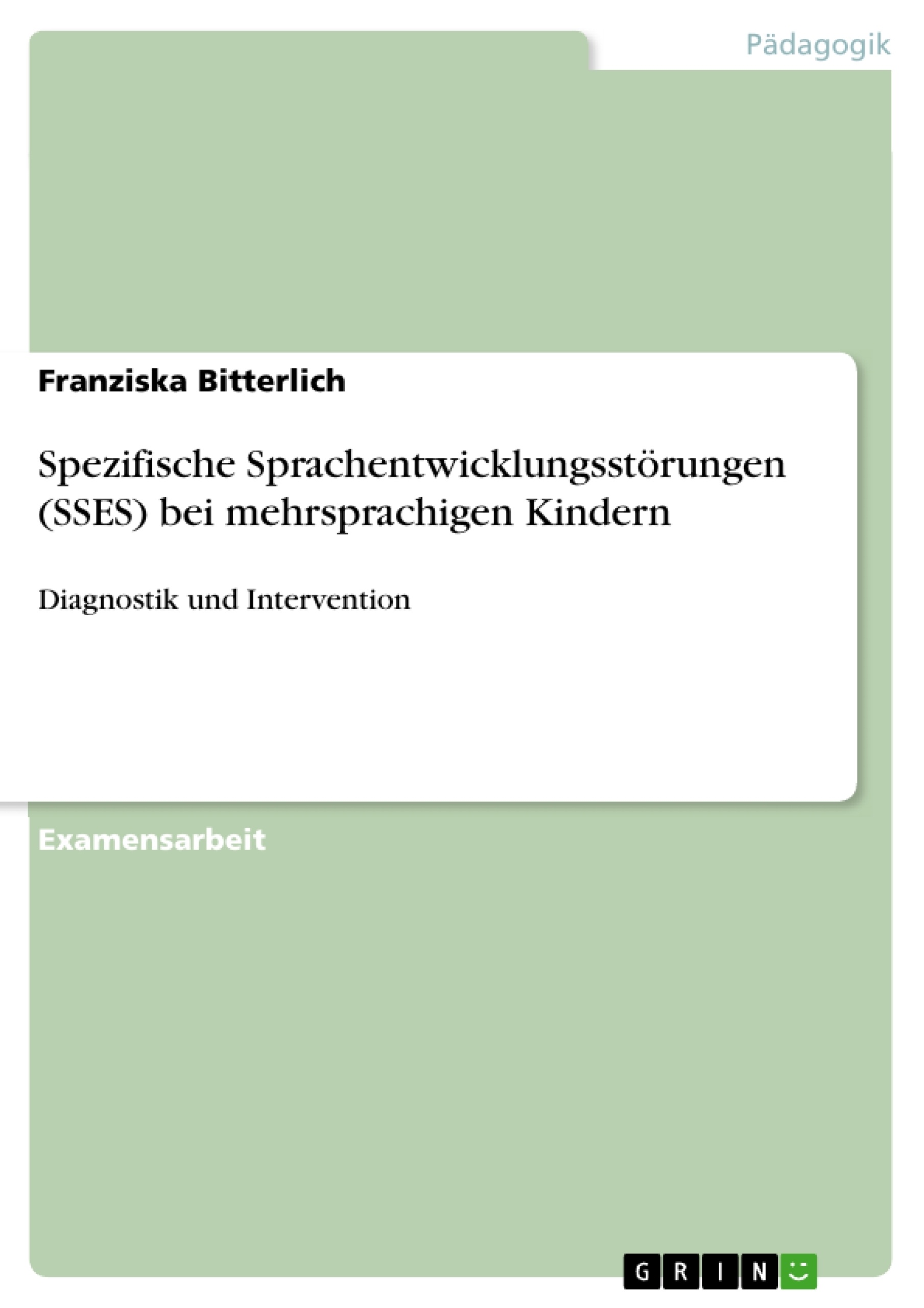Die Arbeit beschäftigt sich mit den aktuellen Verfahrensweisen zur Diagnostik und Intervention bei mehrsprachigen Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES). Dabei wird reflektiert, welche Ansätze sich in der schulischen und außerschulischen Praxis eignen, zusätzlich werden Schlussfolgerungen für den sprachheilpädagogischen Unterricht gezogen.
Die Unterkapitel beschäftigen sich mit den Themen Mehrsprachigkeit in Deutschland, Zweitspracherwerb und spezifische Sprachentwicklungsstörungen.
- Diagnostik
- Empfehlungen zur Best Practice der Diagnostik im mehrsprachigen Kontext
- Anamnese
- Testverfahren zur Überprüfung der Erstsprache
- Testverfahren zur Überprüfung der Zweitsprache
- Informelle Verfahren zur Überprüfung der Erst-und Zweitsprache
- Verfahren zur Sprachverarbeitung
- Intervention
- Müssen beide Sprachen in der Intervention berücksichtigt werden?
- Elternberatung und -training
- Bilingual orientierte Interventionsansätze
- Die Kontrastoptimierung
- Monolingual orientierte Interventionsansätze
- Die Kontextoptimierung
- Der Wortschatzsammler
- Schlussfolgerungen für den sprachheilpädagogischen Unterricht
- Fazit und Ausblick
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mehrsprachigkeit in Deutschland
- Mehrsprachigkeit - Begriffsbestimmung
- Zum aktuellen Migrationsgeschehen in Deutschland.
- Bedeutung sprachlicher Intervention bei mehrsprachigen Kindern
- Zweitspracherwerb
- Grundlagen
- Prozesse im Zweitspracherwerb
- Formen von Mehrsprachigkeit
- Simultaner Erwerb
- Sukzessiver Erwerb
- Spezifische Sprachentwicklungsstörungen
- Definition und Abgrenzung zu anderen Störungsbildern
- Symptome
- Prävalenz und Ursachen
- Störungsbild bei mehrsprachigen Kindern
- Allgemeine Merkmale
- Symptome und deren klinische Relevanz
- Diagnostik
- Problemstellung
- Empfehlungen zur Best Practice der Diagnostik im mehrsprachigen Kontext
- Überblick über diagnostische Ziele und das allgemeine Vorgehen
- Anamnese
- Testverfahren zur Überprüfung der Erstsprache
- Testverfahren zur Überprüfung der Zweitsprache
- Informelle Verfahren zur Überprüfung der Erst-und Zweitsprache
- Beobachtung der Sprachfähigkeiten
- Kriterium-orientierte Verfahren
- Verfahren zur Sprachverarbeitung
- Überprüfung des auditiven Arbeitsgedächtnisses
- Dynamische Methoden
- Zwischenfazit
- Intervention
- Einführung
- Müssen beide Sprachen in der Intervention berücksichtigt werden?
- Unterscheidet sich die Intervention bei mehrsprachigen Kindern im Gegensatz zu monolingualen Kindern?
- Elternberatung und -training
- Bilingual orientierte Interventionsansätze
- Induktiver Ansatz
- Bilingualer Ansatz
- Cross-linguistischer Ansatz
- Die Kontrastoptimierung
- Monolingual orientierte Interventionsansätze
- Die Kontextoptimierung
- Der Wortschatzsammler
- Schlussfolgerungen für den sprachheilpädagogischen Unterricht
- Weitere Grundprinzipien unterrichtsintegrierter Intervention
- Fazit und Ausblick
- Die Herausforderungen der SSES-Diagnostik im mehrsprachigen Kontext
- Die Unterscheidung von SSES und typischen Zweitspracherwerbserscheinungen
- Die Bedeutung der Elternberatung und -beteiligung bei der Intervention
- Die verschiedenen Interventionsansätze für mehrsprachige Kinder mit SSES
- Die Bedeutung der Berücksichtigung beider Sprachen im schulischen Setting
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Diagnostik und Intervention spezifischer Sprachentwicklungsstörungen (SSES) bei mehrsprachigen Kindern. Sie verfolgt das Ziel, einen Überblick über die aktuelle Forschung in diesem Bereich zu geben und praktisch relevante Aspekte für die Arbeit von SprachheilpädagogInnen in der Schule zu beleuchten. Dabei stehen die folgenden Themenschwerpunkte im Vordergrund:
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext von Mehrsprachigkeit in Deutschland und die besondere Bedeutung sprachlicher Intervention für mehrsprachige Kinder mit SSES beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich der Mehrsprachigkeit und definiert den Begriff, beschreibt das aktuelle Migrationsgeschehen in Deutschland und die Relevanz sprachlicher Interventionen für die Teilhabe mehrsprachiger Kinder im Bildungssystem.
Kapitel drei geht auf den Zweitspracherwerb ein und beleuchtet die Grundlagen, Prozesse und verschiedenen Formen der Mehrsprachigkeit, insbesondere den simultanen und sukzessiven Erwerb.
Das vierte Kapitel behandelt die Thematik der spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (SSES) und gibt einen Überblick über Definition, Symptome, Prävalenz und Ursachen sowie die besonderen Herausforderungen im Kontext der Mehrsprachigkeit.
Kapitel fünf beschäftigt sich mit der Diagnostik von SSES bei mehrsprachigen Kindern. Es werden die Problematik der Diagnostik, Best-Practice-Empfehlungen und verschiedene Verfahren vorgestellt, einschließlich der Anamnese, Testverfahren für die Erst- und Zweitsprache sowie informeller und kriterium-orientierter Verfahren.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der Intervention bei mehrsprachigen Kindern mit SSES. Es werden verschiedene Interventionen sowohl bilingualer als auch monolingualer Art sowie die Bedeutung der Elternberatung und des Eltern-trainings beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES), Mehrsprachigkeit, Zweitspracherwerb, Diagnostik, Intervention, Sprachheilpädagogik, Kinder mit Migrationshintergrund, Elternberatung und -training. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Unterscheidung von SSES und typischen Zweitspracherwerbserscheinungen sowie auf der Berücksichtigung beider Sprachen im schulischen Setting.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES)?
Eine SSES ist eine Störung des Spracherwerbs, die nicht durch Hörprobleme, Intelligenzminderung oder neurologische Schäden erklärt werden kann.
Wie unterscheidet man SSES von normalen Problemen beim Zweitspracherwerb?
Bei einer SSES zeigen sich Defizite in beiden (oder allen) Sprachen des Kindes, während typische Erwerbsfehler nur die Zweitsprache betreffen.
Welche Diagnostikverfahren eignen sich für mehrsprachige Kinder?
Empfohlen wird eine Kombination aus ausführlicher Anamnese, Tests in Erst- und Zweitsprache sowie informellen Verfahren wie Sprachbeobachtungen.
Müssen bei der Therapie beide Sprachen berücksichtigt werden?
Ja, bilinguale Interventionsansätze, die die Erstsprache wertschätzen und einbeziehen, gelten oft als effektiver für die gesamte Sprachentwicklung des Kindes.
Was ist „Kontextoptimierung“?
Ein Interventionsansatz, der darauf abzielt, grammatische Strukturen durch die Gestaltung spezifischer Situationen im Unterricht oder in der Therapie für das Kind leichter erfassbar zu machen.
Welche Rolle spielen die Eltern bei der Sprachförderung?
Elternberatung und -training sind entscheidend, um die häusliche Sprachumgebung zu stärken und die Eltern in ihrer Rolle als wichtigste Sprachvorbilder zu unterstützen.
- Arbeit zitieren
- Franziska Bitterlich (Autor:in), 2018, Spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES) bei mehrsprachigen Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444903