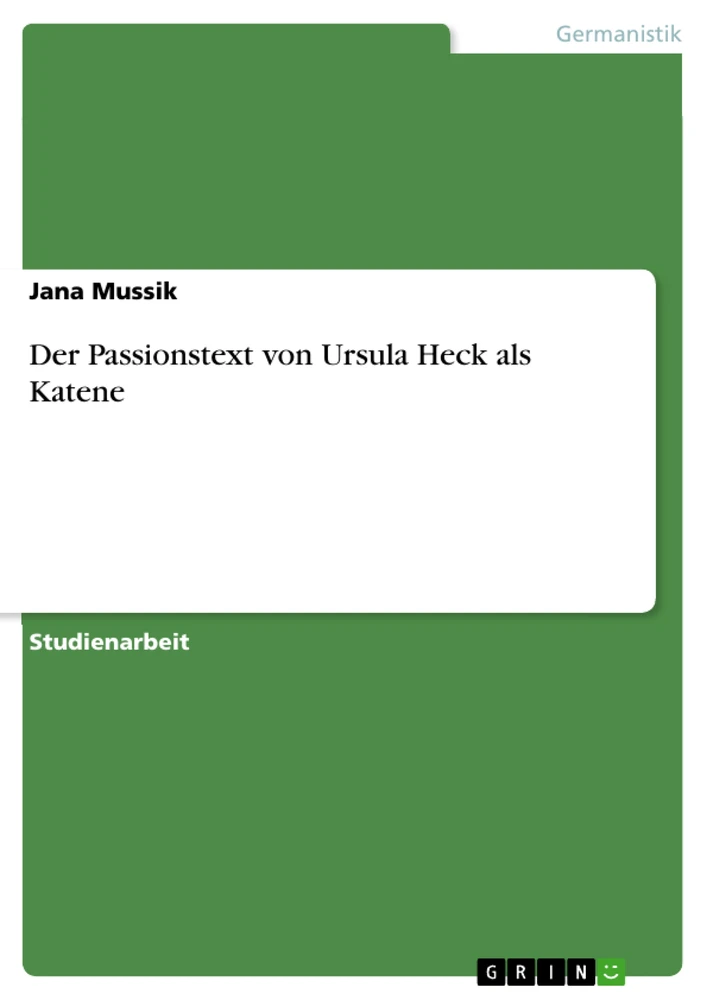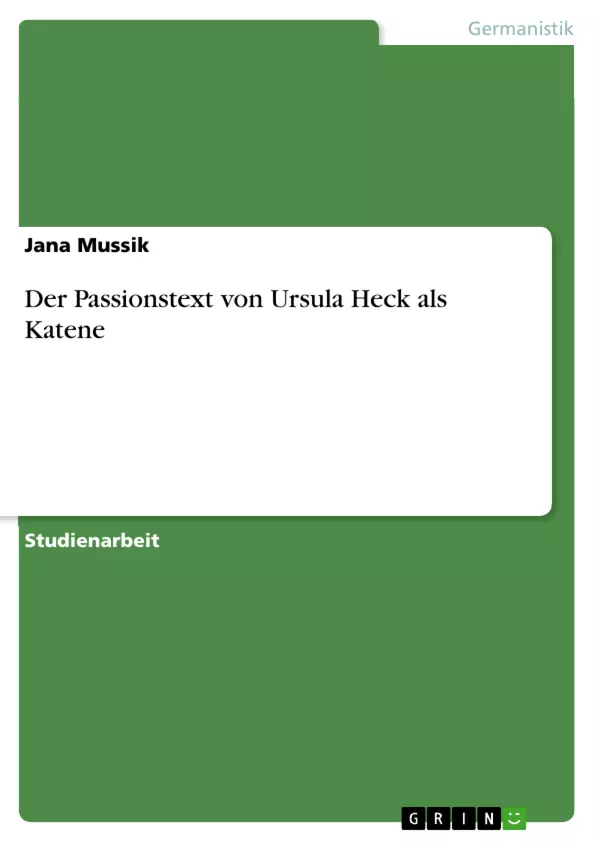Auch zum Ende des 15. Jahrhunderts setzten sich die Menschen mit zahlreichen theologischen Fragestellungen auseinander und versuchten diese in ihrem alltäglichen Leben einzusetzen. Eine besondere Form, der Auslegung der Bibel war die der Catena, zu Deutsch Katene . Die darin zusammengestellten Bibelkommentare dienten u.a. dazu, die heilige Schrift besser verstehen zu können und einen Überblick über die Thesen verschiedenster Schriftgelehrter zu gewinnen. Die zehn Gebote, das Jüngste Gericht und die Vorbereitung auf den Tod spielten in dieser Zeit eine sehr wichtige Rolle. Das Leben Jesu galt dabei als Vorbild. Vor allem seine menschlichen Charakterzüge, seine Wanderpredigten, sein Leiden und die Aufnahme der Schuld eigneten sich hervorragend zur Nachahmung. Im Zuge dessen entstanden zahlreiche Schriften, die sich im mittels dieser Weltanschauung genau mit diesen Themen auseinandersetzten. Einer dieser Texte stammt von Ursula Heck. Nur durch die Selbstnennung im Kolophon des eigenen Werkes ist uns ihre Existenz überhaupt bekannt. Der Text wurde wahrscheinlich Ende des 15., Anfang des 16. Jh. fertiggestellt. Obwohl dies schon sehr spät ist, entspricht er immer noch den Anschauungen des Mittelalters. Bis auf diesen einen Hinweis ist der Nachwelt bisher nichts weiter von der Autorin erhalten. Einzig ihre Passionsschrift könnte Aufschluss über sie, ihr Werk und ihre Absichten geben.
Im Rahmen der Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit der Text von Ursula Heck aus dem 15. Jahrhundert als eine Katene betrachtet werden kann. Hierzu soll zunächst erklärt werden, was eine Katene überhaupt ist. Wie wird sie definiert? Was macht sie aus und lassen sich bestimmte Kriterien festmachen?
Im Anschluss soll der Text dahingehend überprüft werden, wie viel Eigenanteil der Autorin vorhanden ist. Welche Quellen lagen dem Werk neben den Evangelien noch zu Grunde? Was wurde aus anderen Texten übernommen und wie verteilt sich das im Text? Dazu kommt die Berufung auf die verschiedenen Autoritäten. Diese Eigenart einer Katene war auch in anderen Textsorten gängige Praxis des Mittelalters. Doch wie ging Ursula Heck dabei vor? Wen zitiert sie und wie verknüpft sie das mit dem Rest ihres Textes?
Anhand dieser Fragestellungen und Überlegungen soll abschließend ein Urteil getroffen werden, ob auch der Passionstext von Ursula Heck im Ganzen oder auch nur in Teilen als eine Katene gelesen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Katene
- Quellen und Eigenanteil von Ursula Heck
- Anteil der Bibel
- Texte anderer Autoren
- Eigenanteil im Text
- Berufung auf Autoritäten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Passionstext von Ursula Heck aus dem 15. Jahrhundert und befasst sich mit der Frage, inwiefern dieser als eine Katene betrachtet werden kann. Die Arbeit untersucht die Definition des Genres "Katene" und analysiert, inwieweit der Text von Ursula Heck diese Kriterien erfüllt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Quelle des Textes, den Eigenanteil der Autorin und die Berufung auf Autoritäten.
- Definition des Genres "Katene" im Mittelalter
- Die Quellen von Ursula Hecks Passionstext: Bibel, mittelalterliche Passionstraktate und Eigenanteil der Autorin
- Die Art und Weise, wie Ursula Heck Autoritäten zitiert und ihre Bedeutung im Kontext des Werkes
- Die Frage, ob der Text als Katene klassifiziert werden kann, und eine Abwägung der Argumente dafür und dagegen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext des Passionstextes von Ursula Heck dar und führt die Fragestellung der Arbeit ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der Katene im späten Mittelalter und hebt die Besonderheiten des Textes von Ursula Heck hervor.
- Kapitel 2: Definition Katene
Dieses Kapitel definiert das Genre "Katene" anhand verschiedener Lexika und Fachliteratur. Es werden die wichtigsten Kriterien und Merkmale dieses Texttyps beleuchtet, um den analytischen Rahmen für die folgende Untersuchung zu schaffen.
- Kapitel 3: Quellen und Eigenanteil von Ursula Heck
Dieser Abschnitt untersucht die Quellen von Ursula Hecks Passionstext. Es werden der Anteil der Bibel, die Verwendung anderer mittelalterlicher Passionstraktate und der Eigenanteil der Autorin analysiert. Das Kapitel beleuchtet auch die Frage, wie stark Ursula Heck ihre Quellen aus verschiedenen Werken übernommen hat und wie diese in den Gesamttext eingebunden wurden.
- Kapitel 4: Berufung auf Autoritäten
Dieses Kapitel analysiert die Art und Weise, wie Ursula Heck in ihrem Text auf Autoritäten zurückgreift. Es werden die verschiedenen Kirchenväter und Gelehrten, auf die sie sich bezieht, untersucht und die Häufigkeit und Verteilung der Zitate analysiert. Das Kapitel diskutiert außerdem die Bedeutung der Berufung auf Autoritäten im Kontext des Werkes und beleuchtet die Frage, ob Ursula Heck auf Vollständigkeit oder auf die Legitimierung ihres Textes abzielte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Katene, Passionstext, Ursula Heck, Mittelalter, Bibel, Autoritäten, Legitimierung, Bibelinterpretation, Passion Christi, Mariendichtung, Heinrich v. St. Gallen, Thomas v. Aquin, Catena aurea.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Katene (Catena)?
Eine Katene ist eine mittelalterliche Textform, die Bibelkommentare verschiedener Schriftgelehrter aneinanderreiht, um die Heilige Schrift besser verständlich zu machen.
Wer war Ursula Heck?
Ursula Heck war eine Autorin des späten 15. Jahrhunderts, von der nur ihre Passionsschrift durch eine Selbstnennung im Kolophon bekannt ist.
Ist Hecks Passionstext eine Katene?
Die Arbeit untersucht dies kritisch anhand der Quellenverarbeitung und der Berufung auf Autoritäten wie Thomas von Aquin oder Kirchenväter.
Welche Quellen nutzte Ursula Heck?
Neben den Evangelien der Bibel nutzte sie wahrscheinlich mittelalterliche Passionstraktate und Schriften von Gelehrten wie Heinrich von St. Gallen.
Warum war die Passion Christi im Mittelalter so wichtig?
Das Leiden Jesu galt als Vorbild für die Gläubigen. Seine menschlichen Züge und die Aufnahme der Schuld dienten als Ideal zur Nachahmung im Alltag.
- Citar trabajo
- Jana Mussik (Autor), 2011, Der Passionstext von Ursula Heck als Katene, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444967