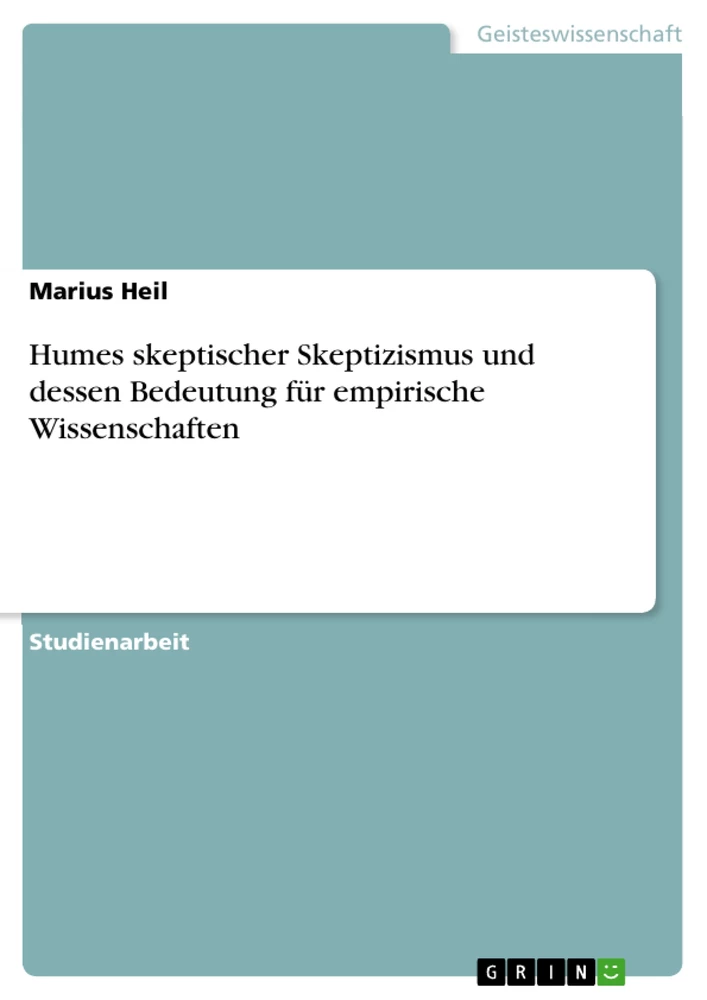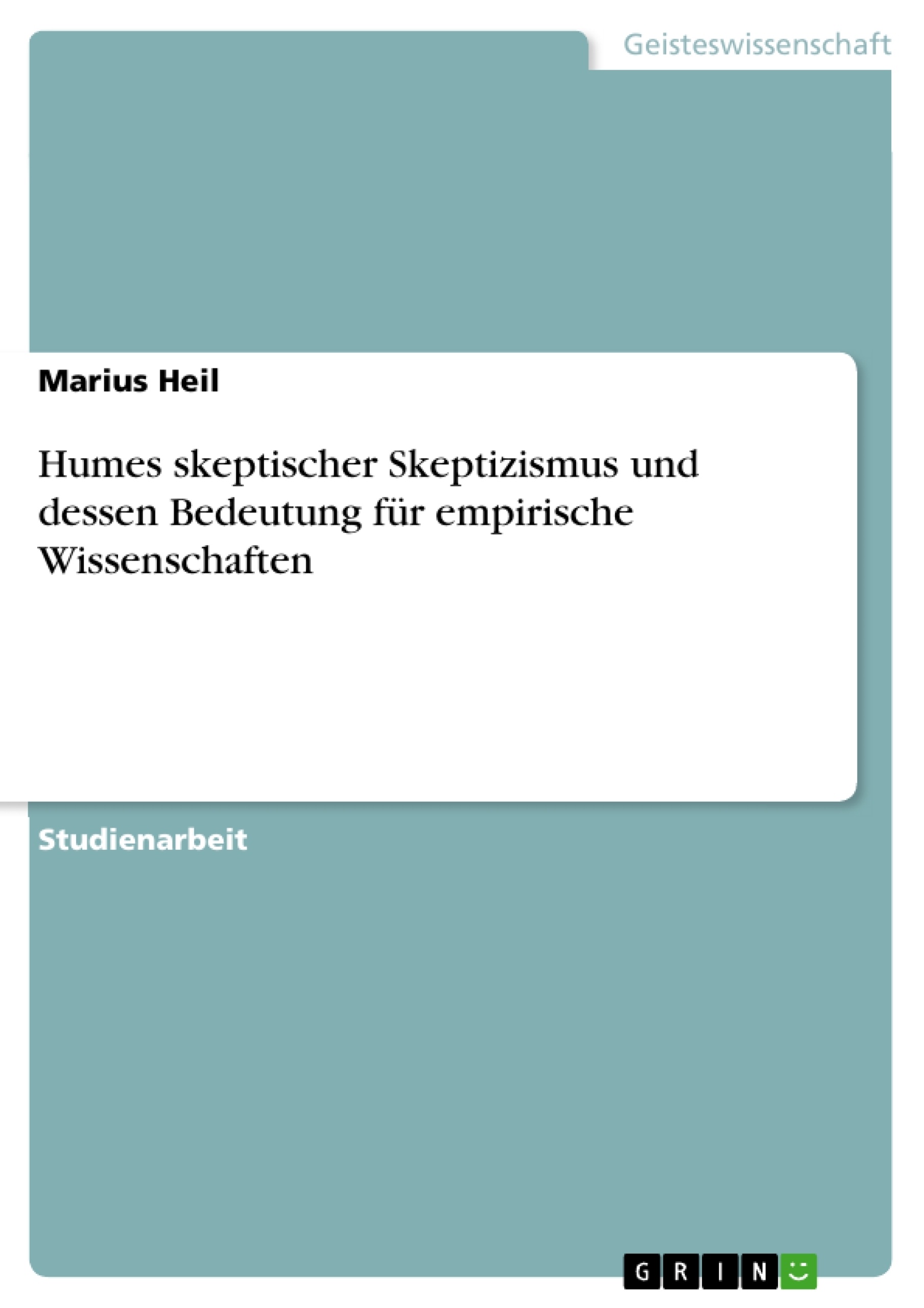Dieser Text befasst sich mit dem Skeptizismus in Humes Erkenntnistheorien und den Konsequenzen und Chancen, welche sich darauf für die Wissenschaft und das alltägliche Leben ergeben.
Diese Arbeit verfolgt das Ziel aufzudecken, wieso Humes Skeptizismus so radikal ist und wo in seiner Erkenntnistheorie der Grund dafür liegt. Da Hume aber nicht nur Philosoph, sondern auch ein Mensch war soll auch seine naturalistische Sichtweise auf das Thema betrachtet werden. Die Wissenschaft ist für David Humes Schriften ein zentrales Thema, daher soll geklärt werden welche Auswirkung seine Denkweise auf das wissenschaftliche Arbeiten hat. Diese Hausarbeit wird also zunächst Humes Erkenntnistheorie knapp skizzieren um dann, mit Hilfe einführender Sekundärliteratur, auf die für den Skeptizismus zentrale Relation näher eingehen zu können. Danach befasst sie sich mit der Sichtweise Humes auf seine äußere Umwelt und die Frage, wo Wahrscheinlichkeit aufhört und Wissen anfängt. Im Anschluss betrachte ich anhand von Sekundärliteratur, aber auch durch das Betrachten von Zitaten aus dem Traktat, Humes eigene Stellung zu seinem Skeptizismus. Der Schluss des Hauptteils widmet sich dann noch dem Nutzen, welchen empirische Wissenschaften aus der Diskussion über Skeptizismus ziehen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Woher rührt Humes Skeptizismus?
- Wie sicher sind kausale Schlüsse?
- Wo hört Wahrscheinlichkeit auf, wo fängt Wissen an?
- Humes skeptische Ansicht auf seinen Skeptizismus
- Skeptizismus in der Wissenschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem radikalen Skeptizismus von David Hume und untersucht, wie dieser entsteht und welche Auswirkungen er auf seine Erkenntnistheorie und die Wissenschaft hat.
- Humes empiristische Philosophie und seine Abgrenzung zu John Locke und George Berkeley
- Die Rolle von Perzeptionen, Eindrücken und Ideen in Humes Erkenntnistheorie
- Die Unmöglichkeit eines sicheren Urteils über die Außenwelt und die Fehlbarkeit der Sinne
- Kausalität als Relation und die Problematik induktiver Schlüsse
- Humes eigene Sichtweise auf seinen Skeptizismus und seine Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt David Hume als einen der bedeutendsten Skeptiker der Neuzeit vor und skizziert die zentralen Punkte seiner Erkenntnistheorie. Sie erläutert das Ziel der Arbeit, nämlich Humes radikalen Skeptizismus zu beleuchten und seine Auswirkungen auf die Wissenschaft zu untersuchen.
Woher rührt Humes Skeptizismus?
Dieses Kapitel untersucht den Ursprung von Humes Skeptizismus im Kontext der empiristischen Tradition und seiner Abgrenzung zu John Locke und George Berkeley. Es wird erklärt, dass Hume die Erfahrung als Grundlage für alle Erkenntnis sieht und Perzeptionen in Eindrücke und Ideen unterteilt.
Wie sicher sind kausale Schlüsse?
Dieses Kapitel analysiert die Problematik kausaler Schlüsse in Humes Erkenntnistheorie. Hume argumentiert, dass die Annahme von kausalen Zusammenhängen auf der wiederholten Beobachtung von Ereignissen beruht und nicht auf einer objektiven Gewissheit. Er stellt das Induktionsproblem dar und zeigt, dass induktive Schlüsse keine sichere Grundlage für Wissen bieten.
Wo hört Wahrscheinlichkeit auf, wo fängt Wissen an?
Dieses Kapitel setzt sich mit Humes Ansicht über die Grenzen von Wahrscheinlichkeit und Wissen auseinander. Es zeigt, dass Hume jegliche Form von absoluter Gewissheit ablehnt und stattdessen die Wahrscheinlichkeit als Grundlage für menschliche Urteile sieht.
Schlüsselwörter
David Hume, Skeptizismus, Empirismus, Perzeption, Eindruck, Idee, Kausalität, Induktion, Wahrscheinlichkeit, Wissen, Wissenschaft
Häufig gestellte Fragen
Warum ist David Humes Skeptizismus so radikal?
Hume argumentiert, dass unsere Erkenntnis allein auf Erfahrung beruht und wir keine rationale Gewissheit über kausale Zusammenhänge oder die Außenwelt haben können.
Was ist das Induktionsproblem bei Hume?
Hume zeigt, dass wir von vergangenen Beobachtungen nicht logisch zwingend auf die Zukunft schließen können. Dass die Sonne morgen aufgeht, ist eine Gewohnheit, kein beweisbares Wissen.
Wie unterscheidet Hume zwischen Eindrücken und Ideen?
Eindrücke (Impressions) sind unmittelbare, lebhafte Sinneswahrnehmungen. Ideen sind schwächere Abbilder dieser Eindrücke im Denken und Erinnern.
Welchen Nutzen hat der Skeptizismus für die Wissenschaft?
Er mahnt zur Vorsicht bei absoluten Wahrheitsansprüchen und fördert ein empirisches Arbeiten, das auf Wahrscheinlichkeiten statt auf Dogmen basiert.
Wo hört bei Hume Wahrscheinlichkeit auf und fängt Wissen an?
Echtes Wissen gibt es laut Hume nur in der Mathematik und Logik (Relations of Ideas). In der empirischen Welt bewegen wir uns fast ausschließlich im Bereich der Wahrscheinlichkeit.
- Quote paper
- Marius Heil (Author), 2016, Humes skeptischer Skeptizismus und dessen Bedeutung für empirische Wissenschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445098