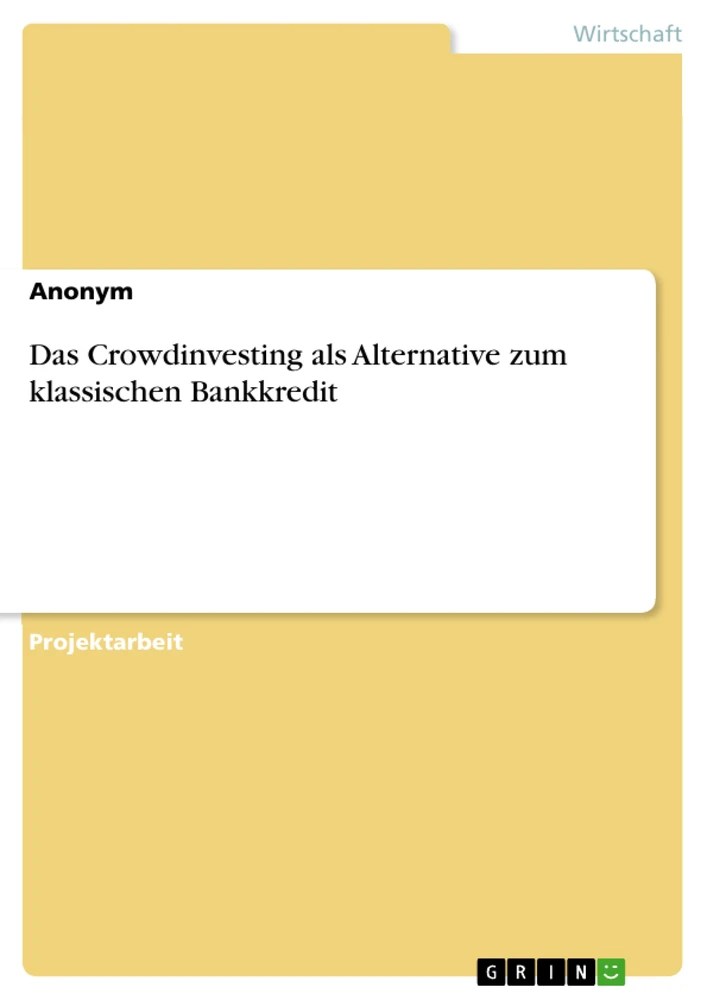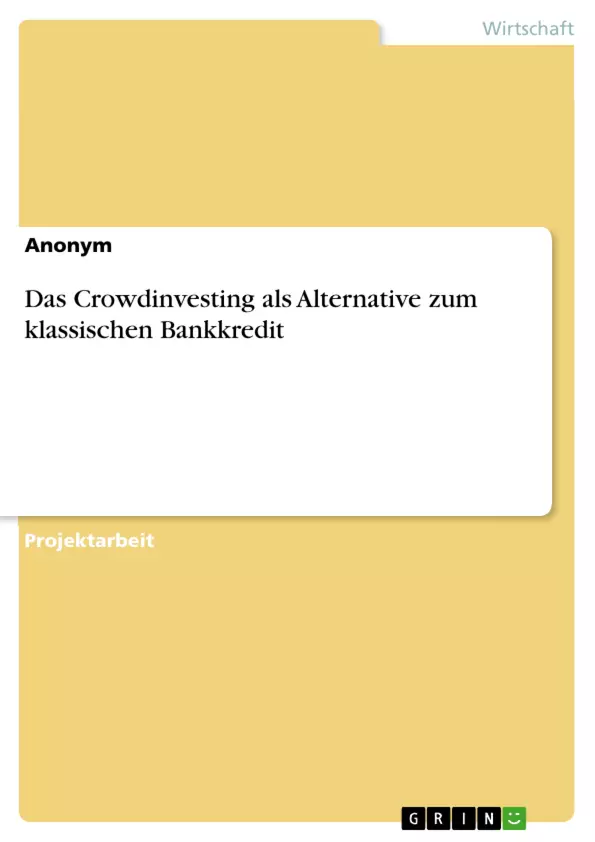Crowdfunding ist ein neu aufkeimender Trend, der sich seit 2011 steigender Beliebtheit erfreut. Egal ob kleine, mittlere oder große Unternehmen, bereits etablierte oder Wachstumsunternehmen, ob soziale, karitative, ökologische oder ökonomische Absichten, sie haben alle einen gemeinsamen Nenner: Sie nutzen Crowdfunding. Das kollektive Zusammenwirken von einzelnen Personen, von Gruppen oder Unternehmen, schafft die Möglichkeit, finanzielle Mittel aufzubringen.
Unternehmensgründungen sind essentiell wichtig. Sie treiben die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland voran und durch wichtige Innovationen, insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung, wird neben der Schaffung von Arbeitsplätzen auch ein Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt geleistet. Betrachtet man die Ergebnisse des KfW Research (Stand: 2017) zum Gründungsgeschehen in Deutschland, ist ein Rückgang der Gründerquoten zu verzeichnen. Die Ursache liegt in der sinkenden Zahl der Notgründer. Bei den Chancengründungen ist dagegen ein deutliches Plus zu erkennen. Die Dominanz der Chancengründer in der Gründungstätigkeit kommt besonders der Volkswirtschaft zu Gute. Im Gegensatz zu Notgründern, bringen diese durchschnittlich häufiger Marktneuheiten, beschäftigen mehr Mitarbeiter und können länger am Markt bestehen.
Diese beiden Schlagwörter Crowdfunding und die steigende Zahl von Chancengründern führen zwangsläufig zueinander. Bis dato suchen sich die Gründer, sofern die Eigenmittel nicht ausreichen, ihre Finanzmittel bei Freunden und Familie, staatlichen Institutionen (in Form von Fördermitteln), Banken, Business Angels oder bei Venture Capital-Gebern.
Der Umbruch in der Finanzbranche, der Wandel traditioneller Geschäftsmodelle der Banken, die Digitalisierung und die zunehmende Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien schaffen die Voraussetzungen für eine Abwendung von den herkömmlichen Finanzierungsformen, insbesondere von Krediten/Darlehen, hin zu Alternativen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Aufbau und Struktur
- 2 Literarische Einführung
- 2.1 Ursprung
- 2.2 Einordnung und Definition
- 2.2.1 Definition Start-up
- 2.2.2 Crowdfunding als Form des Crowdsourcing
- 2.2.2.1 Ausprägungsformen
- 2.2.2.2 Crowdinvesting als Form des Crowdfundings
- 2.2.2.2.1 Definition
- 2.2.2.2.2 Funktionsweise
- 2.2.2.2.3 Status quo in Deutschland
- 2.3 Abgrenzung Venture Capital-Geber und Business Angels
- 3 Analyse des Crowdinvesting aus Start-up Sicht
- 3.1 Definition der Bestimmungsgrößen
- 3.2 Vergleichsmaßstab Bankkredit
- 3.3 Vergleich zum Crowdinvesting
- 4 Gestaltungsmodell
- 5 Zusammenfassung und kritisches Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Crowdinvesting als Alternative zum klassischen Bankkredit für Start-ups. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile von Crowdinvesting im Vergleich zu Bankkrediten zu analysieren und ein umfassendes Verständnis dieser Finanzierungsmethode zu entwickeln.
- Definition und Einordnung von Crowdinvesting
- Vergleich von Crowdinvesting und Bankkrediten
- Analyse der Vorteile und Nachteile von Crowdinvesting für Start-ups
- Bewertung des Status quo von Crowdinvesting in Deutschland
- Entwicklung eines Gestaltungsmodells
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Crowdinvestings ein, beschreibt die Problemstellung, die untersucht wird, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es bietet einen ersten Überblick über die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage.
2 Literarische Einführung: Dieses Kapitel beleuchtet den Ursprung und die Entwicklung von Crowdinvesting. Es definiert Crowdinvesting im Kontext von Crowdfunding und Crowdsourcing, grenzt es von anderen Finanzierungsformen wie Venture Capital und Business Angels ab und analysiert den aktuellen Stand in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Einordnung des Konzepts innerhalb des Finanzierungslandschafts für Start-ups.
3 Analyse des Crowdinvesting aus Start-up Sicht: Dieser Abschnitt vergleicht Crowdinvesting mit dem traditionellen Bankkredit aus der Perspektive eines Start-ups. Er definiert relevante Größen und analysiert die jeweiligen Vor- und Nachteile beider Finanzierungswege. Der Vergleich betont die unterschiedlichen Anforderungen und Risiken, die mit beiden Optionen verbunden sind, und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen für Start-ups.
4 Gestaltungsmodell: Dieses Kapitel präsentiert ein mögliches Gestaltungsmodell, das auf den vorherigen Analysen aufbaut und die gesammelten Erkenntnisse in Form eines praxisorientierten Ansatzes für Start-ups zusammenfasst. Es werden konkrete Handlungsempfehlungen und Strategien für die erfolgreiche Nutzung von Crowdinvesting gegeben.
Schlüsselwörter
Crowdinvesting, Bankkredit, Start-up, Crowdfunding, Crowdsourcing, Venture Capital, Business Angels, Finanzierungsalternativen, Risikomanagement, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Crowdinvesting als Finanzierungsalternative für Start-ups
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Crowdinvesting als Finanzierungsmethode für Start-ups. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der wichtigsten Themen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von Crowdinvesting mit traditionellen Bankkrediten und der Entwicklung eines Gestaltungsmodells für die erfolgreiche Nutzung von Crowdinvesting durch Start-ups.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die Definition und Einordnung von Crowdinvesting im Kontext von Crowdfunding und Crowdsourcing, ein detaillierter Vergleich zwischen Crowdinvesting und Bankkrediten für Start-ups, die Analyse der Vor- und Nachteile beider Finanzierungsmethoden, eine Bewertung des aktuellen Stands von Crowdinvesting in Deutschland und die Entwicklung eines praxisorientierten Gestaltungsmodells für Start-ups.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in fünf Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, eine literarische Einführung in das Thema Crowdinvesting, eine Analyse von Crowdinvesting aus der Perspektive von Start-ups im Vergleich zu Bankkrediten, ein Kapitel mit einem Gestaltungsmodell und abschließend eine Zusammenfassung und ein kritisches Resümee. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung ist es, Crowdinvesting als Finanzierungsalternative für Start-ups zu untersuchen und die Vor- und Nachteile im Vergleich zu traditionellen Bankkrediten zu analysieren. Das Ziel ist ein umfassendes Verständnis dieser Finanzierungsmethode zu entwickeln und ein Gestaltungsmodell für eine erfolgreiche Umsetzung zu erstellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Crowdinvesting, Bankkredit, Start-up, Crowdfunding, Crowdsourcing, Venture Capital, Business Angels, Finanzierungsalternativen, Risikomanagement, Deutschland.
Wie wird Crowdinvesting im Dokument definiert?
Crowdinvesting wird als eine Form des Crowdfundings definiert, bei der Investoren Kapital in Start-ups investieren. Es wird im Detail im Kontext von Crowdfunding und Crowdsourcing eingeordnet und von anderen Finanzierungsmethoden wie Venture Capital und Business Angels abgegrenzt.
Wie wird Crowdinvesting mit Bankkrediten verglichen?
Der Vergleich zwischen Crowdinvesting und Bankkrediten erfolgt aus der Perspektive eines Start-ups. Es werden die jeweiligen Vor- und Nachteile, die Anforderungen und die Risiken beider Finanzierungswege analysiert und die spezifischen Herausforderungen für Start-ups beleuchtet.
Was beinhaltet das Gestaltungsmodell?
Das Gestaltungsmodell fasst die Ergebnisse der vorherigen Analysen zusammen und bietet praxisorientierte Handlungsempfehlungen und Strategien für Start-ups, um Crowdinvesting erfolgreich zu nutzen.
Welchen Fokus hat die Analyse des Status Quo in Deutschland?
Der Fokus liegt auf der Einordnung des Crowdinvestings in die deutsche Finanzierungslandschaft für Start-ups und auf der aktuellen Situation des Marktes in Deutschland.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Das Crowdinvesting als Alternative zum klassischen Bankkredit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445263