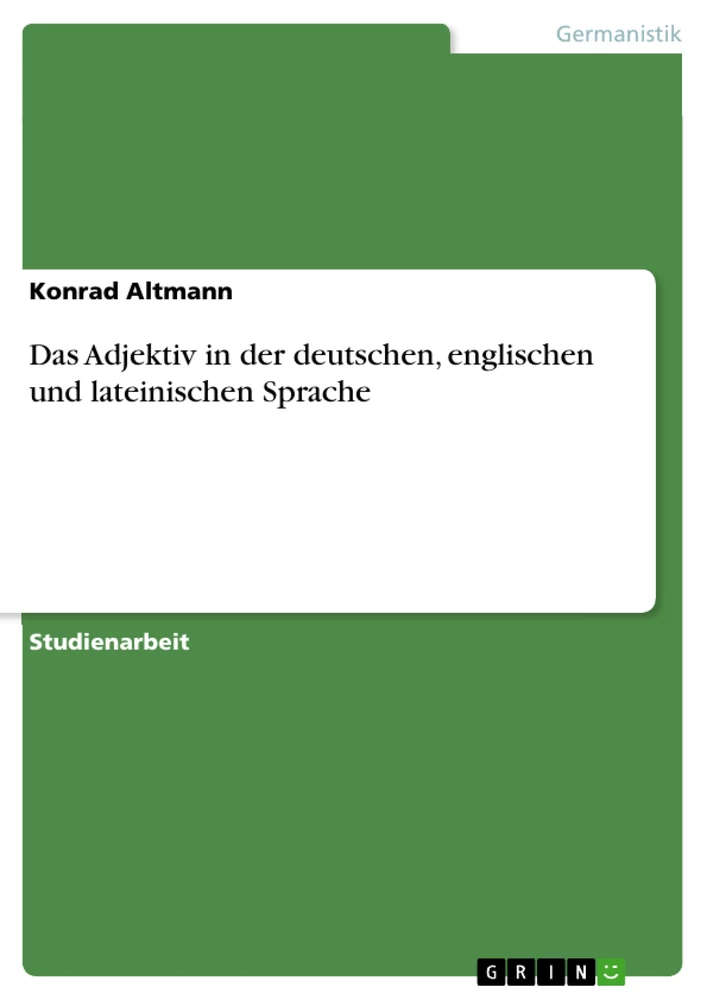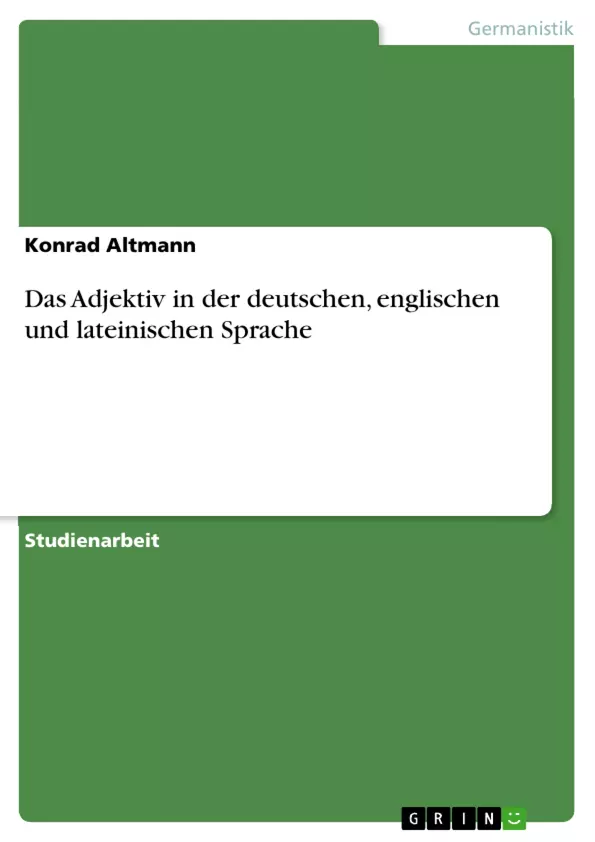Kinder lernen bereits in der Grundschulzeit im Deutschunterricht grundlegende Wortarten kennen – darunter auch die Adjektive. Ob nun Adjektive in den frühen Schuljahren auch schon als solche bezeichnet werden oder nicht, zeigt dies doch bereits deutlich deren Relevanz. Innerhalb dieser Hausarbeit soll nun die Frage beantwortet werden, was sich auf einer wissenschaftlichen Ebene über Adjektive aussagen lässt. Grob gesagt: Was zeichnet sie aus, welche Eigenschaften und Besonderheiten weisen sie auf?
Der Bogen soll in dieser Arbeit aber weiter gespannt werden als dass ausschließlich Aspekte des Deutschen betrachtet werden. Das Adjektiv wird darüber hinaus in der englischen wie in der lateinischen Sprache beleuchtet.
Bei der Betrachtung des Adjektivs im Deutschen wird zunächst auf dessen formale Eigenschaften eingegangen. Im Anschluss erfolgt eine vertiefende Betrachtung der Merkmale in Form einer Aufteilung in die Bereiche Gebrauchsweisen, Deklination und Komparation. Die zu untersuchende Wortart wird in Bezug auf die Sprachen Englisch und Latein ebenso in den Gebieten Gebrauchsweisen, Deklination und Komparation betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Adjektiv im Deutschen
- Die Gebrauchsweisen des Adjektivs im Deutschen
- Die Deklination des Adjektivs im Deutschen
- Die Komparation des Adjektivs im Deutschen
- Das Adjektiv im Englischen
- Die Gebrauchsweisen des Adjektivs im Englischen
- Die Deklination des Adjektivs im Englischen
- Die Komparation des Adjektivs im Englischen
- Das Adjektiv im Lateinischen
- Die Gebrauchsweisen des Adjektivs im Lateinischen
- Die Deklination des Adjektivs im Lateinischen
- Die Komparation des Adjektivs im Lateinischen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eigenschaften des Adjektivs in deutscher, englischer und lateinischer Sprache. Ziel ist es, die formalen und funktionalen Besonderheiten des Adjektivs in diesen Sprachen zu beschreiben und zu vergleichen.
- Formale Eigenschaften des Adjektivs (Deklination, Komparation)
- Gebrauchsweisen des Adjektivs (attributiv, prädikativ, adverbial, nominalisiert)
- Vergleich der Adjektivmerkmale im Deutschen, Englischen und Lateinischen
- Unterschiede in der Deklination und Komparation der Adjektive in den drei Sprachen
- Die Rolle des Adjektivs in der Satzstruktur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des Adjektivs in der Sprachwissenschaft. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit und kündigt den Vergleich des Adjektivs in Deutsch, Englisch und Latein an. Die Arbeit wird durch den Beitrag zum Thema des deutschen Adjektivs in Gallmann/Sitta 2007 inspiriert.
Das Adjektiv im Deutschen: Dieses Kapitel beschreibt die formalen Eigenschaften des deutschen Adjektivs, wie Deklination nach Kasus, Numerus und Genus, sowie die Verwendung von starker und schwacher Flexion. Es werden die Möglichkeiten der Komparation und die verschiedenen Gebrauchsweisen (attributiv, prädikativ, adverbial und nominalisiert) detailliert dargestellt und mit Beispielen illustriert. Die Unterschiede zur Deklination von Substantiven werden hervorgehoben und die Flexibilität der Adjektivdeklination im Vergleich zu Nomen betont. Der Abschnitt über die Gebrauchsweisen erläutert die unterschiedlichen Funktionen des Adjektivs im Satz und gibt Beispiele für attributive, prädikative und adverbiale Verwendung. Der Fokus liegt auf der Kongruenz des Adjektivs mit dem Substantiv.
Das Adjektiv im Englischen/Das Adjektiv im Lateinischen: (Angenommen, die Kapitel 2 und 3 enthalten ähnliche Strukturen wie Kapitel 1, dann würden die Zusammenfassungen hier analog zu Kapitel 1 aufgebaut sein, wobei die jeweiligen sprachspezifischen Besonderheiten im Fokus stehen würden. Es würden die formalen Eigenschaften, Gebrauchsweisen, Deklination und Komparation des Adjektivs in Englisch und Latein beschrieben und mit dem Deutschen verglichen werden. Dies würde die Unterschiede in der Morphologie und Syntax der drei Sprachen aufzeigen.)
Schlüsselwörter
Adjektiv, Deklination, Komparation, Gebrauchsweisen, Deutsch, Englisch, Latein, Morphologie, Syntax, Wortarten, Flexion, Kongruenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Das Adjektiv im Deutschen, Englischen und Lateinischen"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Adjektiv in drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Lateinisch. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der formalen und funktionalen Eigenschaften des Adjektivs in diesen Sprachen.
Welche Sprachen werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf Deutsch, Englisch und Lateinisch. Die Analyse betrachtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Deklination, Komparation und den Gebrauchsweisen des Adjektivs in diesen drei Sprachen.
Welche Aspekte des Adjektivs werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die formalen Eigenschaften des Adjektivs (Deklination, Komparation), die verschiedenen Gebrauchsweisen (attributiv, prädikativ, adverbial, nominalisiert) und den Vergleich dieser Aspekte in den drei untersuchten Sprachen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Kongruenz des Adjektivs mit dem Substantiv und der Rolle des Adjektivs in der Satzstruktur.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Adjektiv im Deutschen, Englischen und Lateinischen sowie ein Fazit (implizit). Jedes Kapitel zu den einzelnen Sprachen behandelt die Deklination, Komparation und Gebrauchsweisen des Adjektivs. Die Kapitel folgen einem vergleichbaren Aufbau, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich zu machen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die formalen und funktionalen Besonderheiten des Adjektivs in Deutsch, Englisch und Lateinisch zu beschreiben und zu vergleichen. Sie beleuchtet die Unterschiede in Morphologie und Syntax der drei Sprachen im Bezug auf das Adjektiv.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Adjektiv, Deklination, Komparation, Gebrauchsweisen, Deutsch, Englisch, Latein, Morphologie, Syntax, Wortarten, Flexion, Kongruenz.
Gibt es Beispiele im Dokument?
Die Zusammenfassung der Kapitel deutet darauf hin, dass das Dokument Beispiele zur Illustration der beschriebenen grammatikalischen Aspekte enthält, insbesondere zur Deklination und den verschiedenen Gebrauchsweisen des Adjektivs.
Welche Literatur wird genannt?
In der Zusammenfassung der Einleitung wird der Beitrag zum Thema des deutschen Adjektivs in Gallmann/Sitta 2007 erwähnt.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Das Dokument eignet sich für ein akademisches Publikum, das sich für einen detaillierten Vergleich des Adjektivs in Deutsch, Englisch und Lateinisch interessiert. Es ist insbesondere für Sprachwissenschaftler und Studenten der Linguistik relevant.
- Quote paper
- Konrad Altmann (Author), 2018, Das Adjektiv in der deutschen, englischen und lateinischen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/445376