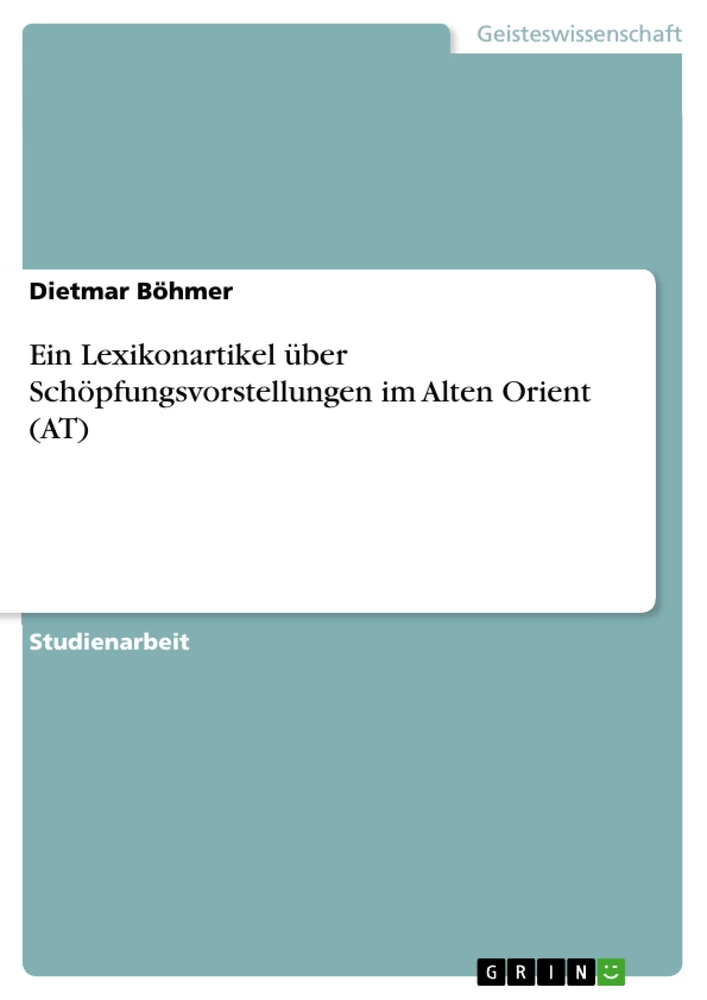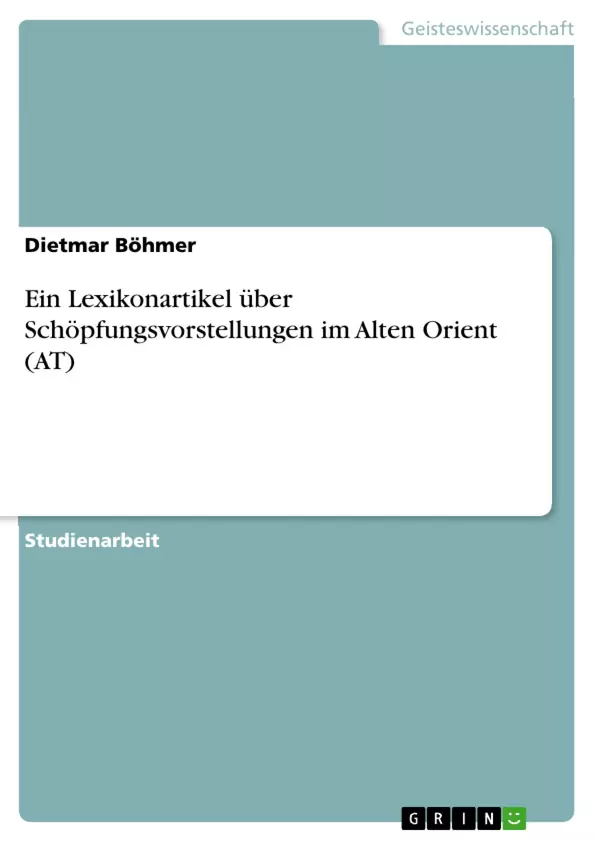Schöpfungsmythen entstehen immer dann, wenn sich Menschen Gedanken machen, woher sie kommen und wie die Welt entstand. In den Kulturen des Alten Orients, also auch bei den Israeliten, spielen Naturbeobachtungen über die Fortpflanzung eine große Rolle bei der Entwicklung der Schöpfungsvoraussetzungen. Daher setzt die Schöpfungsthematik grundsätzlich eine agrarische Ökonomie voraus. Dem stehen jedoch die Schöpfungsgeschichten in Genesis 1 und 2 gegenüber, die im jüdischen und im christlichen Kanon zu Beginn der Heiligen Schriften stehen. Das spricht für die Entstehung der Schöpfungsgeschichte zu einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung, denn in nomadischen Gesellschaften sind Reflexionen auf die Welt- und Naturordnung von nachgeordneter Bedeutung.
Gen 1 zeigt, dass das Schöpfungsthema das Ergebnis eines Diskurses vor allem mit mesopotamischen Konzeptionen ist, es also entsprechende Kontakte gegeben haben muss. Dies wiederum erfordert ein gewisses (Mindestmaß) an Schriftgelehrsamkeit in Israel, um an diesem speziellen Kulturaustausch teilzuhaben, was die These der späteren Verfasserschaft untermauert.
Dennoch ist die israelitische Schöpfungserzählung nicht erst in der Exilszeit entstanden, sehr wohl aber geschah damals der wirkungsmächtige Ausbau um die Vorstellung Jahwes als des Schöpfers der Welt zu akzentuieren. Dies fällt zeitlich wohl nicht zufällig mit der Ausprägung des Monotheismus zusammen.
Die Reflexion über Weltentstehung und Weltordnung geschah im Alten Orient nicht aus dem Nichts. Es waren Gelehrte, die darum stritten und große intellektuelle Leistungen vollbrachten. Ihre Forschungen waren auf der Höhe des damaligen wissenschaftlichen Diskurses. Auch wenn uns heute vieles wie eine Märchenerzählung vorkommt, so sollte man bei der Betrachtung der altorientalischen Schöpfungsmythen vor Augen haben, dass die damaligen Menschen eine bildhafte Vorstellung und Sprache pflegten und sie generell symbolisch, d.h. weder rein konkret noch rein abstrakt einsetzten.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtliche Entwicklung
- Der Schöpfungsbegriff und seine Terminologie
- Definition des Begriffs,Schöpfung'
- Klassifikation von Schöpfungsvorstellungen
- Vorstellungen der Schöpfungsakte
- Schöpfung als Zeugung/Geburt
- Schöpfung als Handwerk
- Schöpfung als Kampf
- Schöpfung als Zauber, Befehl, Machtwort
- Namensgebung
- Einfluss auf die alttestamentliche Schöpfungsvorstellung
- Schöpfung im Alten Testament
- Urgeschichte
- Schöpfung in der priesterlichen Urgeschichte (Gen 1,1-2,3)
- Schöpfung in der nichtpriesterlichen Urgeschichte (Gen 2,4-25)
- Prophetie - Deuterojesaja
- Psalter
- Weisheit - Sprüche, Hiob, Kohelet
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Schöpfungsbegriff im Alten Testament und verfolgt das Ziel, die geschichtliche Entwicklung, die Terminologie und die verschiedenen Vorstellungen von der Schöpfung in der alttestamentlichen Literatur zu analysieren. Dabei werden sowohl die priesterliche als auch die nichtpriesterliche Urgeschichte, die Prophetie, die Psalmen und die Weisheitsliteratur berücksichtigt.
- Geschichtliche Entwicklung des Schöpfungsbegriffs
- Die Terminologie und verschiedene Verben für den Schöpfungsakt im Hebräischen
- Klassifikation von Schöpfungsvorstellungen im Alten Orient
- Die Bedeutung der Schöpfung in verschiedenen alttestamentlichen Texten
- Der Einfluss der Schöpfungsvorstellung auf die Theologie und die Weltanschauung im Judentum
Zusammenfassung der Kapitel
Geschichtliche Entwicklung
Die Entstehung von Schöpfungsmythen wird mit der Reflexion der Menschen über die Weltentstehung und ihren Ursprung in Verbindung gebracht. Der Einfluss von Naturbeobachtungen über die Fortpflanzung und die Bedeutung einer agrarischen Ökonomie für die Entwicklung des Schöpfungsbegriffs werden hervorgehoben. Die Schöpfungsgeschichten in Genesis 1 und 2 werden im Kontext der Entstehung der Heiligen Schriften im jüdischen und christlichen Kanon betrachtet. Die Entstehung der priesterlichen Schöpfungsgeschichte im späteren Verlauf der Entwicklung wird durch den Diskurs mit mesopotamischen Konzeptionen und den entsprechenden Kontakten zwischen den Kulturen erklärt. Die Ausprägung des Monotheismus und die Akzentuierung Jahwes als Schöpfer der Welt im Exil werden ebenfalls angesprochen. Die Schöpfungsmythen werden als Ergebnis intellektueller Leistungen von Gelehrten im Alten Orient betrachtet, die im damaligen wissenschaftlichen Diskurs eine bedeutende Rolle spielten. Die symbolische Sprache und die bildhafte Vorstellung der damaligen Menschen werden in Bezug auf die Schöpfungsmythen betont. Die statistische Seltenheit des Motivs der Erschaffung der Welt in den alttestamentlichen Texten wird mit ihrer dominanten Position zu Beginn der Bibel in Verbindung gebracht. Die Schöpfungsmythen werden als keine Beschreibung naturwissenschaftlicher Vorgänge betrachtet, sondern als Erklärung des „Wozu“ der Schöpfung. Schöpfung wird als Einrichten von Ordnungen verstanden, in denen Leben gedeihen kann. Der Mensch als Ebenbild Gottes und sein Fall in die Sünde werden als entscheidende Elemente im Zusammenhang mit der Schöpfung betrachtet.
Der Schöpfungsbegriff und seine Terminologie
Die verschiedenen Verben, die in der hebräischen Bibel für den Schöpfungsbegriff verwendet werden, werden vorgestellt. Das Verb „br' schafen“ wird als charakteristisch für Genesis 1 beschrieben und als Ausdruck für Gottes schöpferisches Handeln betrachtet. Weitere Verben werden in drei Gruppen unterteilt: artifizielle Verben, biologische Verben und performative Verben. Die Unterschiede zwischen dem Schöpfungsverständnis im Alten Orient und der heutigen Zeit werden hervorgehoben. Zwei theologische Begriffe, „Creatio prima“ und „Creatio continua“, werden definiert und im Zusammenhang mit dem Schöpfungsbegriff erläutert. Die Vielzahl von Schöpfungs bezeichnenden Verben wird mit den Einflüssen aus dem Alten Orient in Verbindung gebracht, die zur Ausbildung der israelitischen Schöpfungsvorstellung führten.
Definition des Begriffs,Schöpfung'
Die Definition des Schöpfungsbegriffs im altorientalischen Verständnis nach Zgoll wird vorgestellt: Schöpfung als ein Prozess der Entfaltung, der in der Entstehung von Welt, Göttern und Menschen seinen Ausgangspunkt nimmt. Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Schöpfung im altorientalischen und im jüdisch/christlichen Kontext werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Schöpfung, Schöpfungsakt, Schöpfungsvorstellung, Schöpfungsmythos, Schöpfungsgeschichte, Schöpfungsbegriff, Schöpfungsmythologie, Genesis, Jahwe, alttestamentliche Literatur, altorientalisches Verständnis, Hebräisch, Terminologie, artifizielle Verben, biologische Verben, performative Verben, Creatio prima, Creatio continua, Weltentstehung, Weltordnung, Gott, Mensch, Sünde, Fall, Judentum, Christentum
Häufig gestellte Fragen
Wie entstanden die Schöpfungsmythen im Alten Orient?
Schöpfungsmythen entstanden aus Naturbeobachtungen (z. B. Fortpflanzung) und der Reflexion über den Ursprung der Welt. Sie setzen oft eine agrarische Gesellschaft voraus, in der die Ordnung der Natur überlebenswichtig war.
Was bedeutet „Schöpfung“ im altorientalischen Verständnis?
Schöpfung wird nicht als naturwissenschaftliche Beschreibung verstanden, sondern als das Einrichten von Ordnungen, in denen Leben gedeihen kann. Es geht um das „Wozu“ der Weltentstehung.
Welche verschiedenen Arten von Schöpfungsakten gibt es?
Die Literatur unterscheidet Schöpfung als Zeugung/Geburt, als handwerkliches Tun (z. B. Töpfern), als Sieg in einem Urkampf oder als bloßes Machtwort/Befehl Gottes.
Was ist der Unterschied zwischen Creatio prima und Creatio continua?
Creatio prima bezeichnet die erstmalige Erschaffung der Welt am Anfang der Zeit. Creatio continua beschreibt das fortlaufende schöpferische Handeln Gottes zur Erhaltung der Weltordnung.
Wie beeinflusste die Exilszeit die israelitische Schöpfungsvorstellung?
In der Exilszeit wurde die Vorstellung von Jahwe als alleinigem Schöpfer der Welt massiv ausgebaut, um den Monotheismus gegenüber mesopotamischen Göttervorstellungen zu stärken.
- Citar trabajo
- Dietmar Böhmer (Autor), 2015, Ein Lexikonartikel über Schöpfungsvorstellungen im Alten Orient (AT), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446171