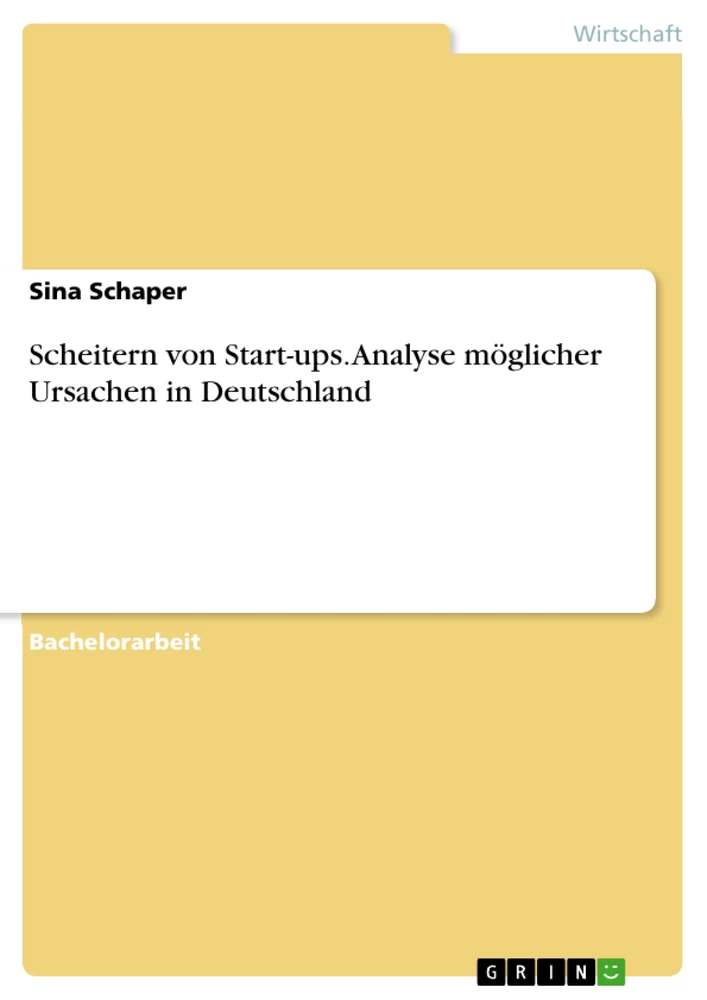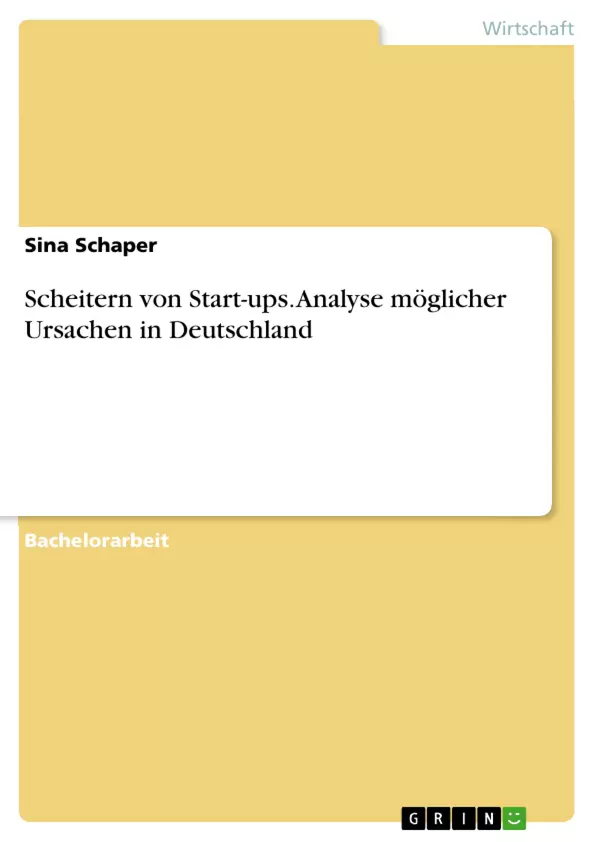Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, konkrete Ursachen herauszuarbeiten, an denen Start-ups in Deutschland letztendlich scheitern. Des Weiteren sollen Vorgehensweisen beschrieben werden, welche ein mögliches Scheitern von Unternehmen verhindern können.
Start-ups zeichnen sich in der Theorie durch zwei essentielle Merkmale hinsichtlich ihres Gründungsvorhabens aus. Zum einen ist die Verwirklichung der innovativen Geschäftsidee von hoher Bedeutung, zum anderen ist starkes Wachstum sowie die Ausweitung ihrer Geschäfte zur Stärkung ihrer Kapitalbasis als weiteres Primärziel anzusehen. Auf Grundlage dieser Zuschreibung von Attributen, erscheint eine Verknüpfung zwischen den Begriffen Start-up und dem unternehmerischen Scheitern zunächst paradox.
Die Praxis hingegen verdeutlicht, dass vor allem Start-ups vom Misserfolg bedroht sind. Die Insolvenzquote deutscher Jungunternehmen, welche sich existentiell unterhalb der 10 Jahresgrenze bewegen, liegt bei 50,7 %. Somit erleidet jedes zweite Start-up in Deutschland einen finanziellen und oftmals end-gültigen Zusammenbruch. Verschärfend konstatiert der Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), dass ein Großteil der Unternehmen bereits in den ersten Geschäftsjahren scheitert. Nach drei Jahren, ausgehend von der Existenzgründung, sind lediglich 68 % der Unternehmen noch aktiv.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen
- 2.1 Start-ups
- 2.2 Scheitern von Unternehmen
- 3 Ursachen des Scheiterns
- 3.1 Kennzeichen unternehmerischen Scheiterns
- 3.2 Stand der Forschung
- 3.3 Historische Entwicklung von Unternehmensinsolvenzen
- 3.4 Phasenmodelle von Krisenprozessen
- 3.5 Endogene Ursachen
- 3.5.1 Businessplanung und Geschäftsmodell
- 3.5.2 Finanzen
- 3.5.3 Management und unternehmerische Entscheidungen
- 3.5.4 Personal
- 3.5.5 Kooperationsbeziehungen und Geschäftspartner
- 3.5.6 Forschung und Entwicklung
- 3.5.7 Produkt
- 3.5.8 Rechnungswesen und Controlling
- 3.5.9 Vertrieb und Marketing
- 3.6 Exogene Ursachen
- 3.6.1 Markt und Wettbewerb
- 3.6.2 Faktorkosten
- 3.7 Gesamtbetrachtung
- 4 Folgen des Scheiterns
- 4.1 Gesellschaftliche Folgen
- 4.2 Volkswirtschaftliche Folgen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen des Scheiterns von Start-ups in Deutschland. Sie zielt darauf ab, konkrete Faktoren zu identifizieren, die zum Misserfolg führen, und mögliche präventive Maßnahmen aufzuzeigen. Die Analyse berücksichtigt sowohl interne als auch externe Einflussfaktoren.
- Analyse der Ursachen für das Scheitern von Start-ups in Deutschland
- Untersuchung interner Faktoren (z.B. Businessplanung, Finanzen, Management)
- Untersuchung externer Faktoren (z.B. Marktbedingungen, Wettbewerb)
- Beschreibung der Folgen des Scheiterns (gesellschaftlich und volkswirtschaftlich)
- Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Unternehmensinsolvenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die hohe Insolvenzrate deutscher Start-ups dar und begründet die Notwendigkeit der Analyse der Scheiterfaktoren. Sie hebt die paradoxe Verbindung zwischen Innovation, starkem Wachstum und der hohen Misserfolgswahrscheinlichkeit hervor und verdeutlicht die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Konsequenzen von Unternehmensinsolvenzen, insbesondere den Verlust von Arbeitsplätzen. Die Arbeit kündigt die Untersuchung konkreter Ursachen und präventiver Maßnahmen an.
2 Definitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der Begriffe "Start-up" und "Unternehmerisches Scheitern", um eine gemeinsame Basis für die weitere Analyse zu schaffen. Es dient der Abgrenzung und Klärung der verwendeten Terminologie und bildet die Grundlage für die objektive Bewertung der dargestellten Daten und der weiteren Analyse.
3 Ursachen des Scheiterns: Dieser zentrale Teil der Arbeit analysiert die Faktoren, die zum Scheitern von Start-ups beitragen. Er differenziert zwischen endogenen (internen) und exogenen (externen) Ursachen. Die endogenen Ursachen umfassen Aspekte wie unzureichende Businessplanung, finanzielle Schwierigkeiten, Managementfehler, Personalprobleme, mangelnde Kooperationen, fehlende Innovation, schlechte Rechnungswesen- und Controlling-Systeme sowie ineffektives Vertriebs- und Marketingmanagement. Exogene Ursachen beinhalten Markt- und Wettbewerbsbedingungen sowie Faktorkosten. Die Kapitel analysieren diese Faktoren detailliert und zeigen deren komplexes Zusammenspiel auf. Die Gesamtbetrachtung fasst die einzelnen Aspekte zusammen und verdeutlicht deren Wechselwirkungen.
4 Folgen des Scheiterns: Dieses Kapitel beleuchtet die Konsequenzen des Scheiterns von Start-ups, sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf volkswirtschaftlicher Ebene. Es werden die negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung diskutiert, wobei quantitative Daten zur Veranschaulichung verwendet werden. Die Analyse hebt die Bedeutung hervor, das Scheitern von Unternehmen zu minimieren, um negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Volkswirtschaft zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Start-ups, Unternehmensinsolvenz, Scheiterfaktoren, Endogene Ursachen, Exogene Ursachen, Businessplanung, Finanzen, Management, Markt, Wettbewerb, Volkswirtschaftliche Folgen, Gesellschaftliche Folgen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Ursachen des Scheiterns von Start-ups in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die Ursachen des Scheiterns von Start-ups in Deutschland. Sie analysiert sowohl interne (endogene) als auch externe (exogene) Faktoren, die zum Misserfolg führen, und beleuchtet die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Folgen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, präzise Definitionen von "Start-up" und "Unternehmerisches Scheitern", eine detaillierte Analyse der Ursachen des Scheiterns (unterteilt in endogene und exogene Faktoren wie Businessplanung, Finanzen, Management, Marktbedingungen, Wettbewerb etc.), eine Betrachtung der Folgen des Scheiterns (gesellschaftlich und volkswirtschaftlich) und abschließend ein Fazit.
Welche Arten von Ursachen für das Scheitern von Start-ups werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen endogenen (internen) und exogenen (externen) Ursachen. Endogene Ursachen umfassen beispielsweise unzureichende Businessplanung, finanzielle Probleme, Managementfehler, Personalprobleme, mangelnde Kooperationen, fehlende Innovation, schlechte Rechnungswesen- und Controlling-Systeme sowie ineffektives Vertriebs- und Marketingmanagement. Exogene Ursachen beinhalten Markt- und Wettbewerbsbedingungen sowie Faktorkosten.
Welche Folgen des Scheiterns von Start-ups werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Folgen des Scheiterns. Hierzu gehören negative Auswirkungen auf die Beschäftigung und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Quantitative Daten werden zur Veranschaulichung verwendet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in Kapitel zu Einleitung, Definitionen (Start-ups und Scheitern), Ursachen des Scheiterns (mit Unterkapiteln zu endogenen und exogenen Faktoren), Folgen des Scheiterns und einem Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Start-ups, Unternehmensinsolvenz, Scheiterfaktoren, Endogene Ursachen, Exogene Ursachen, Businessplanung, Finanzen, Management, Markt, Wettbewerb, Volkswirtschaftliche Folgen, Gesellschaftliche Folgen, Deutschland.
Wo finde ich eine detaillierte Übersicht über die Kapitel?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln und Unterkapiteln ist im Dokument enthalten. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet eine prägnante Übersicht über den Inhalt jedes Kapitels.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, konkrete Faktoren zu identifizieren, die zum Misserfolg von Start-ups in Deutschland führen, und mögliche präventive Maßnahmen aufzuzeigen. Die Analyse berücksichtigt sowohl interne als auch externe Einflussfaktoren.
- Quote paper
- Sina Schaper (Author), 2017, Scheitern von Start-ups. Analyse möglicher Ursachen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446174