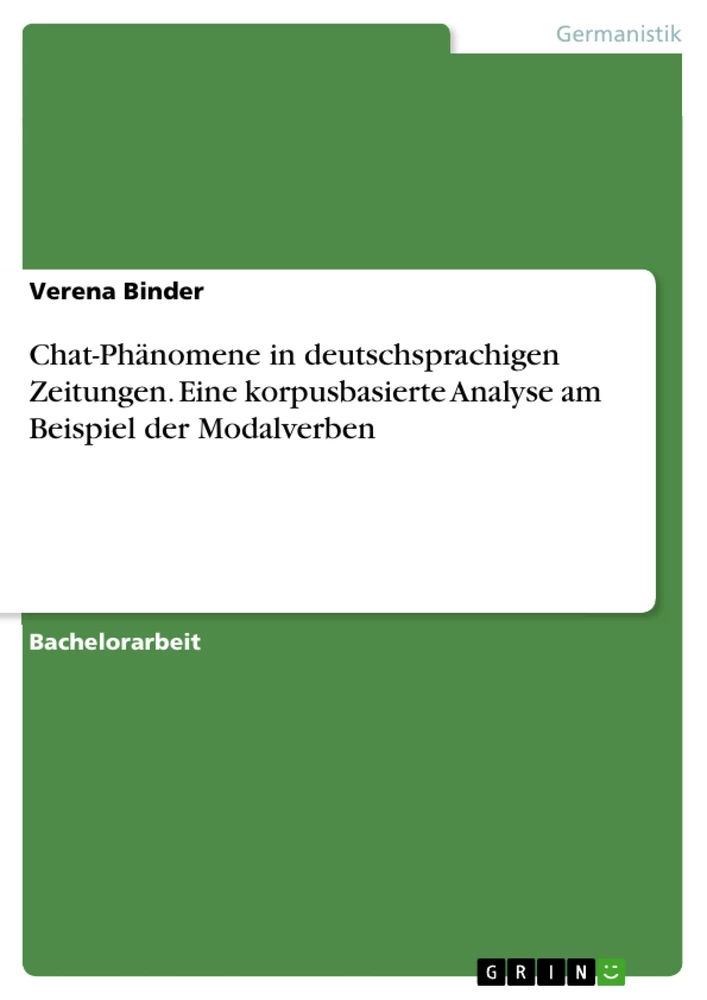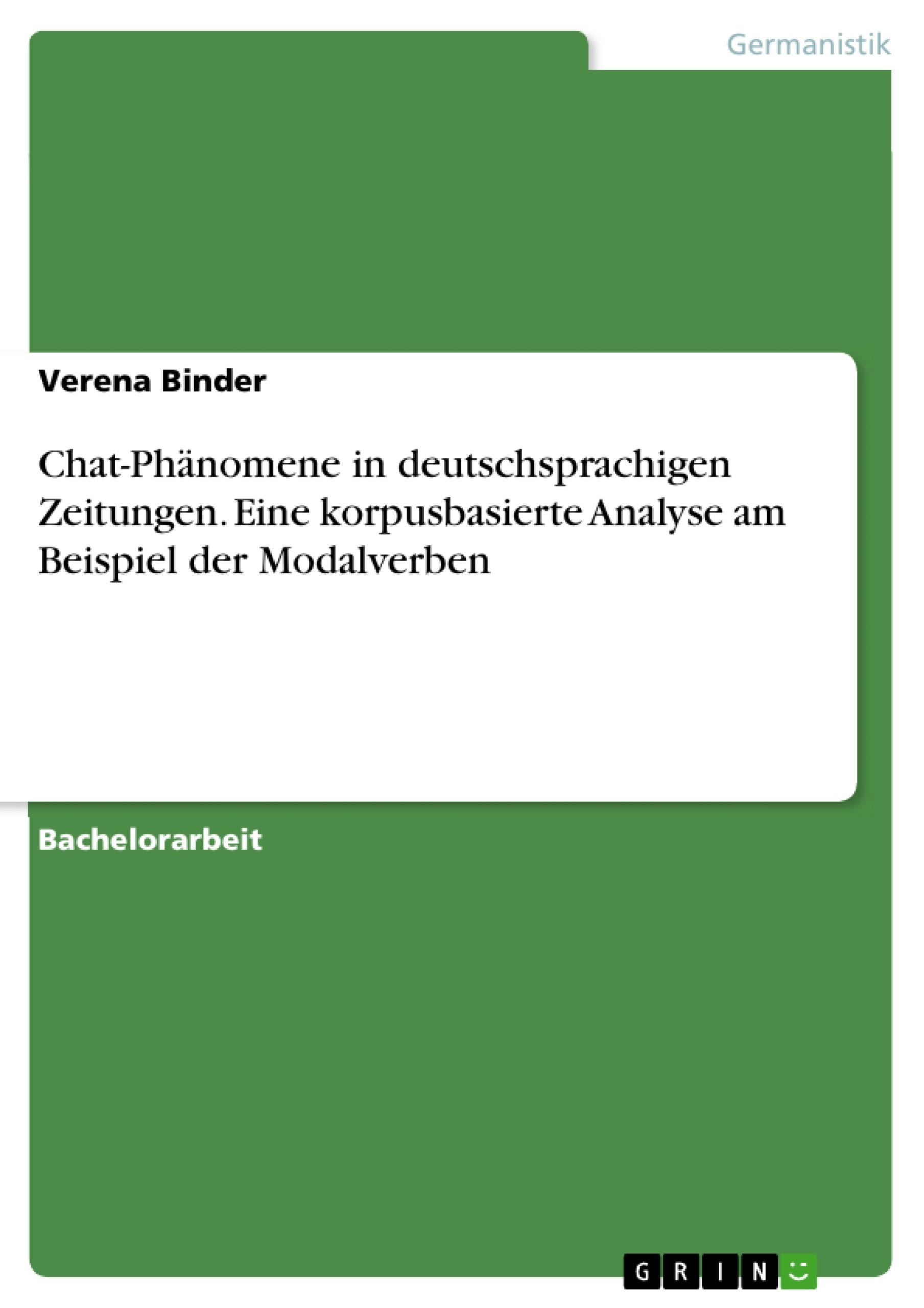In der vorliegenden Arbeit möchte ich anhand von korpusbasierten Analysen die Frage beantworten, ob und inwiefern die Sprache in deutschsprachigen Zeitungen von den in Chats auftretenden linguistischen Besonderheiten beeinflusst wird. Ich führe die Untersuchung am Beispiel der syntaktischen Struktur der Modalverb-Verwendung durch. Modale Verben sind erstens in beiden relevanten Textsorten hochfrequent und bieten zweitens eine Vielzahl unterschiedlicher Gebrauchsmöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Korpora und Methode
- Dortmunder Chat-Korpus
- Plauderchats
- Professionelle Chats
- Audio- und Videochats, Instant Messaging
- Deutsches Referenzkorpus
- Exemplarische Analyse der Verwendung von Modalverben in Chats und Zeitungen
- Dürfen
- Plauderchats
- Professionelle Chats
- Zeitungsartikel
- Können
- Plauderchats
- Professionelle Chats
- Zeitungsartikel
- Mögen/Möchte(n)
- Müssen
- Plauderchats
- Professionelle Chats
- Zeitungsartikel
- Sollen
- Plauderchats
- Professionelle Chats
- Wollen
- Plauderchats
- Professionelle Chats
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern die Sprache in deutschsprachigen Zeitungen von chattypischen Phänomenen beeinflusst wird. Mithilfe von korpusbasierten Analysen werden die Verwendungsweisen von Modalverben in Chats und Zeitungen verglichen, um mögliche Parallelen und Unterschiede aufzuzeigen.
- Einfluss von Chatsprache auf die Sprache in Zeitungen
- Syntaktische Struktur der Modalverb-Verwendung in Chats und Zeitungen
- Vergleich von Standardverwendung und auffälligen Gebrauchsweisen von Modalverben
- Untersuchung der Modalverb-Verwendung in Plauderchats, professionellen Chats und Zeitungstexten
- Bedeutung des Dortmunder Chat-Korpus und des Deutschen Referenzkorpus für die Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Forschungsfrage sowie die gewählte Methode. Außerdem werden die verwendeten Korpora vorgestellt. In den darauffolgenden Kapiteln wird die Verwendung der einzelnen Modalverben in Plauderchats, professionellen Chats und Zeitungstexten analysiert, wobei jeweils die Standardverwendung und auffällige Gebrauchsweisen dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Chatsprache, Modalverben, Korpuslinguistik, Deutsches Referenzkorpus, Dortmunder Chat-Korpus, Zeitungstextanalyse, Standardverwendung, auffällige Gebrauchsweisen.
Häufig gestellte Fragen
Beeinflusst die Chatsprache die Sprache in Zeitungen?
Die Arbeit untersucht korpusbasiert, ob linguistische Besonderheiten aus Chats, wie etwa informelle syntaktische Strukturen, in die geschriebene Zeitungssprache übergehen.
Warum werden Modalverben für die Analyse genutzt?
Modalverben (dürfen, können, müssen etc.) sind sowohl in Chats als auch in Zeitungen hochfrequent und zeigen vielfältige Gebrauchsmöglichkeiten, die sprachlichen Wandel gut sichtbar machen.
Was ist das Dortmunder Chat-Korpus?
Es ist eine Sammlung von digitaler Kommunikation, die verschiedene Chat-Typen (Plauderchats, professionelle Chats) für linguistische Analysen bereitstellt.
Gibt es Unterschiede zwischen Plauderchats und professionellen Chats?
Ja, die Arbeit differenziert zwischen informellen Plauderchats und zweckgebundenen professionellen Chats, da sich die Verwendung von Modalverben je nach Kontext unterscheidet.
Was ist das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo)?
Das DeReKo dient als Vergleichsbasis für die Standardsprache in Zeitungen und enthält Millionen von Belegen aus deutschsprachigen Printmedien.
- Quote paper
- Verena Binder (Author), 2018, Chat-Phänomene in deutschsprachigen Zeitungen. Eine korpusbasierte Analyse am Beispiel der Modalverben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446276