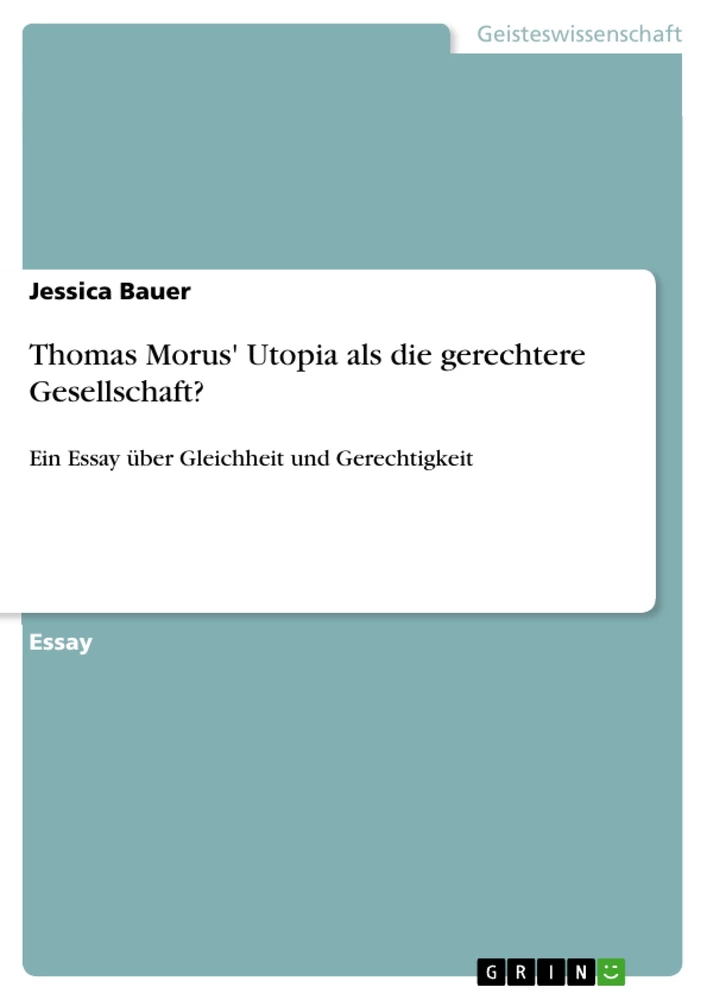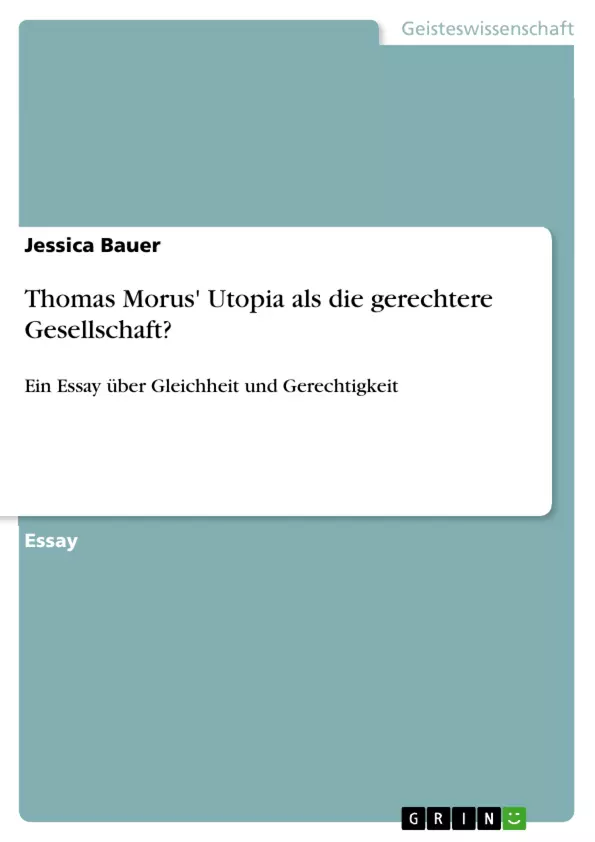Der um 1478 in London geborene Thomas Morus gilt mit seinem literarischen Werk „Utopia“, das er um 1516 in lateinischer Schrift verfasste, als Begründer der modernen Sozialutopie. Aufgeteilt in zwei Büchern thematisiert er hier ein Ideal einer Gesellschaft fernab von den zu dieser Zeit in England herrschenden Strukturen, die insbesondere zu Ungunsten der unteren Klassen ausfielen. Die Verhältnisse, die im England des sechszehnten Jahrhunderts vorzufinden waren, stellten den wesentlichen Beweggrund für Morus zum Schreiben dieses Buches dar. Wie auch in anderen Ländern waren die Menschen zu dieser Zeit abhängig von den jährlichen Ernteergebnissen, da die Import- und Exportmöglichkeiten noch sehr gering waren. So lebten 90% der englischen Bevölkerung auf dem Land, um dort mit landwirtschaftlichen Schwerstarbeiten ihr existenzielles Überleben zu sichern. Erst als der aus dem Westen kommende Frühkapitalismus seinen Weg nach England fand, wurden die Städte, vor allem aber die heutige Hauptstadt London, von Menschenmassen überflutet. Allerdings war diese Verstädterung keineswegs die Folge positiver Entwicklungen. Vielmehr begünstigte sie die Verarmung der Menschen, die durch Landarbeit ihr täglich Brot verdienten. So wurden Bauern von ihrem Land gewaltvoll vertrieben und flüchteten in die nahegelegenen Städte, wo sie dann auf den Straßen verhungerten, sofern sie nicht als Tagelöhner in den neu entstandenen Fabriken Arbeit fanden. Die wirtschaftlichen Veränderungen hatten zur Folge, dass sich die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich verschärfte, wobei das Lager der Besitzenden die deutliche Minderheit bildete.
Empört über derartig strukturierte Verhältnisse machte es sich Morus zur Aufgabe einen Staat zu entwickeln, der auf der Idee einer idealen Gesellschaft beruht. Sein dabei entstandenes Werk „Utopia“ kann als Abrechnung zum Frühkapitalismus gesehen werden, welches die am Beispiel Englands entstandenen Ungerechtigkeiten versucht auszuloten.
In dieser Arbeit soll erörtert werden, inwiefern es Morus gelungen oder auch nicht gelungen ist, einen für alle gerechten Idealstaat zu konstruieren. Dabei sollen Parallelen zum sich im 19. Jahrhundert etablierten Kommunismus gezogen werden, welcher, wie Utopia selbst, durch die Umsetzung bestimmter, egalitaristischer Ideen versucht, Gerechtigkeit zu erlangen.
Inhaltsverzeichnis
- Utopia - Die Beweggründe
- Utopia - eine Einführung
- Die kommunistische Richtung
- Utopia - die gesellschaftliche Organisation
- Arbeitsregelung
- Soziale Beziehungen
- Das Kriegswesen
- Die politische Organisation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Thomas Morus' "Utopia" und beleuchtet seine Vision einer gerechten Gesellschaft. Dabei wird untersucht, wie Morus' Idee von Gleichheit und Gerechtigkeit in der Gestaltung der Gesellschaft in Utopia umgesetzt wird, und ob diese Gesellschaft als ein idealer Staat angesehen werden kann.
- Die Beweggründe für Morus' Utopia
- Die Umsetzung von Gleichheit und Gerechtigkeit in Utopia
- Die gesellschaftliche Organisation in Utopia
- Parallelen zu anderen Sozialutopien, insbesondere zum Kommunismus
- Die Grenzen und Kritikpunkte von Morus' Vision
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Beweggründe für Morus' Utopia. Es stellt die gesellschaftlichen Verhältnisse im England des 16. Jahrhunderts dar und zeigt auf, wie die Spaltung in Arm und Reich zu Ungerechtigkeit und Leid führte. Morus' Werk wird als eine Kritik an den bestehenden Strukturen und als ein Versuch, eine gerechtere Gesellschaft zu entwerfen, interpretiert.
Das zweite Kapitel führt in Morus' Utopia ein. Es erläutert die Idee eines Idealstaats, der für Gerechtigkeit und Wohlstand aller Menschen steht. Das Kapitel untersucht die Umsetzung des Gerechtigkeitskonzepts in Utopia und zeigt auf, wie Morus die Gleichheit von allen Menschen durch die Abschaffung von Privateigentum und die Einführung einer kollektiven Gemeinschaft erreichen möchte.
Kapitel drei untersucht die Parallelen zwischen Morus' Utopia und dem Kommunismus. Es zeigt auf, wie beide Ideologien auf der Kritik am Kapitalismus und der Suche nach einer gerechteren Gesellschaftsordnung basieren. Die Abschaffung des Privateigentums und die Gleichverteilung von Ressourcen sind wichtige Gemeinsamkeiten beider Konzepte.
Kapitel vier beleuchtet die gesellschaftliche Organisation in Utopia. Es beschreibt die Arbeitsregelung, die sozialen Beziehungen und die Organisation des Kriegswesens. Dabei wird deutlich, dass Morus eine Gesellschaft ohne Klassenunterschiede und mit einer ausgeprägten Solidarität unter den Bürgern anstrebt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte des Essays sind Utopia, Gerechtigkeit, Gleichheit, Sozialutopie, Kommunismus, Kapitalismus, Gesellschaftliche Organisation, Arbeitsregelung, Soziale Beziehungen, Kriegswesen, Idealstaat, Kritik, Reichtumsunterschiede, Ungleichheit, Leid, Wohlstand.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für Thomas Morus, "Utopia" zu schreiben?
Morus reagierte auf die sozialen Ungerechtigkeiten und die Verarmung der Bevölkerung im England des 16. Jahrhunderts, die durch den frühen Kapitalismus und Landvertreibungen verursacht wurden.
Wie ist die Gesellschaft in Utopia organisiert?
Die Gesellschaft in Utopia basiert auf der Abschaffung von Privateigentum, kollektiver Arbeit und einer gerechten Verteilung von Ressourcen ohne Klassenunterschiede.
Welche Parallelen gibt es zwischen Utopia und dem Kommunismus?
Beide Konzepte fordern die Aufhebung des Privateigentums und streben eine egalitäre Gesellschaft an, um die Spaltung zwischen Arm und Reich zu überwinden.
Wie wird die Arbeit in Morus' Idealstaat geregelt?
In Utopia herrscht eine allgemeine Arbeitspflicht, wobei die Arbeitszeit begrenzt ist, um den Bürgern Raum für Bildung und persönliche Entwicklung zu lassen.
Ist Morus' Utopia wirklich ein perfekter Staat?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Morus ein wirklich gerechtes Modell geschaffen hat oder ob seine Vision auch Grenzen und Widersprüche aufweist.
- Citar trabajo
- Jessica Bauer (Autor), 2017, Thomas Morus' Utopia als die gerechtere Gesellschaft?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446504