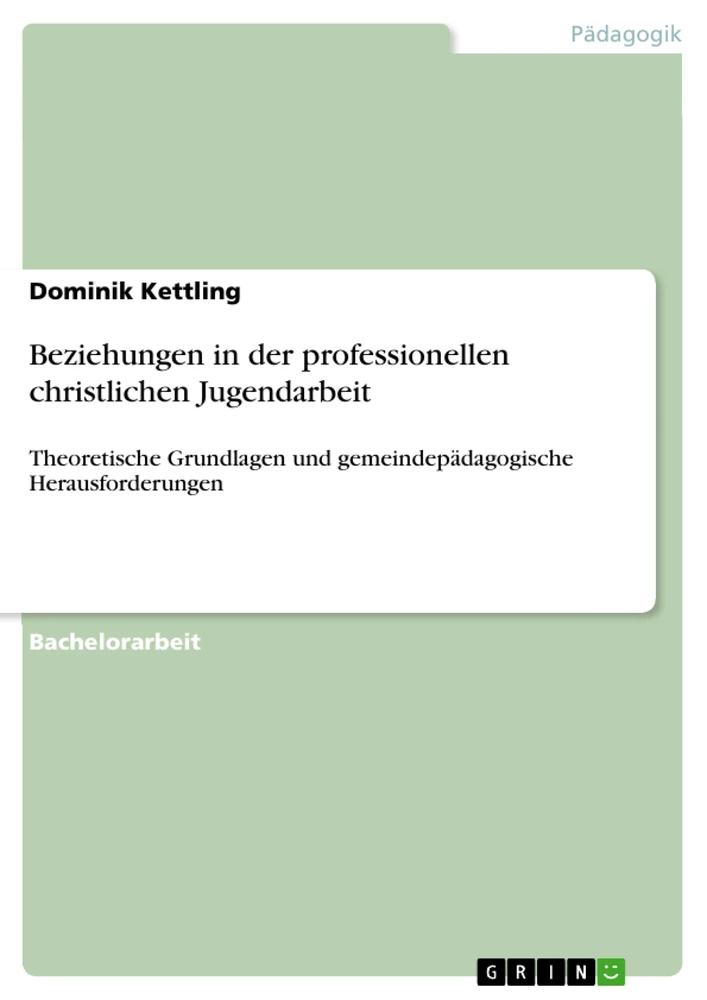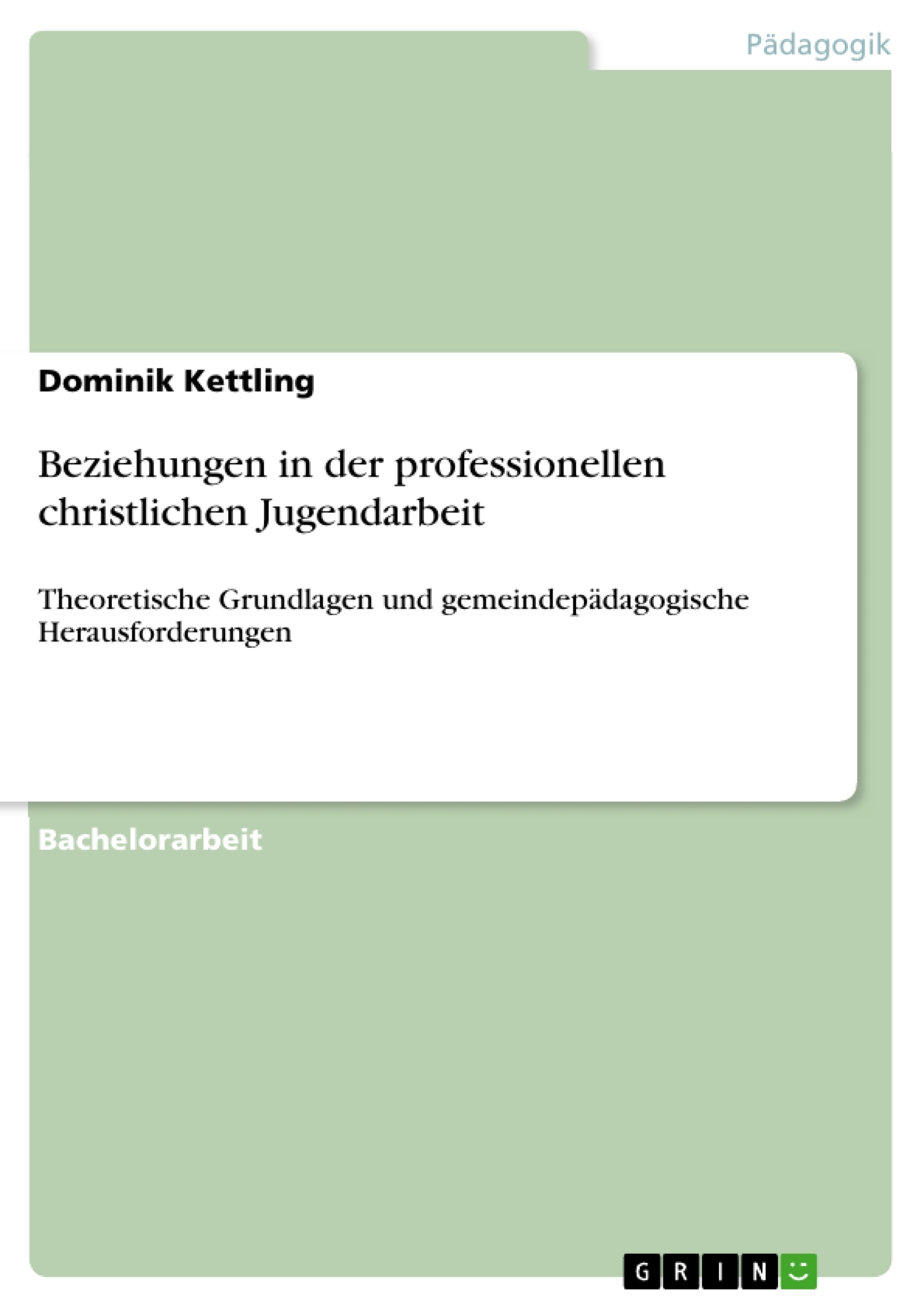Die vorliegende Abschlussarbeit befasst sich mit der Thematik von professioneller, christlicher Jugendarbeit unter der besonderen Berücksichtigung von gemeindepädagogischen Herausforderungen.
Christliche Jugendarbeit erreicht in Deutschland circa 1,35 Millionen Kinder und Jugendliche. Das heißt, diese Kinder und Jugendliche haben eine Beziehung zu der christlichen Jugendarbeit bzw. zu den dort tätigen Menschen. Hier stellt sich die Frage, von welchen Formen von Beziehung dort gesprochen wird und wie sie aus der professionellen Perspektive betrachtet werden kann? Welche Chancen und Gefahren bringen diese Beziehungen mit sich? Weiter: Von welchen Formen von Beziehung wird dort gesprochen? Wie können Beziehungen aus der professionellen Perspektive betrachtet werden? Welche Chancen und Gefahren bringen diese Beziehungen mit sich?
Um Antworten auf die Fragen zu finden, wurde das Themenfeld aus verschiedenen Blickwinkeln bearbeitet. Der Begriff Beziehung wurde definiert, aus theologischer, philosophischer und psychologischer Sicht. Eine daran anschließende Betrachtung von persönlicher Beziehung und Arbeitsbeziehung verdeutlichte die Besonderheit der Beziehungen in der christlichen Jugendarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- 1. Definition des Begriffes Beziehung
- 1.1 Theologisches Verständnis
- 1.2 Philosophisches Verständnis nach Martin Buber
- 1.3 Psychologisches Verständnis des personenzentrierten Ansatzes
- 1.4 Kommunikationstheorie nach Paul Watzlawick
- 2. Beziehungen im pädagogischen Kontext
- 2.1 Pädagogisches Verhältnis
- 2.1.1 Pädagogischer Bezug
- 2.1.2 Pädagogische Situation
- 2.1.3 Pädagogisches Feld
- 2.2 Beziehung als Arbeitsbeziehung
- 2.3 Persönliche Beziehung in Abgrenzung zur Arbeitsbeziehung
- 2.1 Pädagogisches Verhältnis
- 3. Christliche Jugendarbeit
- 3.1 Ziele der christlichen Jugendarbeit
- 3.2 Rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit
- 3.3 Geschichtliche Entwicklung der christlichen Jugendarbeit
- 3.4 Bildung in der christlichen Jugendarbeit
- 3.5 Handlungsfelder christlicher Jugendarbeit
- 3.6 Kernkompetenzen professioneller Jugendarbeit
- 4. Zwischenfazit - Beziehungen in der Jugendarbeit
- 5. Chancen von Beziehungsarbeit
- 5.1 Unterstützung bei der Identitätsfindung
- 5.2 Beziehungen als stellvertretende Ablösebeziehungen
- 6. Gefahren innerhalb der Beziehungsarbeit
- 6.1 Spannungsfeld Nähe und Distanz
- 6.2 Gefahr der sexualisierten Gewalt
- 7. Zukunft von christlicher Jugendarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Beziehungen in der professionellen christlichen Jugendarbeit. Sie analysiert die Bedeutung von Beziehungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und untersucht verschiedene Aspekte, die für die Gestaltung von Beziehungen in diesem Kontext relevant sind.
- Definition und Verständnis des Begriffs "Beziehung" aus verschiedenen Perspektiven (theologisch, philosophisch, psychologisch)
- Beziehung im pädagogischen Kontext und die Besonderheiten der Beziehung zwischen Gemeindepädagogen/Gemeindepädagoginnen und Kindern/Jugendlichen
- Chancen von Beziehungsarbeit in der Jugendarbeit, insbesondere im Hinblick auf Identitätsfindung und Ablösebeziehungen
- Gefahren von Beziehungsarbeit, wie das Spannungsfeld Nähe und Distanz und die Gefahr der sexualisierten Gewalt
- Mögliche Modelle für die Zukunft der christlichen Jugendarbeit, die die Bedeutung von Beziehungen berücksichtigen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Wichtigkeit von Beziehungen für die christliche Jugendarbeit. Im ersten Kapitel wird der Begriff "Beziehung" aus theologischer, philosophischer und psychologischer Sicht betrachtet. Kapitel 2 befasst sich mit verschiedenen Beziehungsformen im pädagogischen Kontext, wobei die Besonderheit der Beziehung in der christlichen Jugendarbeit herausgearbeitet wird.
Kapitel 3 gibt einen Einblick in die Ziele, rechtlichen Grundlagen und Geschichte der christlichen Jugendarbeit. Es werden auch verschiedene Handlungsfelder und Kernkompetenzen für professionelle Jugendarbeit vorgestellt. Kapitel 4 bietet ein Zwischenfazit über die spezifische Form von Beziehungen in der Jugendarbeit. Die Kapitel 5 und 6 analysieren Chancen und Gefahren der Beziehungsarbeit in der christlichen Jugendarbeit, wobei die Themen Identitätsfindung, Ablösebeziehungen, Nähe und Distanz sowie die Gefahr der sexualisierten Gewalt behandelt werden.
Schließlich wagt Kapitel 7 einen Blick in die Zukunft und beleuchtet mögliche Modelle für die christliche Jugendarbeit, die die Bedeutung von Beziehungen berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der professionellen christlichen Jugendarbeit, wobei die Bedeutung von Beziehungen im Mittelpunkt steht. Die Schlüsselwörter umfassen daher Bereiche wie pädagogische Beziehungen, Jugendpastoral, Identitätsentwicklung, Ablösebeziehungen, Spannungsfeld Nähe und Distanz, sexualisierte Gewalt, und Zukunftsmodelle für die christliche Jugendarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert Beziehungen in der christlichen Jugendarbeit?
Sie bewegen sich in einem besonderen Spannungsfeld zwischen professioneller Arbeitsbeziehung und persönlicher, oft theologisch motivierter Bindung.
Welche Chancen bietet die Beziehungsarbeit für Jugendliche?
Beziehungen dienen als Unterstützung bei der Identitätsfindung und können als „stellvertretende Ablösebeziehungen“ den Übergang zum Erwachsenenalter erleichtern.
Welche Gefahren gibt es in der pädagogischen Beziehungsarbeit?
Zentrale Gefahren sind das schwierige Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz sowie das Risiko von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt.
Wie definiert Martin Buber den Begriff „Beziehung“?
Bubers philosophisches Verständnis der Ich-Du-Beziehung ist eine wichtige Grundlage für das Verständnis von echter Begegnung in der Jugendarbeit.
Was sind die Kernkompetenzen professioneller Jugendarbeiter?
Neben theologischer Bildung sind Kommunikationsfähigkeit, Reflexion der eigenen Rolle und die Wahrung professioneller Distanz bei gleichzeitiger Empathie entscheidend.
- Quote paper
- Dominik Kettling (Author), 2018, Beziehungen in der professionellen christlichen Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446537