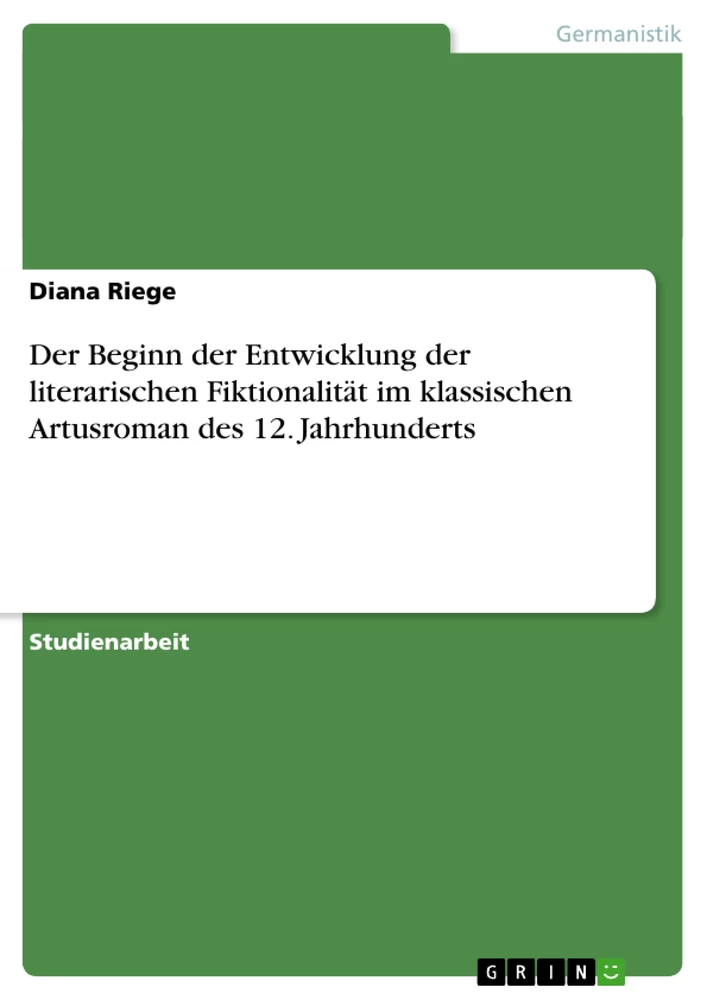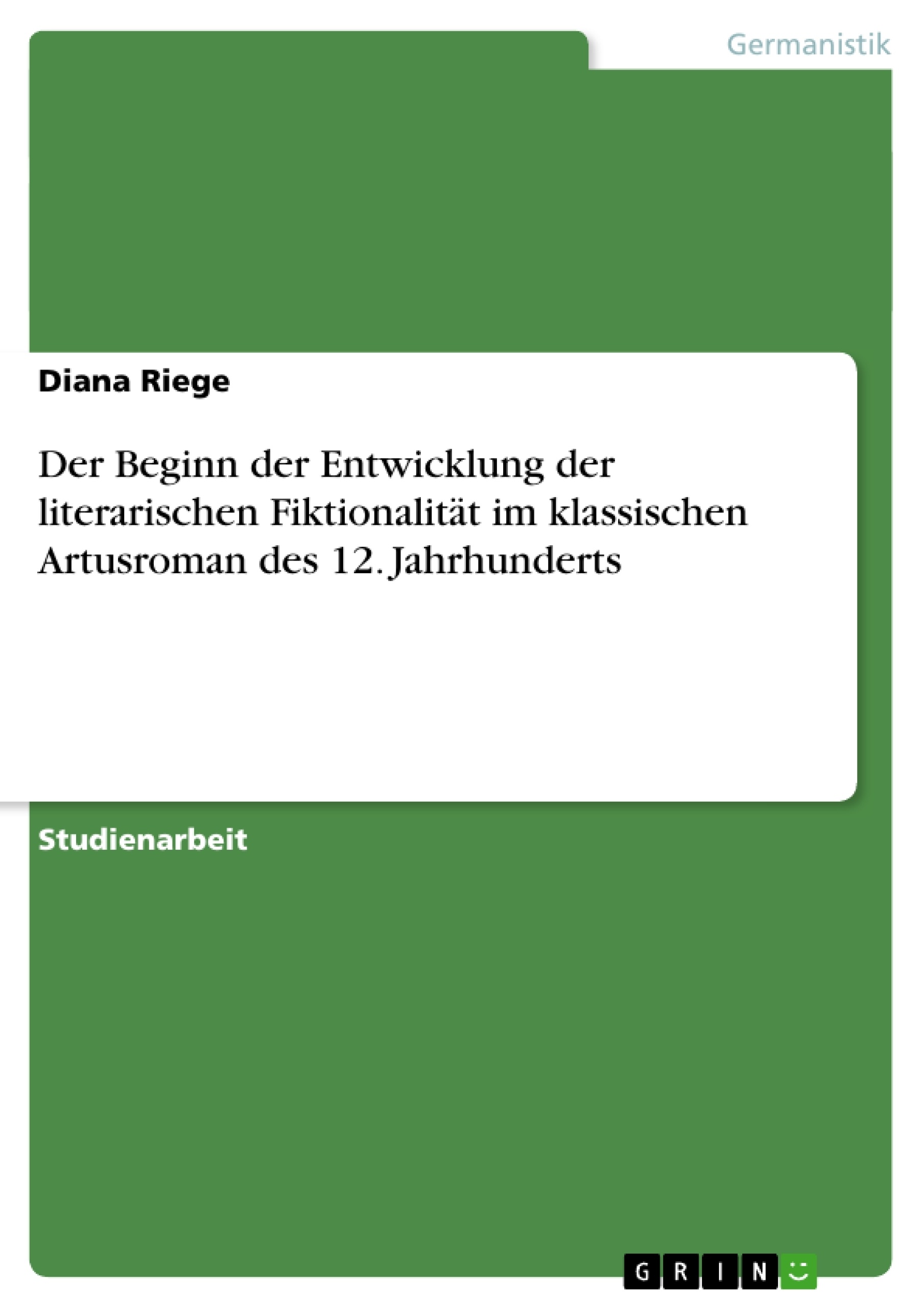Fiktionalität ist in unserem heutigen Bewusstsein fest verankert. Wir besitzen sozusagen eine Kompetenz, literarische Werke oder Filme als fiktional zu verstehen. Wird Fiktionalität nun bezüglich der Semantik des Begriffes und dessen Entstehung hinterfragt, stößt man auf eine Vielzahl von philosophischen und literaturwissenschaftlichen Arbeiten, welche versuchen, dieses durchaus nicht unproblematische Phänomen der Fiktionalität zu erhellen. Seinen etymologischen Ursprung hat der Begriff im lateinischen Verb "fingere", welches "bilden", "formen", "ersinnen" bzw. "erdichten" bedeutet, weiterhin in dem Substantiv "fictum", das mit "Erdichtung", "Trug" sowie mit "Lüge" übersetzt wird. Fiktionalität könnte somit über seinen fehlenden Wirklichkeitsbezug definiert werden, jedoch bringt eine solche Betrachtungsweise Probleme mit sich. Zunächst wird ein oppositionelles Verhältnis zwischen Fiktion und Wirklichkeit deutlich, wobei letztere über die Widerspiegelung der Realität charakterisiert wird. Die gängige Definition bestimmt diese Opposition zum Faktischen. Wenn aber das eine dem Bereich der Realität unterliegt, muss das andere irreal sein. Von dem konstruktivistischen Ansatz abgesehen, dass Realität wie sie ist nicht erfassbar für den menschlichen Geist sein kann, stellt sich dennoch die Frage, wie etwas existieren kann, das keinen Wirklichkeitsbezug hat. Daraus ergibt sich, neben dem stummen Wissen um Einigung bezüglich der kategorialen Semantik der Begriffe, dass Fiktion immer an die Wirklichkeit gebunden ist, allein schon durch ihre gedanklichen Konstrukte, die von Realem inspiriert sind, und durch Kommunikationsinstrumente wie die Sprache. Dies führt zu der Erkenntnis, dass Fiktion und Faktisches in einem sich bedingenden Mischungsverhältnis stehen und somit schwerlich in wahr oder falsch oppositionell getrennt werden können. In der Literaturwissenschaft wird die Fiktion zunächst als charakterisierendes Element oder Stilmittel literarischer Werke angesehen, dessen konstruiertes Geschehen dargestellt wird, als ob es wirklich wäre - und ist doch Erfundenes, die Wirklichkeit widerspiegelnd oder interpretierend und somit an sie gebunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturtheoretische Betrachtungen der literarischen Fiktionalität in der Antike
- Die aristotelische Poetik
- Die Integumentum-Lehre
- Der Diskurs um die Erscheinung einer neuen Form von literarischer Fiktionalität im 12. Jahrhundert
- Walter Haugs Positionen zum neuen poetologischen Konzept der Fiktionalität im mittelalterlichen Artusroman
- Gegenpositionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung der literarischen Fiktionalität im Kontext des klassischen Artusromans des 12. Jahrhunderts. Sie befasst sich mit den antiken Literaturtheorien, insbesondere mit Aristoteles' Poetik und der Integumentum-Lehre, und analysiert deren Einfluss auf das Verständnis von Fiktionalität im Mittelalter. Des Weiteren werden die Thesen von Walter Haug zur Entstehung einer neuen Form der Fiktionalität im 12. Jahrhundert beleuchtet und mit anderen Positionen zum Thema kontrastiert.
- Entwicklung der literarischen Fiktionalität im Mittelalter
- Einfluss antiker Literaturtheorien
- Walter Haugs Theorie zur Entstehung einer neuen Fiktionalität im 12. Jahrhundert
- Gegenpositionen zu Haugs Thesen
- Analyse des klassischen Artusromans im Kontext der Fiktionalität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Fiktionalität ein und beleuchtet deren Bedeutung im Kontext der Literaturwissenschaft. Sie erläutert die etymologische Herkunft des Begriffs und stellt dessen komplexe Beziehung zur Wirklichkeit dar. Die Einleitung beleuchtet außerdem die Bedeutung der antiken Literaturtheorien für das Verständnis von Fiktionalität im Mittelalter.
Das erste Kapitel befasst sich mit den literaturtheoretischen Betrachtungen der Fiktionalität in der Antike. Es untersucht die aristotelische Poetik und die Integumentum-Lehre. Die Poetik wird als ein Schlüsselwerk für die Entwicklung der Literaturtheorie vorgestellt, das die Bedeutung der Nachahmung (Mimesis) für die Dichtung hervorhebt. Die Integumentum-Lehre, die auf Cicero zurückgeht, wird als ein Konzept der verhüllenden Redeweise dargestellt, das die moralische Wahrheit in fiktiven Erzählungen verbirgt.
Schlüsselwörter
Fiktionalität, Artusroman, Mittelalter, Aristoteles, Poetik, Integumentum-Lehre, Walter Haug, Mimesis, Wirklichkeitsbezug, literarische Tradition, Gegenpositionen.
Häufig gestellte Fragen
Wann entwickelte sich die literarische Fiktionalität im Artusroman?
Die Arbeit untersucht den Beginn dieser Entwicklung im klassischen Artusroman des 12. Jahrhunderts.
Was bedeutet der Begriff „Fiktionalität“ etymologisch?
Er leitet sich vom lateinischen „fingere“ (bilden, erdichten) und „fictum“ (Erdichtung, aber auch Trug oder Lüge) ab.
Welche Rolle spielt Aristoteles in dieser Untersuchung?
Aristoteles' Poetik wird als Schlüsselwerk für die Entwicklung der Literaturtheorie und das Konzept der Mimesis (Nachahmung) herangezogen.
Was ist die „Integumentum-Lehre“?
Es ist ein Konzept der verhüllenden Redeweise, das moralische Wahrheiten in fiktiven Erzählungen verbirgt.
Welche Position vertritt Walter Haug in Bezug auf den Artusroman?
Walter Haug postuliert ein neues poetologisches Konzept der Fiktionalität im mittelalterlichen Artusroman, das in der Arbeit mit Gegenpositionen kontrastiert wird.
- Arbeit zitieren
- Diana Riege (Autor:in), 2004, Der Beginn der Entwicklung der literarischen Fiktionalität im klassischen Artusroman des 12. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44659