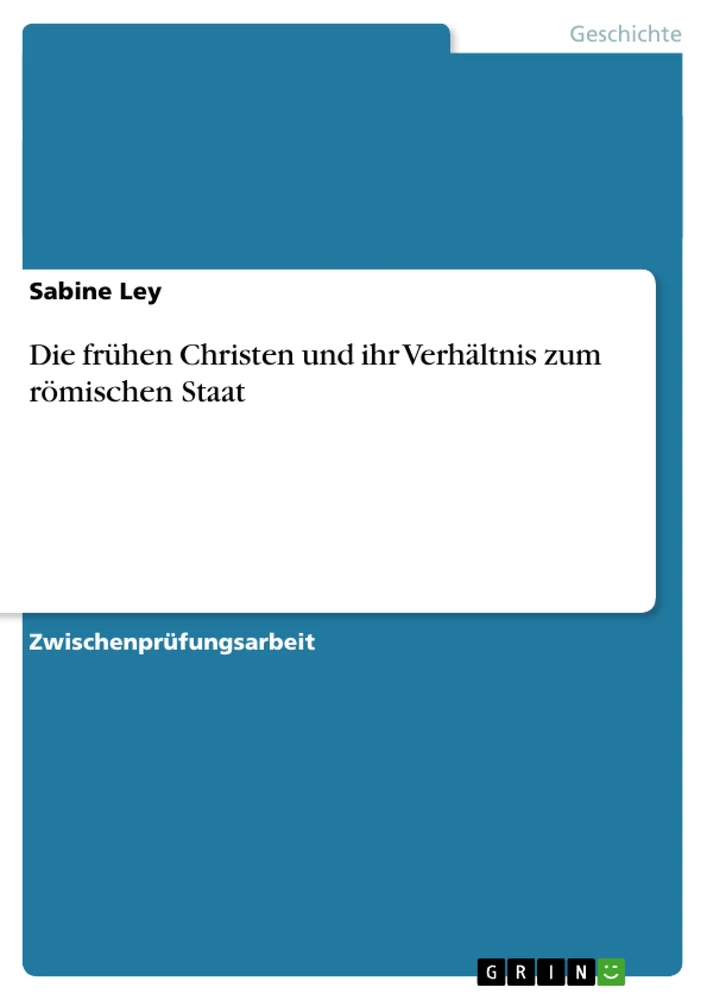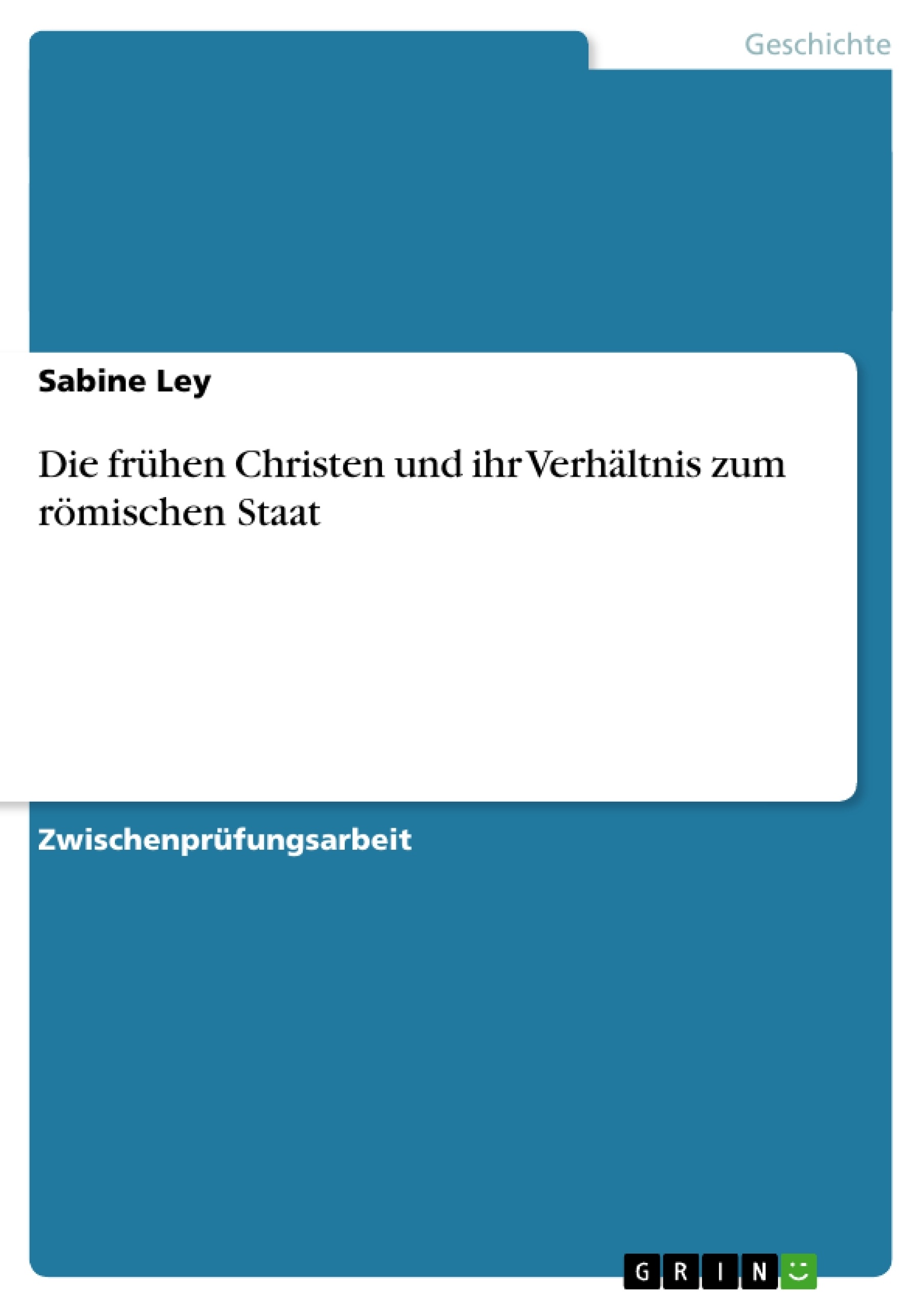Die Sonne war inzwischen hoch gestiegen; ihre Strahlen drangen blutrot durch das purpurfarbene Velarium. Der Sand schien feurig; etwas Schreckliches lag auf den Gesichtern der Menge und auf der leeren Arena, die nun bald mit dem Schmerzensgeschrei der Gemarterten und dem wilden Geheul der Bestien erfüllt werden sollte. Tod und Schrecken schienen in der Luft zu brüten. Die Menge, sonst fröhlich und ausgelassen, wurde finster und haßerfüllt. Der Präfekt winkte. Der nämliche, als Charon gekleidete Mann, der die
Gladiatoren zum Tode gerufen hatte, schritt jetzt gemessen über den Sand und schlug dreimal an die Pforte. Ein tiefes Murmeln durchflog die Sitzreihen. ’Christen!‘“
Der Roman Quo vadis, für den Heinrich Sienkiewicz 1905 den Nobelpreis erhielt, zeichnet ein düsteres, endzeitliches Portrait der Zustände im neronianischen Rom: Vor dem Hintergrund von moralischem Verfall, Dekadenz, Aberglaube und Hysterie geraten die Anhänger der neuen christlichen Religion in ein Komplott des wahnsinnigen Kaisers Nero, der sie zum Sündenbock für den Brand der Hauptstadt bestimmt, verfolgen, foltern und anschließend publikumswirksam hinrichten läßt. Über diese erste römische Verfolgung von Christen, die bis dahin relativ unscheinbar und sicher im Schatten des staatlich geduldeten und mit gewissen Privilegien ausgestatteten Judentums gelebt hatten, berichtet als erste Quelle mit einem gehörigen zeitlichen Abstand Tacitus in seinen Annales. Er vermittelt uns, abgesehen von teilweise recht fragwürdigen historischen Fakten, vor allem einen Eindruck davon, wie ein gebildeter Römer seiner Zeit die Anhänger dieser neuen Sekte sah, und mit welchem Argwohn und welchen Vorurteilen die heidnische Bevölkerung ihnen gegenüber stand. Und wenn es auch bis in das dritte nachchristliche Jahrhundert keine reichsweite Verfolgung der christlichen Religion gab, so war doch auch das Verhalten des römischen Staates gegenüber den Christen, wenn sie denn miteinander in Berührung kamen, durch Mißtrauen, Unwissen, Unverständnis oder Verachtung geprägt. Dies lag nicht zuletzt an der abgeschotteten Lebensweise der frühen Christen; fehlende Informationen sowie an ihre Stelle tretende Gerüchte machten sie vollends zu Außenseitern der Gesellschaft, auch wenn sie selber, wie u.a. ein Blick in die Briefe des Apostels Paulus zeigen wird, sich durchaus zum römischen Staat als von Gott gewollter Institution bekannten und für dessen Erhaltung beteten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!“
Das Verhältnis des frühen Christentums zum Staat aus der Sicht christlicher Autoren - „Sie sollen nach ihrer Väter Sitte leben“
Juden in Rom und im römischen Reich - „odium humani generis“
Die neronische Christenverfolgung - „superstitio immodica“ -
Der Briefwechsel zwischen Plinius dem Jüngeren und Kaiser Trajan - Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis der frühen Christen zum römischen Staat im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Ziel ist es, die Haltung der Christen gegenüber dem Staat auf der Grundlage christlicher Quellen zu beleuchten, die Rolle der römischen Behörden gegenüber den Christen zu untersuchen und die Entwicklung des Verhältnisses beider Seiten im Laufe der Zeit zu erörtern.
- Die Haltung der frühen Christen zum römischen Staat
- Die neronische Christenverfolgung als Wendepunkt im Verhältnis zwischen Christen und Staat
- Die Rolle des römischen Staates als Garant von Ordnung und Sicherheit
- Die Wahrnehmung der Christen durch die römische Gesellschaft
- Die Bedeutung des Briefwechsels zwischen Plinius dem Jüngeren und Kaiser Trajan für die spätere Entwicklung des Verhältnisses zwischen Staat und Christen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Thematik der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die Forschungslage.
- „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!“: Dieses Kapitel analysiert die Haltung der frühen Christen zum römischen Staat auf der Grundlage christlicher Quellen und zeigt die Bandbreite der Meinungen von Skepsis bis hin zu loyaler Akzeptanz des römischen Staats.
- „Sie sollen nach ihrer Väter Sitte leben“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Stellung der Juden im römischen Reich und untersucht, wie die Christen von den Römern zunächst als jüdische Sekte wahrgenommen wurden.
- „odium humani generis“: Dieses Kapitel behandelt die neronische Christenverfolgung und analysiert die Ursachen und Folgen dieses ersten staatlich organisierten Vorgehens gegen Christen.
- „superstitio immodica“: Dieses Kapitel untersucht den Briefwechsel zwischen Plinius dem Jüngeren und Kaiser Trajan und zeigt, wie der Staat mit der wachsenden Zahl von Christen umging und welche Richtlinien er im Umgang mit ihnen festlegte.
Schlüsselwörter
Frühchristentum, Römisches Reich, Staat, Religion, Verfolgung, Judentum, Plinius, Trajan, Toleranz, Christenverfolgung, Reskript, Judenedikt, Märtyrer, Apologetik.
Häufig gestellte Fragen
Wie sahen die Römer die frühen Christen?
Gebildete Römer wie Tacitus betrachteten das Christentum oft als "superstitio" (Aberglaube). Die Christen galten aufgrund ihrer abgeschotteten Lebensweise als Außenseiter und wurden mit Argwohn und Vorurteilen betrachtet.
Was geschah bei der neronischen Christenverfolgung?
Nach dem Brand Roms im Jahr 64 n. Chr. nutzte Kaiser Nero die Christen als Sündenböcke. Er ließ sie verhaften, foltern und öffentlich hinrichten, was als erste staatlich organisierte Verfolgung gilt.
Welche Haltung hatten die Christen zum römischen Staat?
Trotz Verfolgungen bekannten sich viele Christen, unter Berufung auf den Apostel Paulus ("Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist"), zum Staat als von Gott gewollte Institution und beteten für dessen Erhalt.
Was ist die Bedeutung des Briefwechsels zwischen Plinius und Trajan?
Der Briefwechsel zeigt, dass es im 2. Jahrhundert keine systematische Jagd auf Christen gab. Kaiser Trajan legte fest, dass Christen nicht aktiv gesucht werden sollten, aber bei Anzeige und Weigerung des Opfers zu bestrafen seien.
Wie unterschied sich die Stellung der Christen von der der Juden?
Das Judentum war als "religio licita" (erlaubte Religion) mit Privilegien ausgestattet. Christen wurden anfangs als jüdische Sekte geduldet, verloren diesen Schutz jedoch, als sie sich als eigenständige Gruppe erkennbar machten.
- Quote paper
- Sabine Ley (Author), 2003, Die frühen Christen und ihr Verhältnis zum römischen Staat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44661