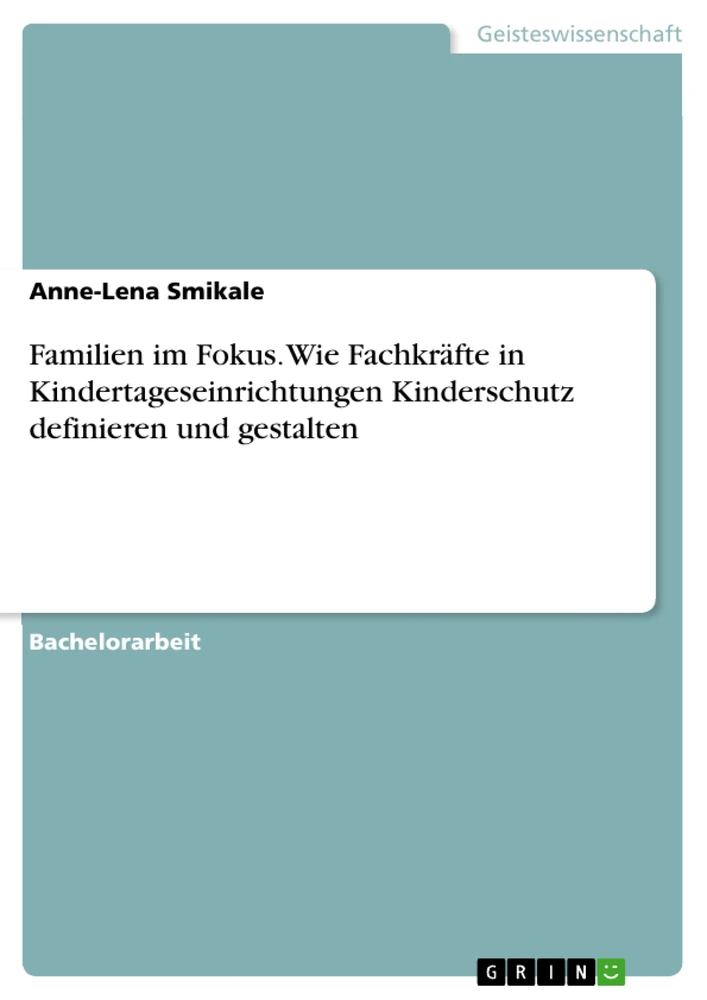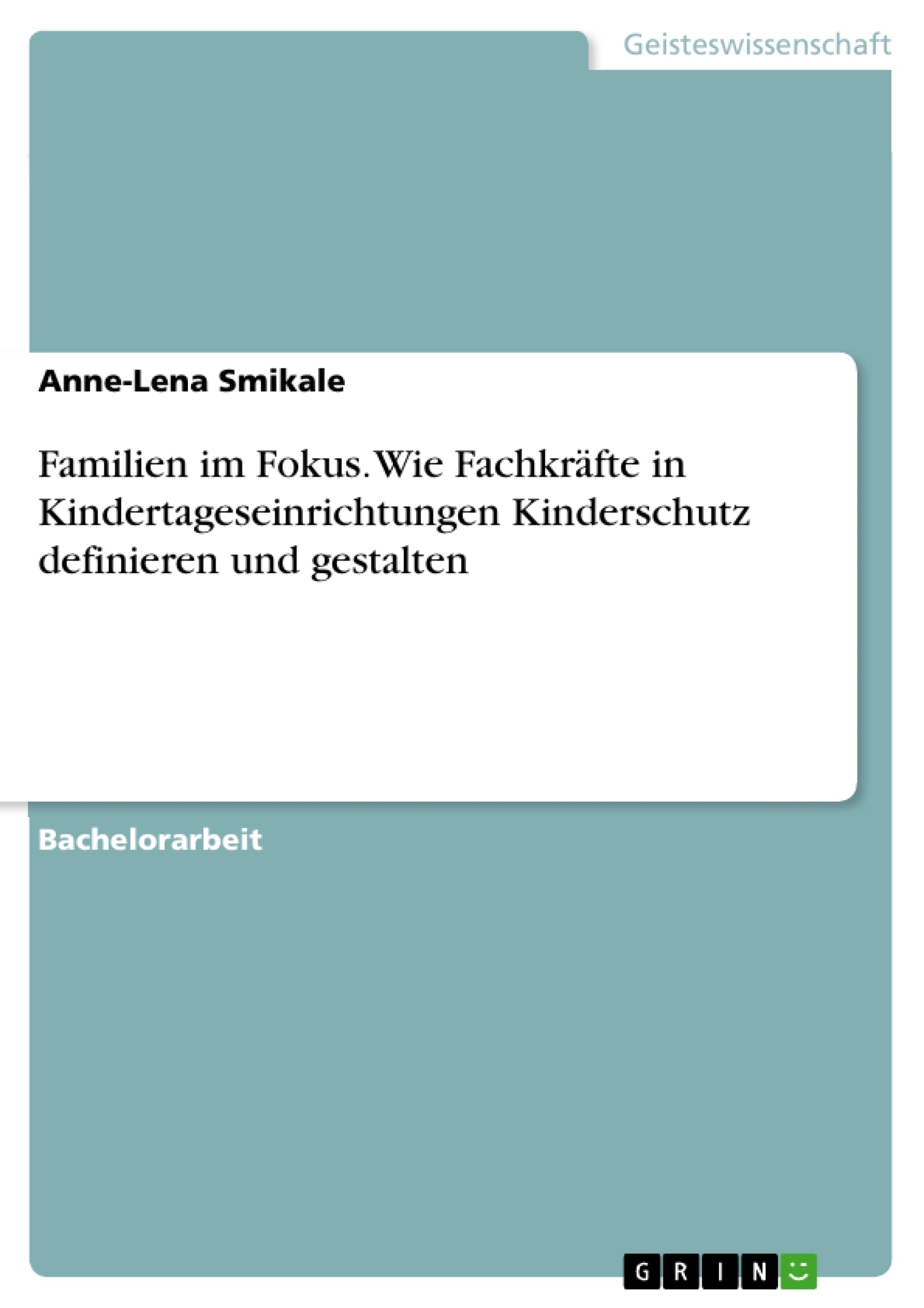Die Themen Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung stehen seit geraumer Zeit verstärkt in der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Der geäußerte Wunsch nach einem nachhaltig verbesserten Kinderschutz erklingt häufig im Zuge medialer Berichterstattung tragischer Fälle der Kindesmisshandlungen oder Vernachlässigung.
Im Tenor dieser öffentlichen Diskussion sind in den vergangenen Jahren entsprechende gesetzliche Entwicklungen zu verzeichnen. So wurde im November 2000 der für viele Fachleute längst überfällige Paragraph 1631 Abs. 2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung eingeführt, das Kindern ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung zuspricht und körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen als unzulässig deklariert. Als weitere zentrale Neuerung in der Kinderschutzdebatte gilt auch die im Jahr 2005 erfolgte Einführung des § 8a SGB VIII Abs. 4 (Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe), die den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe bei Gefährdungen des Kindeswohls konkretisiert. Der Gesetzgeber richtet seine Forderung zur Ausübung des Schutzauftrages darin an die freien Träger der Kinder -und Jugendhilfe sowie an die dazugehörigen Institutionen, zu denen unter anderem Kindertagesstätten gezählt werden können. Eine genaue Betrachtung der beruflichen Anforderungen, die dieser Schutzauftrag für die dortigen Beschäftigten mit sich bringt, soll zentraler Gegenstand dieser Arbeit sein. Unter der Frage, wie Fachkräfte in Kindertagesstätten Kinderschutz definieren und gestalten, findet zunächst eine übersichtliche Beschreibung des Arbeitsfelds „Kindertagestätten“ statt.
Dem folgt eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen und Risikofaktoren der Kindeswohlgefährdung sowie den rechtlichen Gegebenheiten, die eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Handlungsaufträge für die Fachkräfte enthält. Anschließend diskutiert die vorliegende Arbeit, wie die Fachkräfte ihre Aufgabe im Kinderschutz nach § 8a derzeit umzusetzen versuchen. Anhand professionstheoretischer Überlegungen und Ergebnisse zweier empirischer Untersuchungen sollen darüber hinaus Unstimmigkeiten, Lücken und mögliches Verbesserungspotenzial aufgezeigt werden. Zuletzt erfolgt eine Auseinandersetzung mit vorhandenen normativen Vorstellungen von Familie, welche auf das professionelle Handeln der Fachkräfte maßgeblich Einfluss nehmen, denen letztlich aber auch gesamtgesellschaftliche Bedeutung zukommt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Kindertagesstätten haben einen Schutzauftrag
- 2. Gegenstandsbeschreibung
- 2.1 Kindertagesstätten
- 2.2 Personal in Kindertagesstätten
- 2.3 Ziele und Aufgaben von Kindertagesstätten
- 2.3.1 Kinderschutz als Aufgabe von Kindertageseinrichtungen
- 3. Kindeswohl
- 3.2 Kindeswohlgefährdung
- 3.2.1 Vernachlässigung
- 3.2.2 Körperliche Misshandlung
- 3.2.3 Psychische, emotionale oder seelische Misshandlung
- 3.2.4 Sexueller Missbrauch
- 3.2.5 Risikofaktoren
- 4. Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 4.1 Elternrecht im GG Art. 6
- 4.2 Staatliches Wächteramt im GG Art. 6 Abs. 2 Satz 2
- 4.2.1 Schutzauftrag im § 8a SGB VIII
- 5. Professionalität im Kinderschutz
- 5.1 Handlungsschritte nach § 8a ABS. 4 SGB VIII
- 5.1.1 Wahrnehmen gewichtige Anhaltspunkte
- 5.1.2 Gefährdungseinschätzung vornehmen
- 5.1.3 Hinzuziehen einer insofern erfahrenen Fachkraft
- 5.1.4 Auf geeignete Hilfe hinwirken und überprüfen
- 5.2 Was Fachkräfte in Kindertagesstätten wissen und können
- 5.2.1 Kurzdarstellung einer empirischen Untersuchung
- 5.3 Zusammenfassung und Ausblicke
- 5.3.1 Normative Vorstellungen von Familie
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie Fachkräfte in Kindertagesstätten Kinderschutz definieren und gestalten. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen, die mit dem Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe verbunden sind. Darüber hinaus werden empirische Untersuchungen betrachtet, um die aktuelle Praxis im Kinderschutz zu beleuchten und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
- Der Schutzauftrag der Kindertagesstätten im Rahmen des § 8a SGB VIII
- Die verschiedenen Formen und Risikofaktoren der Kindeswohlgefährdung
- Die Handlungsschritte für Fachkräfte bei Kindeswohlgefährdung
- Empirische Ergebnisse zur Professionalität im Kinderschutz
- Der Einfluss normativer Vorstellungen von Familie auf das professionelle Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Kinderschutzes in Kindertagesstätten und die Herausforderungen, die Fachkräfte in diesem Bereich bewältigen müssen.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die Kindertagesstätten als Arbeitsfeld, das Personal in Kindertagesstätten sowie deren Ziele und Aufgaben umfassend beschrieben.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel behandelt das Thema Kindeswohl und dessen Gefährdung. Es werden verschiedene Formen der Kindeswohlgefährdung wie Vernachlässigung, Körperliche Misshandlung, Psychische Misshandlung und Sexueller Missbrauch sowie Risikofaktoren erläutert.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen im Kinderschutz. Hier werden das Elternrecht im Grundgesetz und der staatliche Schutzauftrag sowie der Schutzauftrag im SGB VIII erläutert.
- Kapitel 5: In diesem Kapitel wird die Professionalität im Kinderschutz beleuchtet. Es werden die Handlungsschritte für Fachkräfte bei Kindeswohlgefährdung beschrieben und anhand empirischer Untersuchungen die Wissensbestände und Kompetenzen von Fachkräften in Kindertagesstätten diskutiert.
Schlüsselwörter
Kinderschutz, Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, Kindertagesstätten, Fachkräfte, § 8a SGB VIII, Schutzauftrag, Empirische Forschung, Normative Vorstellungen von Familie.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt § 8a SGB VIII zum Kinderschutz?
Dieser Paragraph konkretisiert den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe und verpflichtet Fachkräfte in Kitas, bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Gefährdung eine Risikoabschätzung vorzunehmen.
Welche Formen der Kindeswohlgefährdung gibt es?
Man unterscheidet zwischen Vernachlässigung, körperlicher Misshandlung, psychischer/seelischer Misshandlung und sexuellem Missbrauch.
Was ist das „staatliche Wächteramt“?
Gemäß Art. 6 GG hat der Staat die Pflicht, über das Wohl der Kinder zu wachen, falls die Eltern ihrer Erziehungsverantwortung nicht nachkommen.
Welche Schritte müssen Kita-Fachkräfte bei Verdacht einleiten?
Sie müssen Anhaltspunkte wahrnehmen, eine Gefährdungseinschätzung im Team vornehmen, eine erfahrene Fachkraft hinzuziehen und auf Hilfen für die Familie hinwirken.
Wie beeinflussen normative Familienvorstellungen den Kinderschutz?
Vorstellungen darüber, was eine „gute Familie“ ist, können das professionelle Handeln der Fachkräfte beeinflussen und zu subjektiven Bewertungen führen.
- Citation du texte
- Anne-Lena Smikale (Auteur), 2018, Familien im Fokus. Wie Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen Kinderschutz definieren und gestalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446674