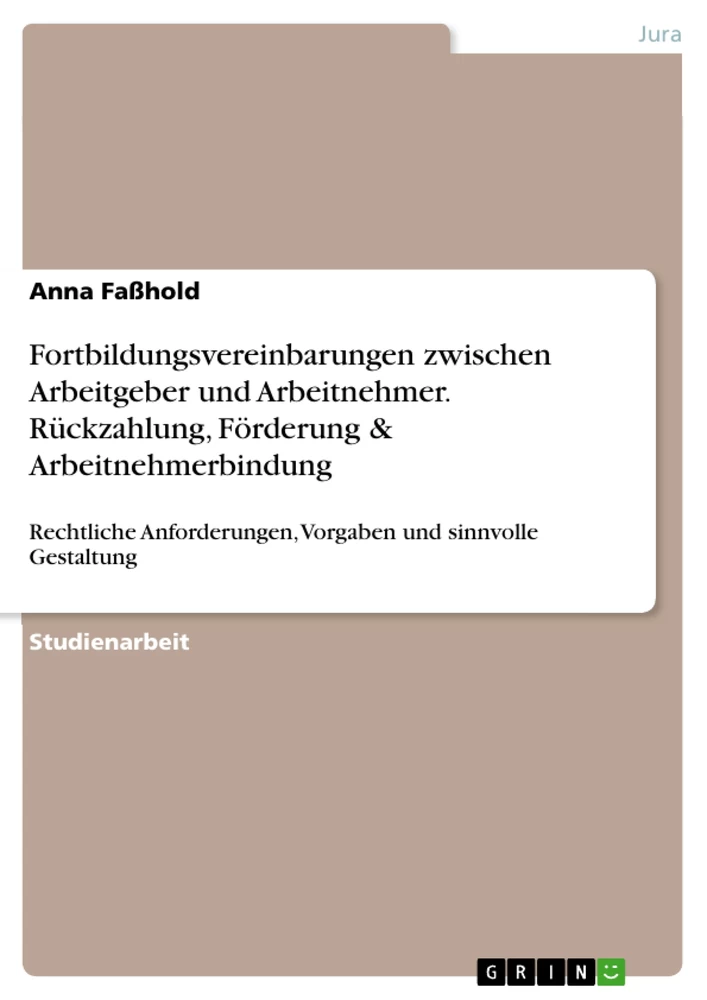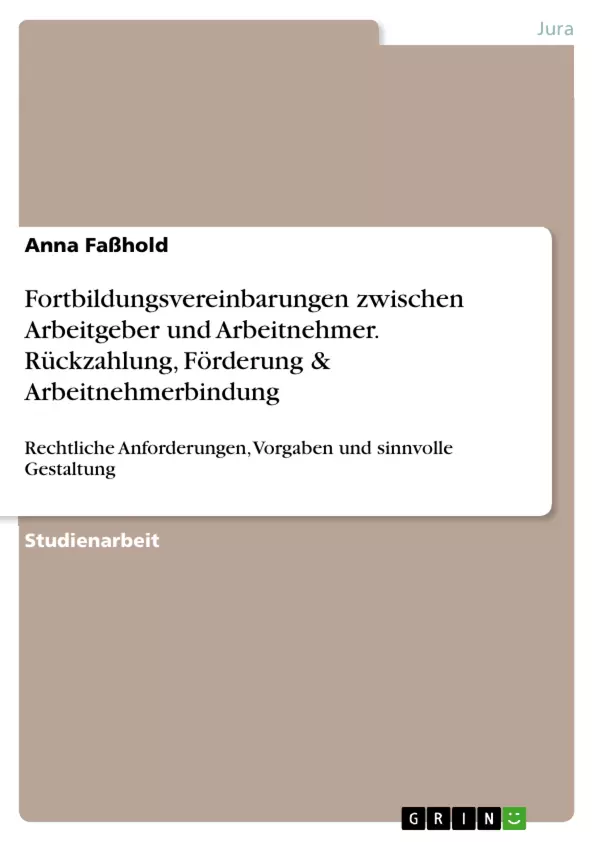In dieser Arbeit werden erforderliche Kriterien für wirksame Fortbildungsvereinbarungen dargestellt. Als Grundlage wird zunächst auf den Fortbildungsbegriff, den Anspruch auf Fortbildung und die Fortbildungsvereinbarung eingegangen. Da Bindungs- und Rückzahlungsklauseln die essentiellsten Bestandteile einer solchen Vereinbarung bilden und regelmäßig gerichtlichen Prüfungen unterzogen werden, kommt ihnen in dieser Arbeit besondere Bedeutung zu. Dazu wird ausführlich beschrieben, welcher Kriterien es bedarf, damit solche Klauseln wirksam werden. Basierend auf diesen Kriterien wird in dem Fazit eine Klausel definiert und erläutert, die einer richterlichen AGB- Kontrolle standhält.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Förderung durch Fortbildung
- Fortbildungsbegriff und Abgrenzung
- Anspruch und Verpflichtung der beruflichen Fortbildung
- Einzelvertragliche Fortbildungsvereinbarungen
- Gestaltung von Rückzahlungs- und Bindungsklauseln
- Zulässigkeit von Bindungs- und Rückzahlungsklauseln „dem Grunde nach“
- AGB-Kontrolle von Bindungs- und Rückzahlungsklauseln
- Transparenzgebot und Inhaltskontrolle
- Bindungsdauer
- Umfang der Rückzahlung
- Auslöser der Rückzahlungspflicht
- Folgen unwirksamer Rückzahlungs- und Bindungsklauseln
- Transparenzgebot und Inhaltskontrolle
- Fazit und sinnvolle Gestaltung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und der sinnvollen Gestaltung von Fortbildungsvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Insbesondere werden Rückzahlungs- und Bindungsklauseln im Fokus stehen, die dazu dienen sollen, Arbeitgeberinvestitionen in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter zu schützen und die Mitarbeiterbindung zu stärken.
- Definition und Abgrenzung des Fortbildungsbegriffs
- Ansprüche und Verpflichtungen im Zusammenhang mit beruflicher Fortbildung
- Rechtliche Anforderungen an Rückzahlungs- und Bindungsklauseln
- Transparenzgebot und Inhaltskontrolle von AGB-Klauseln
- Sinvolle Gestaltung von Fortbildungsvereinbarungen zur Wahrung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Arbeit stellt die Relevanz von Fortbildungsinvestitionen im Kontext des Arbeitsmarktes dar und beleuchtet die Problematik der Abwanderung von qualifizierten Mitarbeitern nach einer Fortbildung. Die Bedeutung von Fortbildungsvereinbarungen mit Rückzahlungs- und Bindungsklauseln zur Absicherung der Arbeitgeberinteressen und die Notwendigkeit einer rechtssicheren Gestaltung dieser Klauseln werden hervorgehoben.
- Förderung durch Fortbildung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der beruflichen Fortbildung und grenzt ihn von anderen Formen der Weiterbildung ab. Es werden die rechtlichen Ansprüche auf Fortbildung und die Bedeutung von Fortbildungsvereinbarungen im Detail erörtert.
- Gestaltung von Rückzahlungs- und Bindungsklauseln: Dieses Kapitel analysiert die Zulässigkeit von Bindungs- und Rückzahlungsklauseln in Fortbildungsvereinbarungen und unterzieht diese einer gründlichen AGB-Kontrolle. Es werden die Anforderungen an Transparenz und Inhalt von Klauseln sowie die Folgen unwirksamer Klauseln erläutert.
Schlüsselwörter
Fortbildungsvereinbarung, Rückzahlungsklausel, Bindungsklausel, AGB-Kontrolle, Transparenzgebot, Inhaltskontrolle, Arbeitnehmerbindung, Arbeitsrecht, Humankapitalinvestition, Fortbildungskosten, Wettbewerb am Arbeitsmarkt.
- Quote paper
- Anna Faßhold (Author), 2018, Fortbildungsvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Rückzahlung, Förderung & Arbeitnehmerbindung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446772