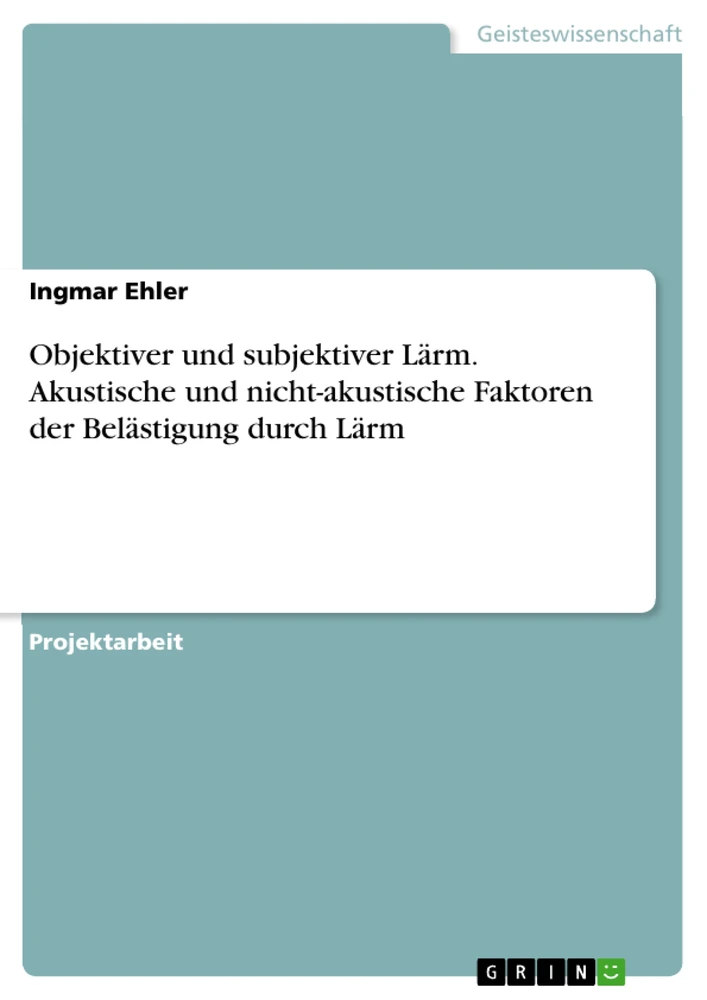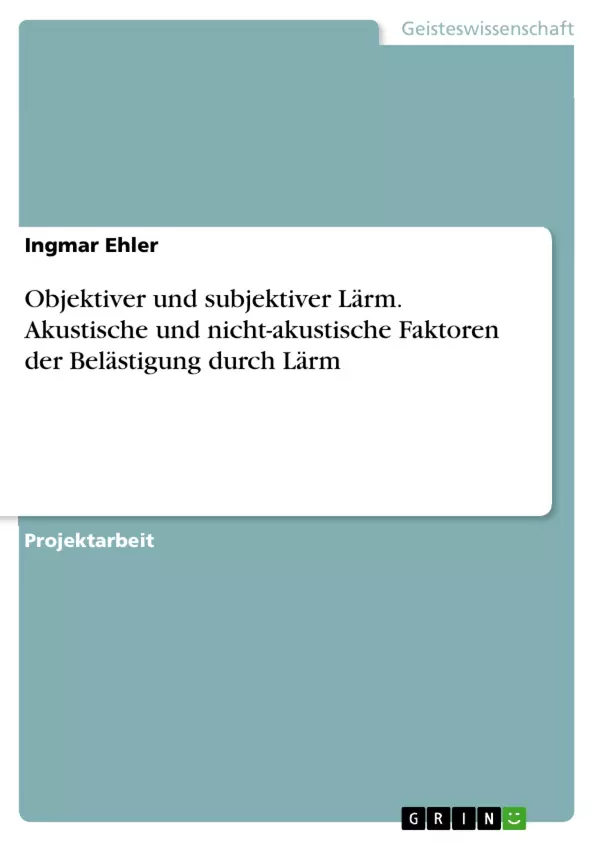Diese Arbeit erklärt die Unterschiede zwischen objektiver und subjektiver Lärmbelastung. Dazu greift sie auf bereits gängige Erklärungsansätze aus der psychologischen und epidemiologischen Lärmforschung zurück, zu denen die Ergebnisse empirischer Forschung bisher aber teils widersprüchlich und teils von fraglicher Validität sind.
Eine der untersuchten möglichen Einflussgrößen ist die Lärmempfindlichkeit, ein Konstrukt, welches gemeinhin als bedeutender Faktor für die subjektive Lärmbelastung gesehen wird, dessen gängige Messung mit der WNS-Skala allerdings kritikwürdig ist. Des Weiteren werden verschiedene Einstellungsaspekte zu Lärm, dessen Quellen und Folgen untersucht.
Die Möglichkeit der Minderung oder Verschärfung der Wahrnehmung von Umgebungslärm durch andere Umweltaspekte wird in Betracht gezogen, sowie ein Einfluss des Gerechtigkeitsempfindens und die Möglichkeit eines für die bisherige Environmental Justice-Forschung womöglich problematischen Einflusses des Sozialstatus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe und Konzeptionelles
- Theorien und Hypothesen
- Forschungsstand
- Erhebungsdesign
- Empirische Analysen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen objektiv messbarem und subjektiv wahrgenommenem Lärm. Das Ziel ist es, die akustischen und nicht-akustischen Faktoren zu identifizieren, die die Belästigung durch Lärm beeinflussen. Die Ergebnisse sollen einen Beitrag zum Verständnis der Lärmbelästigung und deren Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen leisten.
- Akustische und nicht-akustische Determinanten der Lärmbelästigung
- Die Rolle der Lärmempfindlichkeit
- Einfluss von Einstellungen zu Lärm und dessen Quellen
- Der Zusammenhang zwischen Lärm und anderen Umweltfaktoren
- Die Bedeutung von Gerechtigkeitsempfinden und Sozialstatus
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 erläutert grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit Lärm, darunter objektive Lärmbelastung und subjektive Lärmbelästigung. Die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Messung von Lärm werden diskutiert, und es werden die Herausforderungen bei der Abgrenzung zwischen objektiven und subjektiven Dimensionen von Lärm beleuchtet.
Kapitel 3 bietet einen Überblick über Theorien und Erkenntnisse aus der Lärmforschung, die sich mit den nicht-akustischen Determinanten der subjektiven Lärmbelästigung befassen. Es werden Hypothesen formuliert, die im empirischen Teil der Arbeit untersucht werden.
Kapitel 4 beleuchtet Ergebnisse aus einer älteren Metastudie und einer Auswahl neuerer Lärmbelästigungsstudien, um die eigene Analyse besser einzuordnen. Die Stärken und Schwächen dieser Studien werden analysiert.
Kapitel 5 beschreibt das Erhebungsdesign und die Datengrundlage der Arbeit.
Kapitel 6 beinhaltet den empirischen Teil der Arbeit. Die Ergebnisse von Regressionen für verschiedene Lärmquellen (Straßen-, Straßenbahn- und Fluglärm) und Tageszeiten werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Lärm, Lärmbelästigung, Lärmempfindlichkeit, Objektive Lärmbelastung, Subjektive Lärmbelastung, Akustische Determinanten, Nicht-akustische Determinanten, Umwelteinflüsse, Gerechtigkeitsempfinden, Sozialstatus, Environmental Justice.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen objektivem und subjektivem Lärm?
Objektiver Lärm ist physikalisch messbarer Schall; subjektiver Lärm ist die individuelle Wahrnehmung und Belästigung, die durch diesen Schall ausgelöst wird.
Was beeinflusst die Lärmempfindlichkeit eines Menschen?
Die Arbeit untersucht Lärmempfindlichkeit als psychologisches Konstrukt, das maßgeblich bestimmt, wie stark sich jemand durch Geräusche gestört fühlt.
Welche nicht-akustischen Faktoren spielen bei Lärmbelästigung eine Rolle?
Dazu gehören Einstellungen zur Lärmquelle, das Gerechtigkeitsempfinden, der Sozialstatus und die Wahrnehmung anderer Umweltaspekte.
Was ist die WNS-Skala?
Die WNS-Skala ist ein gängiges Instrument zur Messung der Lärmempfindlichkeit, das in der Arbeit jedoch kritisch hinterfragt wird.
Hat der Sozialstatus einen Einfluss auf die Lärmwahrnehmung?
Die Arbeit diskutiert im Rahmen der Environmental Justice-Forschung, ob und wie der soziale Status die Belastung durch Umgebungslärm verschärft oder mindert.
Welche Lärmquellen wurden empirisch untersucht?
Die empirischen Analysen beziehen sich auf Straßenlärm, Straßenbahnlärm und Fluglärm zu verschiedenen Tageszeiten.
- Quote paper
- Ingmar Ehler (Author), 2018, Objektiver und subjektiver Lärm. Akustische und nicht-akustische Faktoren der Belästigung durch Lärm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/447301