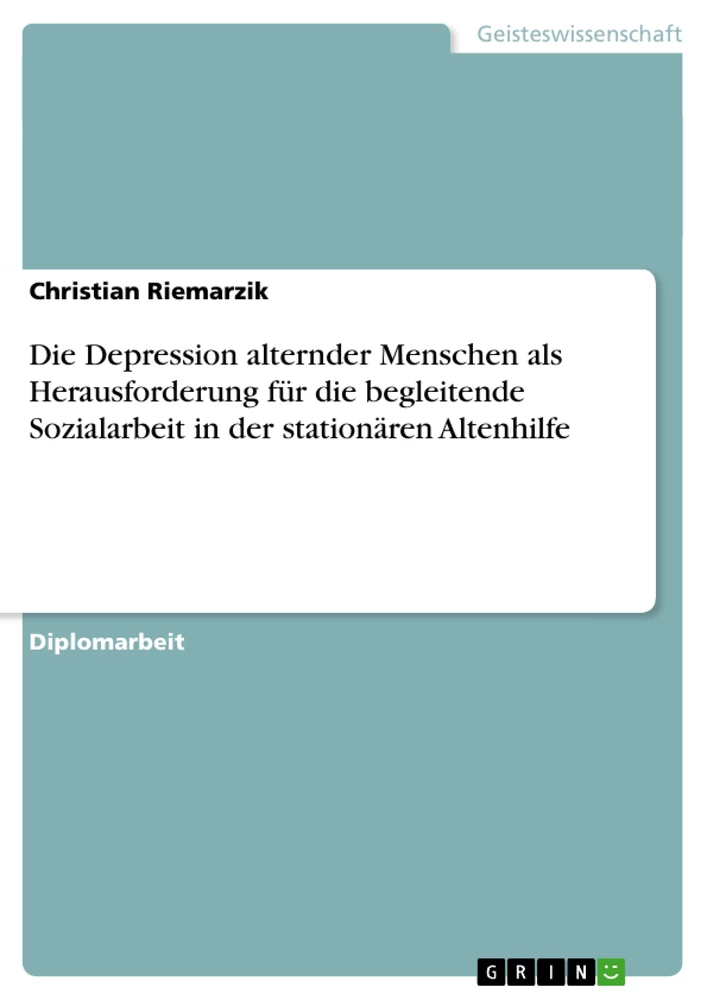Mit der Industrialisierung und ihren langsam aufkeimenden technischen und medizinischen Möglichkeiten begann auch der gesellschaftlich flächenübergreifende Drang, Mittel und Wege zu erforschen dem Alter in seinem Verlauf Einhalt zu gebieten. Jedoch ist der Traum der ´ewigen Jugend´ kaum ein neuzeitliches Phänomen. Menschen aller Zeitalter philosophierten und befassten sich mit der Frage nach lebensverlängernden Möglichkeiten. In seiner steigenden Qualität und immer stärker werdenden und breit streuenden Intensität ist dieses Phänomen jedoch zunehmend als moderne Erscheinung zu betrachten. Alleine der Blick auf mediale Werbeinhalte und expandierender ´verjüngender´ Pharmakologie und Kosmetik zeigt zumindest den aktuellen Trend.
Kein Wunder, dass somit der Facettenreichtum des Alterns lange Zeit nur aus dem Bereich der medizinischen und pharmakologischen Forschung betrachtet wurde mit dem Ziel, den Vollbesitz der Kräfte möglichst lange erhalten zu können, Krankheit in ihre Schranken zu weisen, bis hin zur Suche nach Möglichkeiten einer erfolgreichen Verjüngung. Die professionelle Erforschung des Prozesses von Altern auf dem ebenso elementaren sozialen Bereich genießt dagegen erst wenige Jahrzehnte.
Spricht man heute von ´Altern´ und ´älteren Menschen´, so wird in der Regel der zeitliche Abschnitt nach dem Durchschreiten des 60. bis 65. Lebensjahres darunter verstanden. Dies bringt meist die Vorstellung mit sich, ältere Menschen als einheitliche Gruppe zu betrachten. Jedoch sollte auch hier bedacht werden, dass die unterschiedlich zu bewältigenden Aufgabenstellungen des späteren Lebensalters durchaus differieren. Steht beispielsweise im ersten Jahrzehnt nach dem konventionellen Berufsausstieg vielmehr die individuelle Problematik des ´ungewohnten Nichtstun´, der Neugestaltung der finanziellen Grundlage und der allgemeinen Umorientierung der bisherigen Lebensart etc. im Vordergrund so kristallisiert sich in Folgejahren eher eine Problemgestaltung durch Vereinsamung, Multimorbidität und Pflegeabhängigkeit heraus. Vor allem bei ätiologischen Betrachtungen depressiver Erscheinungsformen im Alter muss somit dem individuellen Status des alternden Menschen Beachtung entgegengebracht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Depression im späten Alter – Einführung in die Thematik
- 2.1 Definitionskriterien nach ICD-10
- 2.1.1 Unipolare Verläufe
- 2.1.1.1 Unipolare Manien und manische Episode
- 2.1.1.2 Depressive Episode
- 2.1.1.3 Dysthymie
- 2.1.2 Bipolare Verläufe
- 2.1.2.1 Zyklothymien
- 2.1.3 Nicht näher bezeichnete affektive Störungen
- 2.2 Epidemiologische Betrachtung
- 2.3 Ätiologie der Depression im späteren Alter
- 2.3.1 Physiologischer Ursachenkomplex
- 2.3.1.1 Genetik
- 2.3.1.2 Neurobiologische Dynamik und Mechanismen
- 2.3.1.3 Altersspezifische Erkrankungen und Komorbidität
- 2.3.2 Psychologischer Ursachenkomplex
- 2.3.2.1 Biographie
- 2.3.2.2 Psychosoziale Faktoren und sozial-ökonomischer Ursachenkomplex
- 2.3.3 Persönlichkeitsmerkmale und Selbstbild
- 2.3.4 Zusammenspiel der vorgestellten ätiologischen Bereiche
- 2.4 Nähere Betrachtung der altersrelevanten syndromalen Erscheinungsformen von Depression
- 2.4.1 Organische Depression
- 2.4.2 Mittlere und schwere depressive Episode mit und ohne somatischen oder psychotischen Symptomen (ehemals endogene Depression)
- 2.4.3 Dysthymie (ehemals neurotische Depression)
- 2.4.4 Reaktive/ psychogene Depression
- 2.4.5 Übersicht der analogen Merkmale depressiver Störungsformen
- 2.4.6 Qualität der Depression alternder Menschen
- 2.5 Differentialdiagnostik bei altersspezifischen Depressionen
- 2.5.1 Depression und Demenz
- 2.5.2 Depression und Trauer
- 2.6 Therapie
- 2.6.1 Psychotherapeutische Aspekte im Hinblick auf kognitiv-verhaltenstherapeutische Intervention
- 2.6.2 Medikamentöse Therapie
- 3. Suizidalität und Sterberate
- 3.1 Motive und Qualität von suizidalem Verhalten im späteren Alter
- 3.2 Präventions- und Interventionsaspekte
- 3.3 Statistische Daten und Epidemiologie
- 4. Handlungsformen des sozialen Dienstes in der Vermeidung und Behandlung von Depressionen alternder Menschen in der stationären Altenhilfe
- 4.1 Belastungsmomente in stationären Einrichtungen
- 4.2 Psychosoziale Begleitung
- 4.2.1 Die Gewinnung Ehrenamtlicher als Prävention und Intervention
- 4.2.2 Angehörigenarbeit
- 4.3 Motivations- und Milieuarbeit
- 4.3.1 Biographisches Arbeiten
- 4.3.2 Tiere in Heimen
- 4.3.3 Einzel- und Gruppenaktivitäten, Gestaltung der Heimatmosphäre
- 5. Schlussgedanken zum Auftrag der begleitenden Sozialarbeit bei depressiven alten Menschen in stationärer Lebensart
- Definition und epidemiologische Aspekte der Depression im Alter
- Ätiologie der Depression im späteren Lebensalter (physiologische, psychologische und soziale Faktoren)
- Syndromale Erscheinungsformen und Differentialdiagnostik
- Therapieoptionen (psychotherapeutische und medikamentöse Interventionen)
- Suizidalität und Sterberate bei älteren Menschen mit Depressionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Depression alternder Menschen und deren Auswirkungen auf die begleitende Sozialarbeit in der stationären Altenhilfe. Sie analysiert die Ursachen, Erscheinungsformen und die Bedeutung der Depression im späteren Lebensalter und beleuchtet die Rolle der Sozialarbeit in der Prävention und Behandlung dieser Erkrankung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den gesellschaftlichen Kontext des Alterns und die Bedeutung der Depression im späteren Lebensalter beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden Definitionen und epidemiologische Aspekte der Depression im Alter, sowie die Ursachen der Erkrankung aus physiologischer, psychologischer und sozialer Perspektive behandelt. Das dritte Kapitel widmet sich der Suizidalität und der Sterberate bei älteren Menschen mit Depressionen. Das vierte Kapitel beleuchtet die Rolle der Sozialarbeit in der Vermeidung und Behandlung von Depressionen im stationären Setting, einschließlich der Belastungsmomente in stationären Einrichtungen, der psychosozialen Begleitung und der Motivations- und Milieuarbeit.
Schlüsselwörter
Depression im Alter, stationäre Altenhilfe, begleitende Sozialarbeit, Ätiologie, Syndromale Erscheinungsformen, Differentialdiagnostik, Therapie, Suizidalität, Sterberate, Prävention, Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Wie äußert sich eine Depression im späten Alter?
Altersdepressionen können sich durch gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, aber auch durch körperliche Beschwerden (somatische Symptome) äußern. Sie werden oft fälschlicherweise als normale Alterserscheinung missverstanden.
Was sind die Ursachen für Depressionen bei Senioren?
Die Ätiologie ist komplex und umfasst genetische Faktoren, neurobiologische Veränderungen, chronische Krankheiten (Multimorbidität) sowie psychosoziale Faktoren wie Vereinsamung und den Verlust von Rollenbildern.
Wie unterscheidet man Depression von Demenz?
Die Differentialdiagnostik ist entscheidend, da depressive Symptome einer Demenz ähneln können („Pseudodemenz“). Eine genaue Untersuchung ist nötig, um die richtige Therapie einzuleiten.
Welche Rolle spielt die Sozialarbeit in der stationären Altenhilfe?
Sozialarbeiter leisten psychosoziale Begleitung, biographisches Arbeiten und Motivationsarbeit, um Belastungsmomente im Heim zu reduzieren und die Lebensqualität depressiver Bewohner zu steigern.
Warum ist die Suizidalität im Alter ein wichtiges Thema?
Ältere Menschen haben statistisch gesehen eine höhere Suizidrate. Prävention und Intervention durch geschulte Fachkräfte sind daher essenziell, um suizidales Verhalten frühzeitig zu erkennen.
- Quote paper
- Christian Riemarzik (Author), 2005, Die Depression alternder Menschen als Herausforderung für die begleitende Sozialarbeit in der stationären Altenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44731