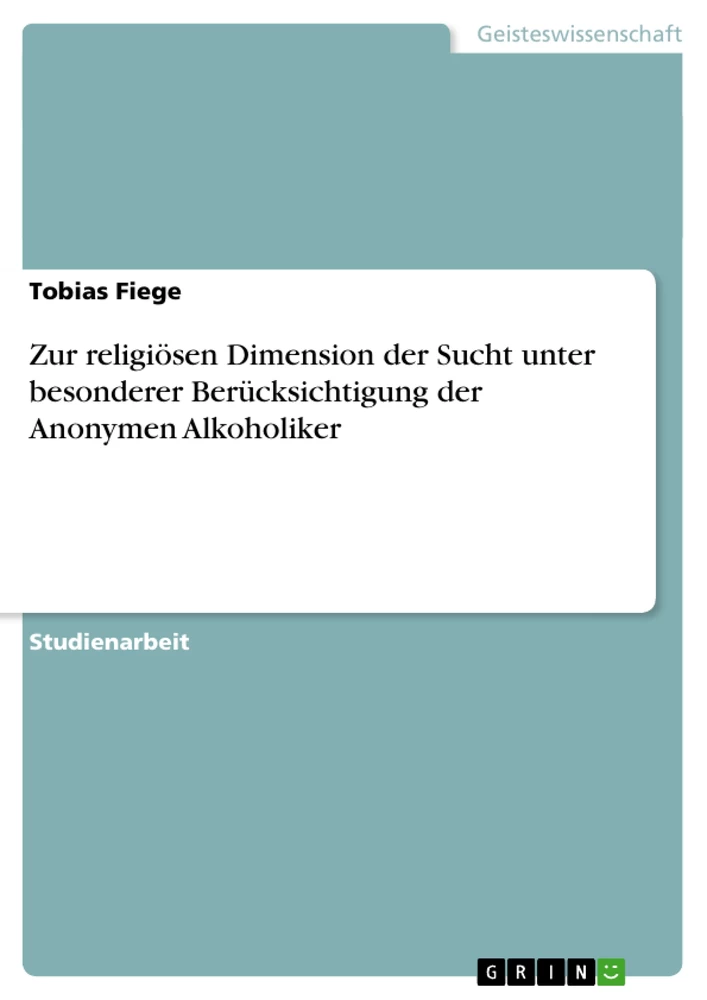Die undurchsichtige Etymologie des Wortes Sucht wurde im nhd. zum einen mit krankhaftem Verlangen zum anderen mit `suchen´ verknüpft. Worauf sich diese Suche konkret bezieht ist zunächst nicht einfach zu benennen, da grundsätzlich alles nicht Vorhandene gesucht werden kann. Im Hinblick auf die Zeit ist die Suche eine in die Vergangenheit oder in die Zukunft gerichtete Bewegung. Etwas Verlorenes oder etwas Antizipiertes können ihr Gegenstand sein. Ferner verweist der momentane Zustand des Suchenden auf eine Disharmonie, denn nur aus dieser speist sich der Impuls zur Suche.
C. G. Jung schrieb einmal in einem Brief an Mr. Wilson, einem der Mitbegründer der Anonymen Alkoholiker (AA), über einen seiner alkoholkranken Patienten: „Seine Sucht nach Alkohol entspricht auf einer niedrigen Stufe dem geistigen Durst des Menschen nach Ganzheit, in mittelalterlicher Sprache: nach der Vereinigung mit Gott.“
Es scheint sich demnach bei der materiellen Thematik der Sucht symbolisch um etwas Seelisches zu handeln, das mit dem Suchtmittel zu erreichen versucht wird, aber, das ständig sich fortsetzende Verlangen in der Sucht zeigt es an, keine Befriedigung erfährt. Jungs theologische Anregung ist zum konstitutiven Element z. B. der Anonymen Alkoholiker geworden, bildet aber eine Voraussetzung, die alle Erkenntnis auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis hin übersteigt und somit inkommensurabel einem Wissenschaftsideal, welches auf der prinzipiellen Forderung nach Überprüfbarkeit von Aussagen und Methoden durch jeden gründet , gegenübersteht.
Die bisherige Alkoholismusforschung konnte sodann keine signifikante Persönlichkeitsstruktur entdecken, die zur Alkoholkrankheit disponiert. Demnach unterscheidet sich der Alkoholkranke von den übrigen Gesellschaftsmitgliedern lediglich in seinem Verhältnis zum Alkohol. Entgegen diesem Ergebnis soll meine Hypothese lauten, dass es sich gerade so nicht verhält, sondern sehr wohl eine so genannte prämorbide Persönlichkeit existiert und zwar zu jeglichen Formen von Suchtstrukturen, aus der die Alkoholkrankheit natürlich nur einen Ausschnitt bildet. Prämorbid möchte ich hier vorweg übersetzen als eine Form von Verzweiflung, die auf einer Fehlverarbeitung von Daseinsangst beruht. Diese Vermutung werde ich im Verlauf der Arbeit zu untermauern versuchen und insbesondere von den Selbstzeugnissen der AA her entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Persönlichkeit des Süchtigen
- 1.1 Der Begriff der Krankheit
- 2. Der Mangel in der Philosophie J. P. Sartres
- 2.1 Analogien zum Charakterbild des Süchtigen
- 3. Die Überwindung der Sucht oder die religiöse Perspektive
- 3.1 Der Weg der Anonymen Alkoholiker
- 3.2 „Die Krankheit zum Tode“
- 4. Schluss
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die anthropologischen Aspekte der Sucht, insbesondere die religiöse Dimension, am Beispiel der Anonymen Alkoholiker (AA). Sie hinterfragt die gängige Vorstellung von Sucht als rein medizinisches Problem und beleuchtet die existentiellen und psychologischen Ursachen. Die Arbeit basiert auf der Hypothese, dass Sucht auf einer prämorbiden Persönlichkeit beruht, die durch eine Fehlverarbeitung von Daseinsangst gekennzeichnet ist.
- Die Persönlichkeit des Süchtigen und deren Charakteristika
- Die philosophische Betrachtung des Mangels bei Sartre im Kontext von Sucht
- Der religiöse Aspekt von Sucht und die Rolle der AA in der Überwindung
- Das Konzept der Sucht als "Krankheit zum Tode"
- Die Grenzen des medizinischen Modells bei der Erklärung von Sucht
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung erörtert die mehrdeutige Bedeutung des Wortes „Sucht“ und verbindet es mit krankhaftem Verlangen und dem Akt des Suchens. Sie führt ein Zitat von C.G. Jung ein, das die Sucht nach Alkohol mit dem geistigen Durst nach Ganzheit gleichsetzt. Die Einleitung stellt die zentrale These auf, dass eine prämorbide Persönlichkeit, gekennzeichnet durch eine Fehlverarbeitung von Daseinsangst, der Sucht zugrunde liegt. Dieser Punkt wird im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht, wobei der Fokus auf den seelischen Aspekt der Sucht gelegt wird, während somatische und soziale Aspekte weitgehend ausgeblendet werden.
1. Die Persönlichkeit des Süchtigen: Dieses Kapitel beschreibt charakteristische Persönlichkeitsmerkmale von Alkoholikern anhand einer Studie über die AA. Es werden Merkmale wie überhöhte Erwartungen an sich selbst, Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten, Konkurrenzverhalten, Neid und innere Einsamkeit hervorgehoben. Diese Persönlichkeitszüge werden im Zusammenhang mit Frustrationen, Schuldgefühlen und dem Rückzug in die Sucht als Fluchtmechanismus dargestellt. Die Autoren der Studie argumentieren, dass sich dieses Persönlichkeitsbild (außer dem Alkoholkonsum) nicht signifikant von Nicht-Alkoholikern unterscheidet, eine These, die der Autor der Arbeit kritisch hinterfragt.
1.1 Der Begriff der Krankheit: Dieses Kapitel analysiert die Sichtweise der AA auf die Alkoholkrankheit. Die AA betrachten die Sucht oft als übernatürliches Phänomen, um moralische Verurteilungen zu vermeiden. Dieser Ansatz wird als gnostisches Prinzip beschrieben, welches psychische und physische Realitäten metaphysisch interpretiert und die Konfrontation mit inneren Antinomien vermeidet. Der Autor vergleicht dies mit Dostojewskis Darstellung der Spielsucht, wobei die Sucht als eine Art Schicksalsbestimmung gesehen wird, die mit der Hoffnung auf eine Art Erlösung oder Auferstehung verbunden ist.
Schlüsselwörter
Sucht, Anonyme Alkoholiker (AA), religiöse Dimension, existentielle Angst, Daseinsangst, prämorbide Persönlichkeit, Alkoholismus, Philosophie Sartre, Krankheitsverständnis, Selbstheilung, Psychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anthropologische Aspekte der Sucht
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die anthropologischen Aspekte der Sucht, insbesondere die religiöse Dimension, am Beispiel der Anonymen Alkoholiker (AA). Sie hinterfragt die gängige Vorstellung von Sucht als rein medizinisches Problem und beleuchtet die existentiellen und psychologischen Ursachen. Ein zentraler Punkt ist die Hypothese, dass Sucht auf einer prämorbiden Persönlichkeit beruht, die durch eine Fehlverarbeitung von Daseinsangst gekennzeichnet ist.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Persönlichkeit des Süchtigen und deren Charakteristika, die philosophische Betrachtung des Mangels bei Sartre im Kontext von Sucht, den religiösen Aspekt von Sucht und die Rolle der AA in der Überwindung, das Konzept der Sucht als "Krankheit zum Tode" und die Grenzen des medizinischen Modells bei der Erklärung von Sucht.
Wie wird die Persönlichkeit des Süchtigen beschrieben?
Das Kapitel über die Persönlichkeit des Süchtigen beschreibt charakteristische Merkmale anhand einer Studie über die AA. Es werden unter anderem überhöhte Erwartungen an sich selbst, Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten, Konkurrenzverhalten, Neid und innere Einsamkeit hervorgehoben. Diese Persönlichkeitszüge werden im Zusammenhang mit Frustrationen, Schuldgefühlen und dem Rückzug in die Sucht als Fluchtmechanismus dargestellt. Die These, dass sich dieses Persönlichkeitsbild (außer dem Alkoholkonsum) nicht signifikant von Nicht-Alkoholikern unterscheidet, wird kritisch hinterfragt.
Welche Rolle spielt die Philosophie Sartres?
Die Arbeit bezieht sich auf den Mangel in der Philosophie J. P. Sartres und zieht Analogien zum Charakterbild des Süchtigen. Es wird untersucht, wie Sartres philosophische Konzepte die existentiellen Ursachen der Sucht beleuchten können.
Welche Rolle spielt die religiöse Perspektive?
Die religiöse Dimension der Sucht wird anhand des Beispiels der Anonymen Alkoholiker (AA) untersucht. Die Sichtweise der AA auf die Alkoholkrankheit wird analysiert, wobei ihr Ansatz als gnostisches Prinzip beschrieben wird, das psychische und physische Realitäten metaphysisch interpretiert. Der Vergleich mit Dostojewskis Darstellung der Spielsucht wird gezogen, wobei die Sucht als Schicksalsbestimmung mit der Hoffnung auf Erlösung oder Auferstehung gesehen wird.
Wie wird der Begriff "Krankheit" im Kontext der Sucht betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Sichtweise der AA auf die Alkoholkrankheit, die diese oft als übernatürliches Phänomen betrachten, um moralische Verurteilungen zu vermeiden. Der Autor vergleicht dies mit Dostojewskis Darstellung der Spielsucht, wobei die Sucht als eine Art Schicksalsbestimmung gesehen wird, die mit der Hoffnung auf eine Art Erlösung oder Auferstehung verbunden ist. Die Arbeit hinterfragt auch die Grenzen des rein medizinischen Modells bei der Erklärung von Sucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sucht, Anonyme Alkoholiker (AA), religiöse Dimension, existentielle Angst, Daseinsangst, prämorbide Persönlichkeit, Alkoholismus, Philosophie Sartre, Krankheitsverständnis, Selbstheilung, Psychologie.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel über die Persönlichkeit des Süchtigen (inkl. Unterkapitel zum Begriff der Krankheit), den Mangel in der Philosophie Sartres, die Überwindung der Sucht aus religiöser Perspektive (inkl. Unterkapitel zum Weg der Anonymen Alkoholiker und "Die Krankheit zum Tode"), einen Schluss und ein Literaturverzeichnis.
- Citar trabajo
- Tobias Fiege (Autor), 2004, Zur religiösen Dimension der Sucht unter besonderer Berücksichtigung der Anonymen Alkoholiker, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44807