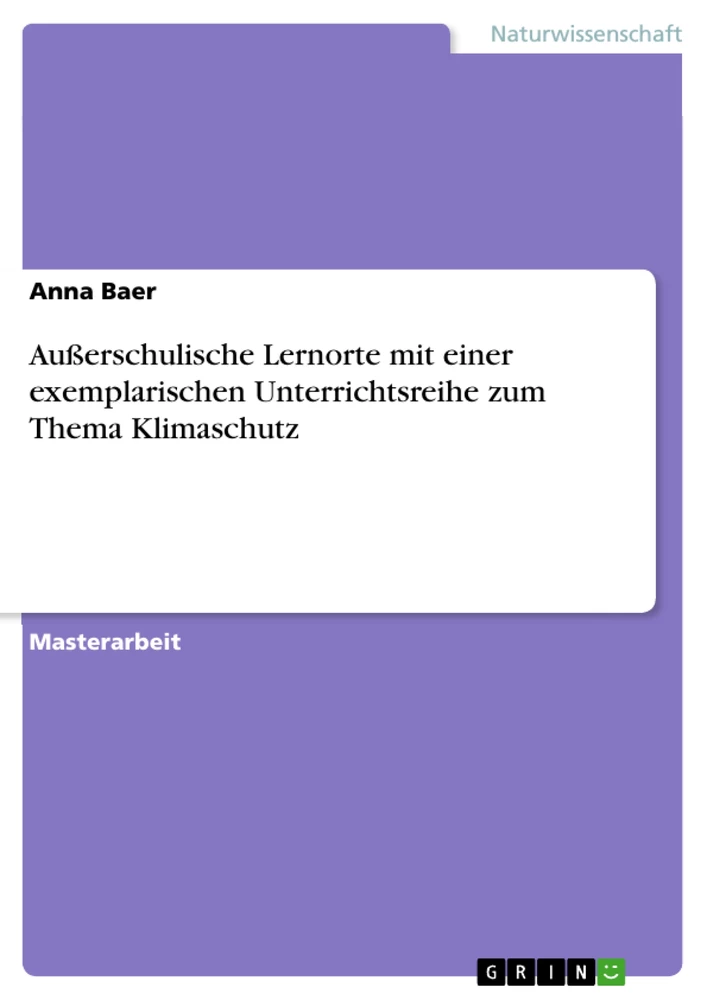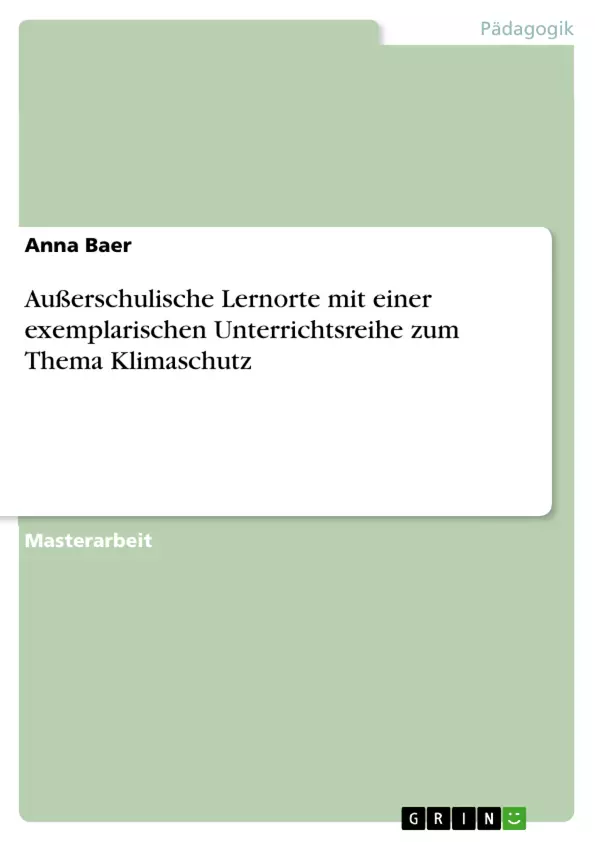Diese Masterarbeit befasst sich mit der Thematik des außerschulischen Lernens. Die Arbeit ist inhaltlich in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil schafft eine theoretische Grundlage. Es wird in die Thematik der außerschulischen Lernorte und des außerschulischen Lernens eingeführt und es werden außerschulische Lernorte klassifiziert. Außerdem wird das Verhältnis von schulischem und außerschulischem Lernen beleuchtet und damit über eine mögliche Integration außerschulischen Lernens in den Unterricht nachgedacht. Im zweiten Teil wird eine Unterrichtsreihe zum Thema Klimaschutz vorgestellt, in der es thematisch um das Klima und den zur Zeit in der öffentlichen Diskussion stehenden Klimawandel geht. In diese Reihe wurden außerschulische Elemente integriert. Die Reihe stellt ein exemplarisches Beispiel für die Integration von außerschulischem Lernen in den Unterricht dar, indem gezeigt wird, wie die vorangestellte Theorie mit der Praxis verzahnt werden kann.
Die Masterarbeit soll dem derzeitig seltenen Aufsuchen von außerschulischen Lernorten entgegenwirken und zeigen, dass der Besuch außerschulischer Lernorte, trotz Mehrarbeit für die Lehrkraft, die Mühe wert ist und in der Schule in verschiedenen Kontexten Anwendung finden kann. Sie richtet sich damit an alle Interessierten der außerschulischen Lernorte, die sich mit dem Thema im Rahmen des Studiums, des Referendariats oder auch innerhalb einer Lehrerfortbildung beschäftigen, aber auch an Kritiker von außerschulischen Lernorten, die in diesen vielleicht nur verschwendete Zeit innerhalb unserer heutigen Leistungsgesellschaft sehen und es bevorzugen, die Lernenden kognitiv in den Schonraum des Klassenzimmers zu fordern. Der Schule soll mit dieser Arbeit keinesfalls ihre wichtige Funktion für den Bildungserwerb der Heranwachsenden abgesprochen werden. Dennoch soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Schule in der heutigen Zeit nicht mehr "als einziger und umfassend koordinierter Lernort fungieren kann". Auch Kritiker des außerschulischen Lernens sollen mit der Arbeit adressiert werden, die volle Lehrpläne und andere Hindernisse in den Vordergrund stellen und keine Zeit für "Spazierengehen" haben.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Außerschulisches Lernen
- 2.1 Definition
- 2.2 Allgemeine Charakteristika
- 2.2.1 Selbsttätigkeit
- 2.2.2 Verfolgung sozialer und methodischer Ziele
- 2.2.3 Situiertes Lernen
- 2.2.4 Entdeckendes Lernen
- 2.2.5 Unmittelbarer Umgang und handlungsorientierter Unterricht
- 2.2.6 Veranschaulichendes Lernen
- 2.2.7 Primärerfahrungen
- 2.2.8 Realitätsbezug und Lebensnähe
- 2.2.9 Fächerverbindung
- 2.2.10 Informelles Lernen
- 2.3 Die Rolle der Lehrkraft
- 2.4 Geschichte des außerschulischen Lernens
- 2.5 Vor- und Nachteile
- 2.5.1 Didaktischer und methodischer Mehraufwand für die Lehrkraft
- 2.5.2 Aspekte, die den Besuch außerschulischer Lernorte erschweren
- 2.5.3 Einbezug außerschulischer Experten
- 2.5.4 Lebenswelt und -interessen
- 2.5.5 Empirische Erhebungen zur Lerneffektivität außerschulischer Lernorte
- 2.6 Rechtliche Vorgaben
- 3. Außerschulische Lernorte
- 3.1 Klassifikation
- 3.2 Qualitätskriterien
- 4. Schulisches und außerschulisches Lernen
- 4.1 Verhältnis von Schulunterricht und außerschulischem Lernen
- 4.2 Integration außerschulischen Lernens in den Unterricht
- 4.2.1 Der methodische Dreischritt des außerschulischen Lernens
- 4.2.2 Mögliche Integrationsstellen in einer Unterrichtseinheit
- 4.2.3 Häufigkeit und Struktur der Besuche außerschulischer Lernorte
- 4.3 Rückbindung an Lernaktivitäten innerhalb der Schule - Problemfelde
- 4.4 Methoden außerschulischen Lernens
- 4.4.1 Beispiele für Methoden an außerschulischen Lernorten
- 5. Außerschulische Unterrichtsreihe „Klimadetektive“
- 5.1 Begründungen des Formats
- 5.1.1 Einordnung in den Lehrplan des Landes NRW
- 5.1.2 Relevanz des Klimathemas
- 5.1.3 Gründe für die außerschulische Behandlung des Klimathemas
- 5.2 Thematischer Einblick – Sachanalyse
- 5.3 Didaktisch-methodischer Kommentar
- 5.3.1 Ablauf der Unterrichtsreihe
- 5.3.2 Material
- 5.3.3 Vorsichtsmaßnahmen
- 5.4 Kompetenzen und Lernziele
- 6. Fazit und Ausblick
- 7. Literaturverzeichnis
- 8. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht das Konzept des außerschulischen Lernens und seine Integration in den Unterricht. Sie analysiert die Vorteile und Herausforderungen dieser Lernform und bietet eine exemplarische Unterrichtsreihe zum Thema Klimaschutz, die außerschulische Elemente integriert.
- Definition und Charakteristika außerschulischen Lernens
- Klassifikation außerschulischer Lernorte und ihre Qualitätskriterien
- Verhältnis von Schulunterricht und außerschulischem Lernen
- Integration außerschulischen Lernens in den Unterricht
- Exemplarische Unterrichtsreihe zum Thema Klimaschutz mit außerschulischen Elementen
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel der Masterarbeit definiert außerschulisches Lernen und beleuchtet seine Charakteristika, die Rolle der Lehrkraft und die historische Entwicklung. Kapitel drei widmet sich der Klassifikation und den Qualitätskriterien außerschulischer Lernorte. Kapitel vier analysiert das Verhältnis von schulischem und außerschulischem Lernen und geht auf die Integration außerschulischen Lernens in den Unterricht ein. Es behandelt die Methoden und die Rückbindung an Lernaktivitäten in der Schule. Kapitel fünf stellt die Unterrichtsreihe "Klimadetektive" vor, die außerschulische Elemente zur Erkundung des Klimas und des Klimawandels integriert. Es analysiert die didaktisch-methodischen Aspekte, die Kompetenz- und Lernziele der Reihe und gibt einen Einblick in die thematische Sachanalyse.
Schlüsselwörter
Außerschulisches Lernen, außerschulische Lernorte, Klimaschutz, Unterrichtsreihe, Integration, Handlungskompetenz, Lehrplan, Sachanalyse, didaktisch-methodischer Kommentar.
- Arbeit zitieren
- Anna Baer (Autor:in), 2018, Außerschulische Lernorte mit einer exemplarischen Unterrichtsreihe zum Thema Klimaschutz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448185