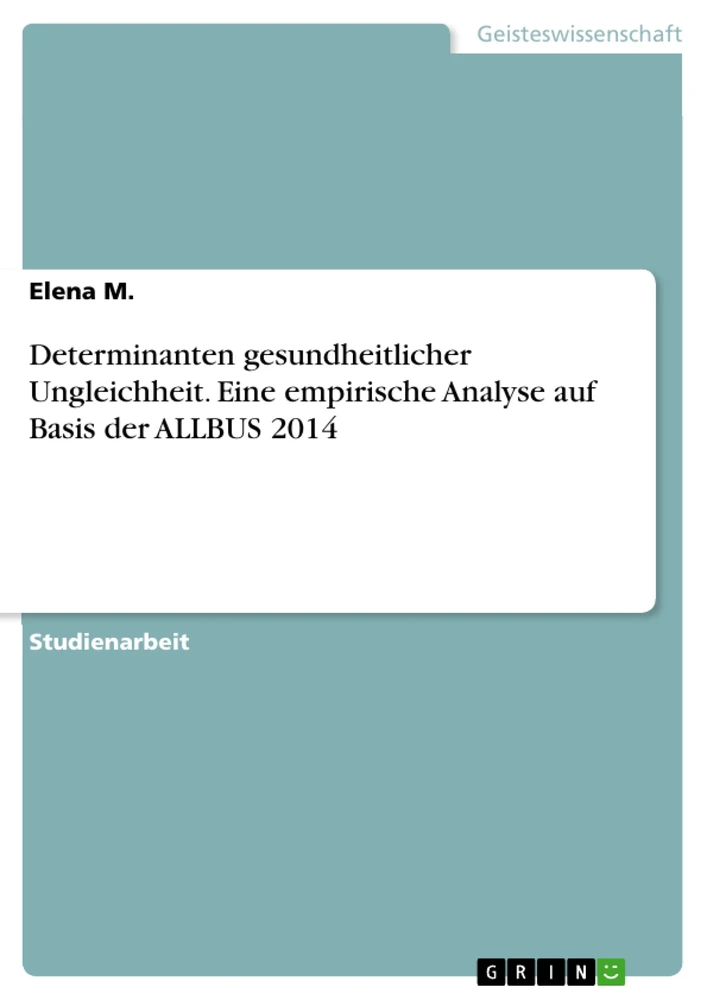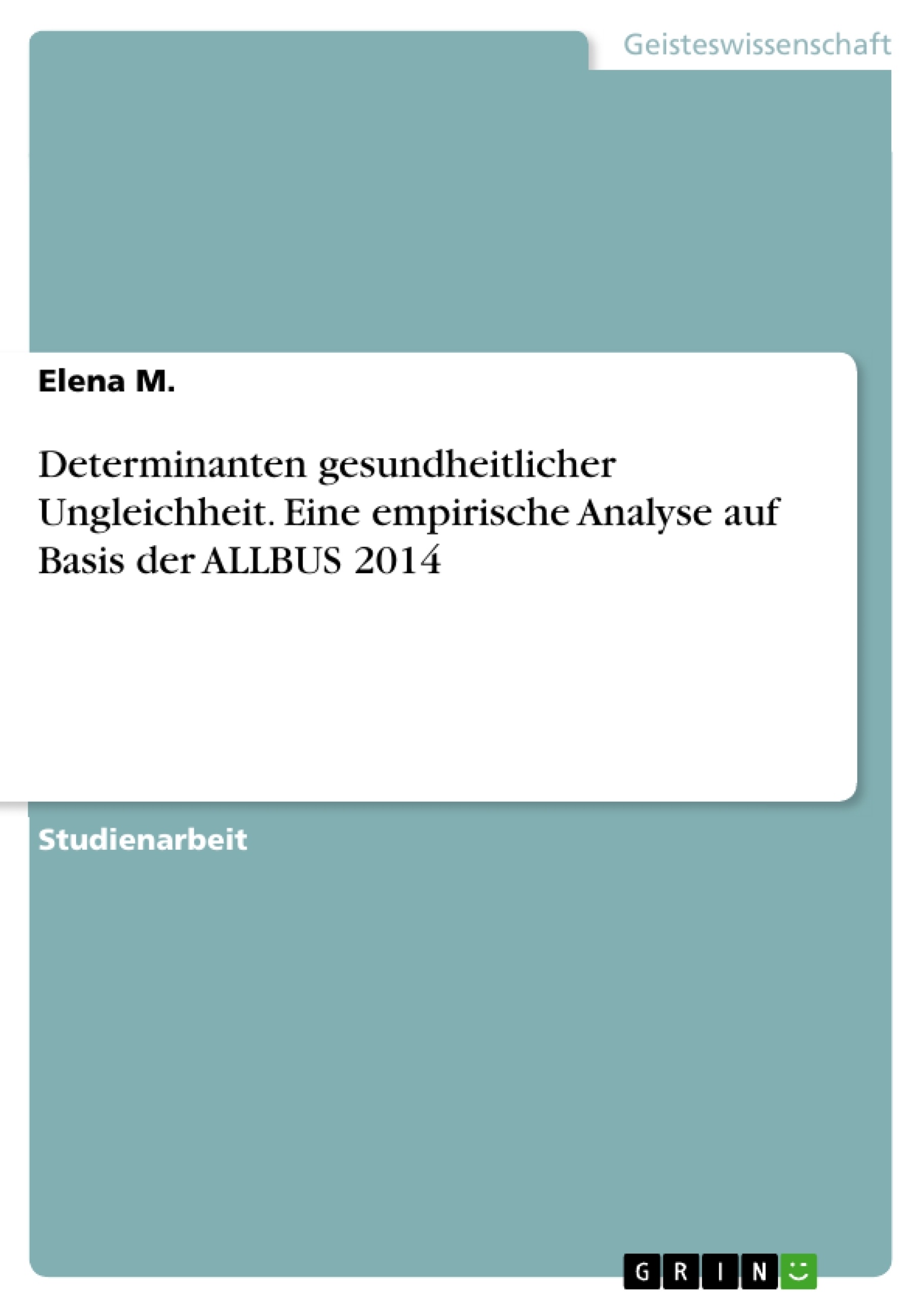Das Ziel dieser Arbeit ist es, die entscheidenden Determinanten der subjektiven Gesundheitsbewertung möglichst umfassend und differenziert zu beschreiben und zu analysieren. Die Hauptfragestellungen lauten: Wie schätzen Personen aus unterschiedlichen Bildungsgruppen ihren subjektiven Gesundheitszustand ein? Inwieweit unterscheiden sich Männer und Frauen in der subjektiven Gesundheitsbewertung? Welche Rolle spielt für die selbst berichtete Gesundheit das Alter?
Um diesen Fragen systematisch nachgehen zu können, wird zunächst ein kurzer Ausblick auf die Konzeption der subjektiven Gesundheit geworfen. Im Anschluss werden die theoretischen Ansätze und der Forschungsstand zu unterschiedlichen Faktoren erörtert, die den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit vermitteln. Darauf aufbauend werden die Datengrundlage und die Methoden dargestellt. Im Fokus des fünften Kapitels stehen die Ergebnisse der deskriptiven und multivariaten Analyse. In der Schlussbetrachtung werden die Befunde sowie einige Einschränkungen der vorliegenden Arbeit kurz zusammengefasst und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeptualisierung der subjektiven Gesundheit
- Mehrperspektivische Definitionen von Gesundheit und Krankheit
- Vor- und Nachteile einer subjektiven Gesundheitskonzeption
- Theorie und Forschungsstand
- Bildung
- Geschlecht
- Alter
- Operationalisierung
- Datengrundlage
- Methoden
- Ergebnisse
- Deskriptive Analyse
- Multivariate Analyse
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Determinanten der subjektiven Gesundheitsbewertung und analysiert, wie Personen aus unterschiedlichen Bildungsgruppen, Geschlechtergruppen und Altersgruppen ihren Gesundheitszustand einschätzen. Sie untersucht, ob und wie sich Bildung, Geschlecht und Alter auf die subjektive Gesundheit auswirken. Die Arbeit trägt dazu bei, das Verständnis der Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit zu vertiefen und die Bedeutung der subjektiven Gesundheit für die Gesundheitsversorgung und die Gesundheitsförderung hervorzuheben.
- Zusammenhang zwischen Bildung und subjektiver Gesundheit
- Einfluss von Geschlecht auf die subjektive Gesundheitsbewertung
- Rolle des Alters für die selbst berichtete Gesundheit
- Konzeptualisierung der subjektiven Gesundheit
- Theoretische und empirische Erklärungsansätze der gesundheitlichen Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den engen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit und stellt den Begriff der "gesundheitlichen Ungleichheit" vor. Sie zeigt die Bedeutung von Bildung für die Lebensqualität und die hohen, aber ungleichen Bildungschancen in Deutschland auf. Das Kapitel analysiert den Einfluss unzureichender Bildung auf die Gesundheit und stellt die kontroverse Debatte um den direkten Einfluss von Bildung auf die Gesundheit gegenüber dem Einfluss durch den Berufsstatus dar.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Konzeptualisierung der subjektiven Gesundheit und definiert den Begriff aus unterschiedlichen Perspektiven, insbesondere der Medizin, der betroffenen Person und der Gesellschaft. Es analysiert die Vor- und Nachteile der subjektiven Gesundheitskonzeption und betont die Bedeutung der Selbstwahrnehmung von Krankheit und Gesundheit für die medizinische Behandlung und die Gesundheitsversorgung.
Das dritte Kapitel widmet sich der Theorie und dem Forschungsstand zum Einfluss von Bildung, Geschlecht und Alter auf die gesundheitliche Ungleichheit. Es zeigt, dass Bildung eine zentrale Ressource für individuelle Lebenschancen ist und sich direkt und indirekt auf die Gesundheit auswirkt. Das Kapitel beleuchtet zudem die unterschiedlichen Einflüsse von Geschlecht und Alter auf die subjektive Gesundheitsbewertung und deren Bedeutung als Indikatoren der ungleichen Gesundheitschancen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der vorliegenden Arbeit sind: subjektive Gesundheit, gesundheitliche Ungleichheit, Bildung, Geschlecht, Alter, Lebensqualität, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist 'gesundheitliche Ungleichheit'?
Es beschreibt den Umstand, dass Gesundheitschancen und Lebenserwartung in der Bevölkerung ungleich verteilt sind und stark vom sozialen Status (Bildung, Einkommen) abhängen.
Wie beeinflusst Bildung die subjektive Gesundheit?
Bildung gilt als zentrale Ressource. Höhere Bildung korreliert oft mit besserem Gesundheitswissen, einem gesünderen Lebensstil und einem höheren Berufsstatus, was die subjektive Gesundheit positiv beeinflusst.
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Gesundheitsbewertung?
Ja, die Arbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede. Oft berichten Frauen trotz höherer Lebenserwartung über mehr gesundheitliche Beschwerden als Männer.
Welche Rolle spielt das Alter für die selbst berichtete Gesundheit?
Mit zunehmendem Alter sinkt in der Regel die subjektive Gesundheitsbewertung, wobei soziale Ressourcen diesen Abfall abmildern können.
Was ist die Datengrundlage dieser Analyse?
Die Untersuchung basiert auf den Daten des ALLBUS 2014 (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften).
Was sind die Vor- und Nachteile einer subjektiven Gesundheitskonzeption?
Ein Vorteil ist die ganzheitliche Sicht des Individuums; ein Nachteil kann die mangelnde Vergleichbarkeit mit objektiven klinischen Befunden sein.
- Citation du texte
- Elena M. (Auteur), 2018, Determinanten gesundheitlicher Ungleichheit. Eine empirische Analyse auf Basis der ALLBUS 2014, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448189