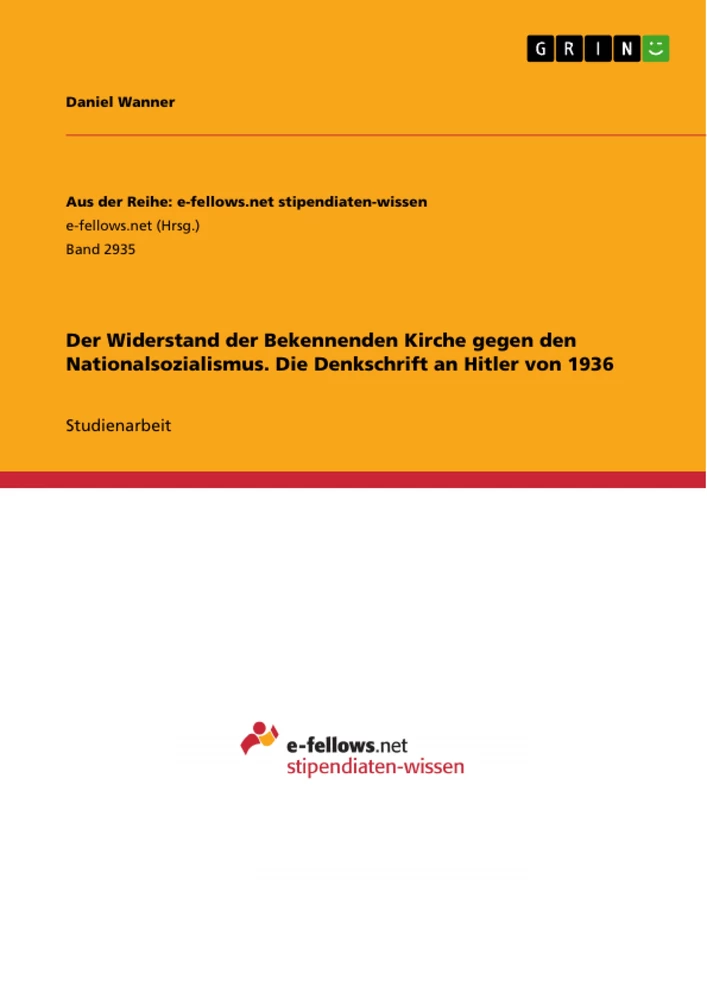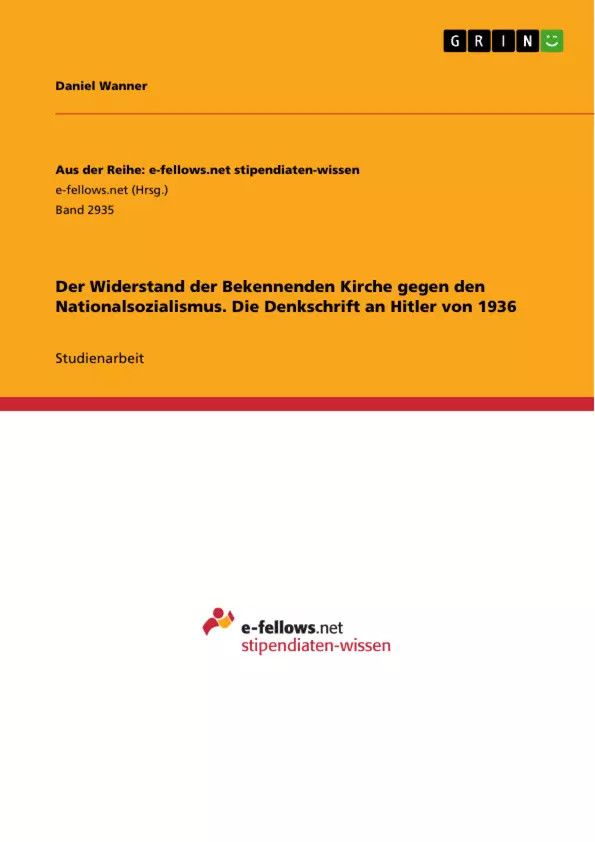Eines der bedeutendsten Dokumente des Widerstandes von Seiten der BK ist die Denkschrift der zweiten Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche an den Reichskanzler Adolf Hitler. Mit dieser Stellungnahme vom 28. Mai 1936 wagte es die BK erstmals, über ihre eigenen Belange hinaus auch die gesellschaftlichen Entwicklungen im NS-Staat zu kritisieren. Vertraulich an Hitler gerichtet, geriet dir Denkschrift gegen den Willen der Verantwortlichen in die Hände verschiedener internationaler Pressestellen und fand so ihren Weg in die Öffentlichkeit.
Diese Arbeit zeigt die Vorgeschichte, den Entstehungsprozess, den Inhalt, die Übergabe und den Weg in die Öffentlichkeit der Denkschrift auch im Vergleich mit einer Stellungnahme der Katholischen Kirche auf. Vor allem aber soll geklärt werden, was die Denkschrift der zweiten VKL zu einem herausragenden Dokument des Widerstands gegen den Nationalsozialismus macht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte und Hintergrund der Denkschrift
- Der Protestantismus in Deutschland nach der „Machtergreifung“
- Die Entstehung der Bekennenden Kirche
- Die Denkschrift der Bekennenden Kirche an Hitler
- Der Entstehungsprozess
- Die Verfasser der Denkschrift
- Entwürfe und Diskussionen
- Der Inhalt der fertigen Denkschrift
- Kritik innerhalb des kirchlichen Bereichs
- Kritik an der gesellschaftlichen Entwicklung
- Die Anlagen der Denkschrift
- Die Übergabe der Schrift
- Der Entstehungsprozess
- Die Weg in die Öffentlichkeit und die darauffolgenden Reaktionen
- Berichterstattung in internationalen Zeitungen
- Hintergründe der „Veröffentlichung“
- Die Kanzelabkündigung der Vorläufigen Kirchenleitung
- Reaktionen der NSDAP
- Die Bedeutung der Denkschrift
- Besonderheiten im Vergleich mit anderen Schriften
- Die Denkschrift als Dokument des Widerstandes
- Vergleich mit der Denkschrift des deutschen Episkopats an Hitler
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Denkschrift der zweiten Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche an den Reichskanzler Adolf Hitler. Die Arbeit beleuchtet die Vorgeschichte, Entstehung, den Inhalt, die Übergabe, den Weg in die Öffentlichkeit und die Bedeutung der Denkschrift, und stellt sie im Vergleich mit einer Stellungnahme der Katholischen Kirche dar. Ziel der Arbeit ist es, die Denkschrift der zweiten VKL als ein herausragendes Dokument des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus zu analysieren und ihren besonderen Stellenwert zu beleuchten.
- Die Entstehung der Bekennenden Kirche im Kontext der Gleichschaltung der evangelischen Kirche durch das NS-Regime.
- Der Entstehungsprozess der Denkschrift, einschließlich der Entwürfe, Diskussionen und der beteiligten Personen.
- Die Kritik der Denkschrift an der nationalsozialistischen Ideologie und den gesellschaftlichen Entwicklungen im NS-Staat.
- Die Reaktion der evangelischen Kirche, der NSDAP und der internationalen Öffentlichkeit auf die Veröffentlichung der Denkschrift.
- Die Bedeutung der Denkschrift als Dokument des Widerstandes im Vergleich mit anderen Schriften der Bekennenden Kirche und der katholischen Kirche.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Denkschrift der Bekennenden Kirche an Hitler als ein bedeutendes Dokument des Widerstandes vor. Sie erläutert den Konflikt zwischen der evangelischen Kirche und dem NS-Staat, der zur Gründung der Bekennenden Kirche führte, und hebt die Bedeutung der Denkschrift als kritische Stellungnahme der Kirche gegen die nationalsozialistische Ideologie hervor. Das Kapitel 2 beleuchtet die Vorgeschichte und den Hintergrund der Denkschrift. Es analysiert die Haltung der evangelischen Kirche zum Nationalsozialismus nach der "Machtergreifung" und die Entstehung der Bekennenden Kirche als Gegenbewegung zur Gleichschaltung. Im Kapitel 3 wird der Entstehungsprozess der Denkschrift detailliert dargestellt, einschließlich der Verfasser, der verschiedenen Entwürfe und der Diskussionen innerhalb der Bekennenden Kirche. Dieses Kapitel befasst sich auch mit dem Inhalt der Denkschrift, der Kritik an der nationalsozialistischen Ideologie, der gesellschaftlichen Entwicklung und der Übergabe der Schrift an Hitler. Kapitel 4 untersucht den Weg der Denkschrift in die Öffentlichkeit, die Reaktion der internationalen Presse und die Folgen für die Bekennende Kirche.
Schlüsselwörter
Bekennende Kirche, Denkschrift, Widerstand, Nationalsozialismus, Gleichschaltung, evangelische Kirche, NS-Regime, Adolf Hitler, Kritik, gesellschaftliche Entwicklung, Veröffentlichung, Reaktionen, Bedeutung, Vergleich, Katholische Kirche.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Denkschrift der Bekennenden Kirche von 1936?
Es war ein bedeutendes Widerstandsdokument, in dem die Bekennende Kirche erstmals über kirchliche Belange hinaus die Ideologie und gesellschaftliche Entwicklung des NS-Staates kritisierte.
Wie gelangte die vertrauliche Denkschrift an die Öffentlichkeit?
Gegen den Willen der Verantwortlichen gelangte die Schrift an internationale Pressestellen und wurde so weltweit bekannt, was heftige Reaktionen der NSDAP auslöste.
Was wurde in der Denkschrift konkret kritisiert?
Die Kritik richtete sich gegen die nationalsozialistische Ideologie, die Verletzung von Rechtsgrundsätzen und die Unterdrückung der kirchlichen Freiheit.
Wer waren die Verfasser dieses Dokuments?
Die Denkschrift wurde von der zweiten Vorläufigen Leitung (VKL) der Deutschen Evangelischen Kirche verfasst und an Adolf Hitler übergeben.
Wie unterschied sich der Widerstand der BK von dem der katholischen Kirche?
Die Arbeit vergleicht die Denkschrift der BK mit Stellungnahmen des deutschen Episkopats, um Besonderheiten im protestantischen Widerstand aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Daniel Wanner (Autor:in), 2017, Der Widerstand der Bekennenden Kirche gegen den Nationalsozialismus. Die Denkschrift an Hitler von 1936, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448516